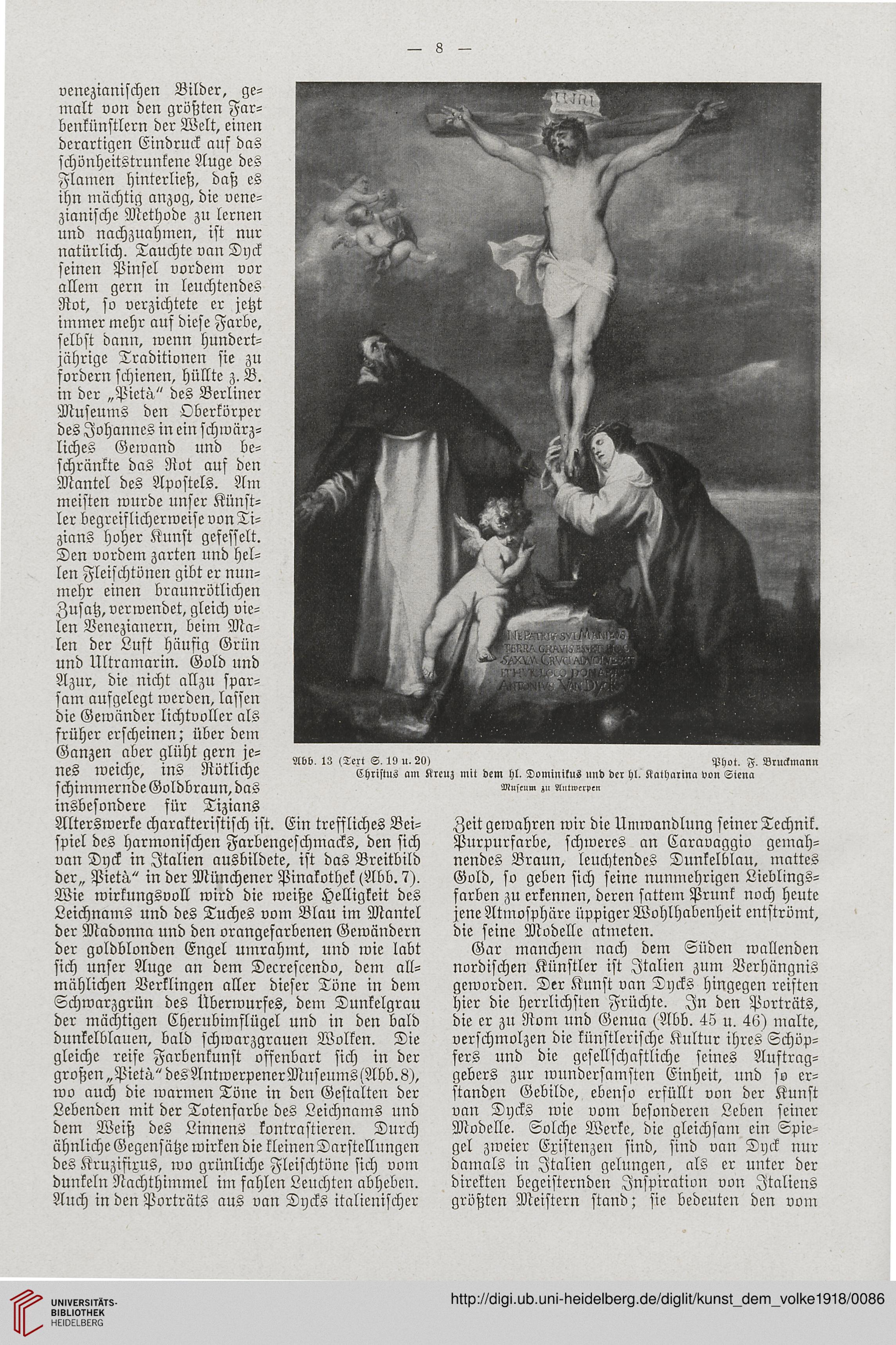— 8 —
venezianischen Bilder, ge-
malt von den größten Far-
benkünstlern der Welt, einen
derartigen Eindruck auf das
schönheitstrunkene Auge des
Flamen hinterließ, daß es
ihn mächtig anzog, die vene-
zianische Methode zu lernen
und nachzuahmen, ist nur
natürlich. Tauchte van Dyck
seinen Pinsel vordem vor
allem gern in leuchtendes
Rot, so verzichtete er jetzt
immer mehr auf diese Farbe,
selbst dann, wenn hundert-
jährige Traditionen sie zu
sordern schienen, hüllte z. B.
in der „Pietü" des Berliner
Museums den Oberkörper
des Johannes in ein schwärz-
liches Gewand und be-
schränkte das Rot auf den
Mantel des Apostels. Am
meisten wurde unser Künst-
ler begreiflicherweisevonTi-
zians hoher Kunst gefesselt.
Den vordem zarten und hel-
len Fleischtönen gibt er nun-
mehr einen braunrötlichen
Zusatz,verwendet, gleich vie-
len Venezianern, beim Ma-
len der Luft häufig Grün
und Ultramarin. Gold und
Azur, die nicht allzu spar-
sam aufgelegt werden, lassen
die Gewänder lichtvoller als
früher erscheinen; über dem
Ganzen aber glüht gern je-
nes weiche, ins Rötliche
schimmernde Goldbraun, das
insbesondere für Tizians
Alterswerke charakteristisch ist. Ein trefsliches Bei-
spiel des harmonischen Farbengeschmacks, den sich
van Dyck in Jtalien ausbildete, ist das Breitbild
der„ PietL" in der Münchener Pinakothek (Abb. 7).
Wie wirkungsvoll wird die weiße Helligkeit des
Leichnams und des Tuches vom Blau im Mantel
der Madonna und den orangefarbenen Gewändern
der goldblonden Engel umrahmt, und wie labt
sich unser Auge an dem Decrescendo, dem all-
mählichen Verklingen aller dieser Töne in dem
Schwarzgrün des Uberwurfes, dem Dunkelgrau
der mächtigen Cherubimflügel und in den bald
dunkelblauen, bald schwarzgrauen Wolken. Die
gleiche reife Farbenkunst ofsenbart sich in der
großen „Pietll" des AntwerpenerMuseums (Abb. 8),
wo auch die warmen Töne in den Gestalten der
Lebenden mit der Totenfarbe des Leichnams und
dem Weiß des Linnens kontrastieren. Durch
ähnliche Gegensätze wirken die kleinenDarstellungen
des Kruzifixus, wo grünliche Fleischtöne sich vom
dunkeln Nachthimmel im fahlen Leuchten abheben.
Auch in den Porträts aus van Dycks italienischer
Abb. 13 (Tert S. 19 u. 20) Phot. F. Bruckmann
Christus am Krcuz mit dem hl. Dominilus und der hl. Katharina von Stena
Zeit gewahren wir die Umwandlung seinerTechnik.
Purpursarbe, schweres an Caravaggio gemah-
nendes Braun, leuchtendes Dunkelblau, inattes
Gold, so geben sich seine nunmehrigen Lieblings-
farben zu erkennen, deren sattem Prunk noch heute
jene Atmosphäre üppiger Wohlhabenheit entströmt,
die seine Modelle atmeten.
Gar manchem nach dem Süden wallenden
nordischen Künstler ist Jtalien zum Verhängnis
geworden. Der Kunst van Dycks hingegen reiften
hier die herrlichsten Früchte. Jn den Porträts,
die er zu Rom und Genua (Abb. 45 u. 46) malte,
verschmolzen die künstlerische Kultur ihres Schöp-
fers und die gesellschaftliche seines Auftrag-
gebers zur wundersamsten Einheit, und so er-
standen Gebilde, ebenso ersüllt von der Kunst
van Dycks wie vom besonderen Leben seiner
Modelle. Solche Werke. die gleichsam ein Spie-
gel zweier Existenzen sind, sind van Dyck nur
damals in Jtalien gelungen, als er unter der
direkten begeisternden Jnspiration von Jtaliens
größten Meistern stand; sie bedeuten den vom
venezianischen Bilder, ge-
malt von den größten Far-
benkünstlern der Welt, einen
derartigen Eindruck auf das
schönheitstrunkene Auge des
Flamen hinterließ, daß es
ihn mächtig anzog, die vene-
zianische Methode zu lernen
und nachzuahmen, ist nur
natürlich. Tauchte van Dyck
seinen Pinsel vordem vor
allem gern in leuchtendes
Rot, so verzichtete er jetzt
immer mehr auf diese Farbe,
selbst dann, wenn hundert-
jährige Traditionen sie zu
sordern schienen, hüllte z. B.
in der „Pietü" des Berliner
Museums den Oberkörper
des Johannes in ein schwärz-
liches Gewand und be-
schränkte das Rot auf den
Mantel des Apostels. Am
meisten wurde unser Künst-
ler begreiflicherweisevonTi-
zians hoher Kunst gefesselt.
Den vordem zarten und hel-
len Fleischtönen gibt er nun-
mehr einen braunrötlichen
Zusatz,verwendet, gleich vie-
len Venezianern, beim Ma-
len der Luft häufig Grün
und Ultramarin. Gold und
Azur, die nicht allzu spar-
sam aufgelegt werden, lassen
die Gewänder lichtvoller als
früher erscheinen; über dem
Ganzen aber glüht gern je-
nes weiche, ins Rötliche
schimmernde Goldbraun, das
insbesondere für Tizians
Alterswerke charakteristisch ist. Ein trefsliches Bei-
spiel des harmonischen Farbengeschmacks, den sich
van Dyck in Jtalien ausbildete, ist das Breitbild
der„ PietL" in der Münchener Pinakothek (Abb. 7).
Wie wirkungsvoll wird die weiße Helligkeit des
Leichnams und des Tuches vom Blau im Mantel
der Madonna und den orangefarbenen Gewändern
der goldblonden Engel umrahmt, und wie labt
sich unser Auge an dem Decrescendo, dem all-
mählichen Verklingen aller dieser Töne in dem
Schwarzgrün des Uberwurfes, dem Dunkelgrau
der mächtigen Cherubimflügel und in den bald
dunkelblauen, bald schwarzgrauen Wolken. Die
gleiche reife Farbenkunst ofsenbart sich in der
großen „Pietll" des AntwerpenerMuseums (Abb. 8),
wo auch die warmen Töne in den Gestalten der
Lebenden mit der Totenfarbe des Leichnams und
dem Weiß des Linnens kontrastieren. Durch
ähnliche Gegensätze wirken die kleinenDarstellungen
des Kruzifixus, wo grünliche Fleischtöne sich vom
dunkeln Nachthimmel im fahlen Leuchten abheben.
Auch in den Porträts aus van Dycks italienischer
Abb. 13 (Tert S. 19 u. 20) Phot. F. Bruckmann
Christus am Krcuz mit dem hl. Dominilus und der hl. Katharina von Stena
Zeit gewahren wir die Umwandlung seinerTechnik.
Purpursarbe, schweres an Caravaggio gemah-
nendes Braun, leuchtendes Dunkelblau, inattes
Gold, so geben sich seine nunmehrigen Lieblings-
farben zu erkennen, deren sattem Prunk noch heute
jene Atmosphäre üppiger Wohlhabenheit entströmt,
die seine Modelle atmeten.
Gar manchem nach dem Süden wallenden
nordischen Künstler ist Jtalien zum Verhängnis
geworden. Der Kunst van Dycks hingegen reiften
hier die herrlichsten Früchte. Jn den Porträts,
die er zu Rom und Genua (Abb. 45 u. 46) malte,
verschmolzen die künstlerische Kultur ihres Schöp-
fers und die gesellschaftliche seines Auftrag-
gebers zur wundersamsten Einheit, und so er-
standen Gebilde, ebenso ersüllt von der Kunst
van Dycks wie vom besonderen Leben seiner
Modelle. Solche Werke. die gleichsam ein Spie-
gel zweier Existenzen sind, sind van Dyck nur
damals in Jtalien gelungen, als er unter der
direkten begeisternden Jnspiration von Jtaliens
größten Meistern stand; sie bedeuten den vom