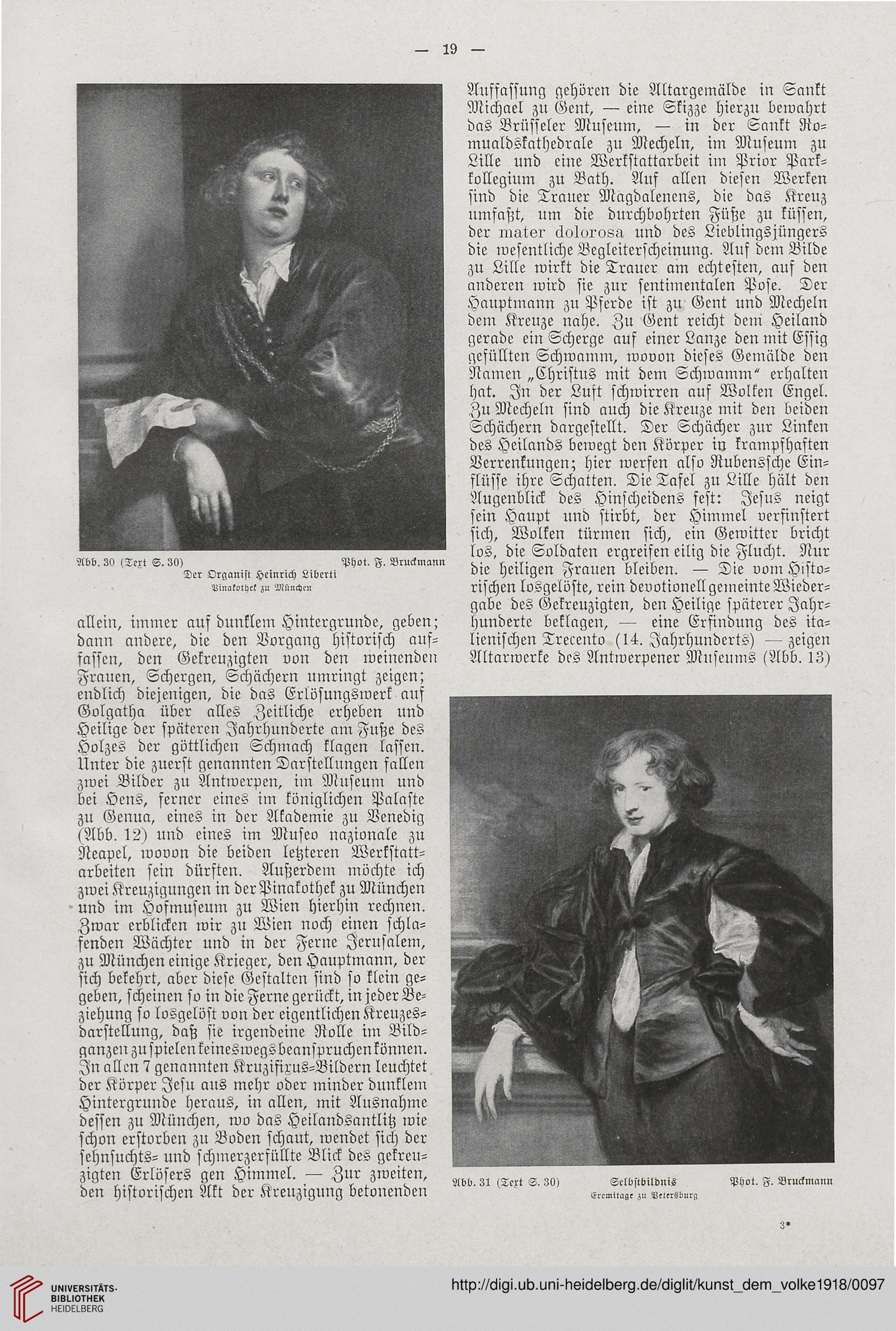19
Abb. 30 (Texl S. 30> Phot. F. Bruckmann
Der Organist Heinrich Libcrti
allein, immer auf dunklem Hintergruude, geben;
dauu andere, die deu Vorgaug historisch auf-
fasseu, den Gekreuzigten oon den weinendeu
Frauen, Schergen, Schächern nmringt zeigen;
endlich diejenigen, die das Erlösnngswerk auf
Golgatha über alles Zeitliche erheben nnd
Heilige der späteren Jahrhunderte am Futze des
Holzes der göttlichen Schmach klagen lassen.
Unter die zuerst genannten Darstellungen fallen
zwei Bilder zu Antwerpen, iin Museuin und
bei Dens, ferner eines im königlichen Palaste
zu Genua, eines in der Akademie zu Venedig
(Abb. 12) und eines im Museo nazionale zu
Neapel, ivovon die beiden letzteren Werkstatt-
arbeiten sein dürften. Autzerdem möchte ich
zwei Kreuzigungen in derPinakothek zu München
und im Hofmuseum zu Wien hierhin rechnen.
Zwar erblicken wir zu Wien noch einen schla-
fenden Wächter und in der Ferne Jerusalem,
zu München einige Krieger, den Hauptmann, der
sich bekehrt, aber diese Gestalten sind so klein ge-
geben, scheinen so in dieFernegerückt, injederBe-
ziehung so losgelöst von der eigentlichen Kreuzes-
darstellung, datz sie irgendeine Rolle im Bild-
ganzenzuspielenkeineswegsbeanspruchenkönnen.
Jn allen 7 genannten Kruzifixus-Bildern leuchtet
der Körper Jesu aus mehr oder minder dunklem
Hintergrunde heraus, in allen, mit Ausnahme
dessen zu München, wo das Heilandsantlitz wie
schon erstorben zu Boden schaut, wendet sich der
sehnsuchts- und schmerzerfüllte Blick des gekreu-
zigten Erlösers gen Himmel. — Zur zweiten,
den historischen Akt der Kreuzigung betonenden
Auffassung gehören die Altargemälde in Sankt
Michael zn Gent, — eine Skizze hierzu bewahrt
das Brüsseler Museum, — in der Sankt Ro-
mualdskathedrale zu Mecheln, im Museum zu
Lille und eine Werkstattarbeit im Prior Park-
kollegium zu Bath. Auf allen diesen Werken
sind die Trauer Magdalenens, die das Kreuz
umfatzt, um die durchbohrten Fütze zu küssen,
der inntar äoloro8n. und des Lieblingsjüngers
die wesentliche Begleiterscheinung. Auf dem Bilde
zu Lille wirkt die Trauer am echtesten, auf den
anderen wird sie zur sentimentalen Pose. Der
Hauptmann zu Pferde ist zu Gent und Mecheln
dem Kreuze nahe. Zu Gent reicht dem Heiland
gerade ein Scherge auf einer Lanze den mit Essig
gefüllten Schwamm, wovon dieses Gemälde den
Namen „Christus mit dem Schwamm" erhalten
hat. Jn der Lust schwirren auf Wolken Engel.
Zu Mecheln sind auch die Kreuze mit den beiden
Schächern dargestellt. Der Schächer zur Linken
des Heilands bewegt den Körper in krampshaften
Verrenkungen; hier werfen also Rubenssche Ein-
flüsse ihre Schatten. Die Tafel zu Lille hält den
Augenblick des Hinscheidens fest: Jesus neigt
sein Haupt und stirbt, der Himmel verfinstert
sich, Wolken türmen sich, ein Gewitter bricht
los, die Soldaten ergreifen eilig die Flucht. Nur
die heiligen Frauen bleiben. — Die vom Histo-
rischen losgelöste, rein devotionellgemeinteWieder-
gabe des Gekreuzigten, den Heilige späterer Jahr-
hunderte beklagen, — eine Erfindung des ita-
lienischen Trecento (14. Jahrhundcrts) —zeigen
Altarwerke des Antwerpener Mnseums (Abb. 13)
Abb. 31 (Tcxt S. 30) Sclbstbildnis Phot. F. Bruckmami
S>
Abb. 30 (Texl S. 30> Phot. F. Bruckmann
Der Organist Heinrich Libcrti
allein, immer auf dunklem Hintergruude, geben;
dauu andere, die deu Vorgaug historisch auf-
fasseu, den Gekreuzigten oon den weinendeu
Frauen, Schergen, Schächern nmringt zeigen;
endlich diejenigen, die das Erlösnngswerk auf
Golgatha über alles Zeitliche erheben nnd
Heilige der späteren Jahrhunderte am Futze des
Holzes der göttlichen Schmach klagen lassen.
Unter die zuerst genannten Darstellungen fallen
zwei Bilder zu Antwerpen, iin Museuin und
bei Dens, ferner eines im königlichen Palaste
zu Genua, eines in der Akademie zu Venedig
(Abb. 12) und eines im Museo nazionale zu
Neapel, ivovon die beiden letzteren Werkstatt-
arbeiten sein dürften. Autzerdem möchte ich
zwei Kreuzigungen in derPinakothek zu München
und im Hofmuseum zu Wien hierhin rechnen.
Zwar erblicken wir zu Wien noch einen schla-
fenden Wächter und in der Ferne Jerusalem,
zu München einige Krieger, den Hauptmann, der
sich bekehrt, aber diese Gestalten sind so klein ge-
geben, scheinen so in dieFernegerückt, injederBe-
ziehung so losgelöst von der eigentlichen Kreuzes-
darstellung, datz sie irgendeine Rolle im Bild-
ganzenzuspielenkeineswegsbeanspruchenkönnen.
Jn allen 7 genannten Kruzifixus-Bildern leuchtet
der Körper Jesu aus mehr oder minder dunklem
Hintergrunde heraus, in allen, mit Ausnahme
dessen zu München, wo das Heilandsantlitz wie
schon erstorben zu Boden schaut, wendet sich der
sehnsuchts- und schmerzerfüllte Blick des gekreu-
zigten Erlösers gen Himmel. — Zur zweiten,
den historischen Akt der Kreuzigung betonenden
Auffassung gehören die Altargemälde in Sankt
Michael zn Gent, — eine Skizze hierzu bewahrt
das Brüsseler Museum, — in der Sankt Ro-
mualdskathedrale zu Mecheln, im Museum zu
Lille und eine Werkstattarbeit im Prior Park-
kollegium zu Bath. Auf allen diesen Werken
sind die Trauer Magdalenens, die das Kreuz
umfatzt, um die durchbohrten Fütze zu küssen,
der inntar äoloro8n. und des Lieblingsjüngers
die wesentliche Begleiterscheinung. Auf dem Bilde
zu Lille wirkt die Trauer am echtesten, auf den
anderen wird sie zur sentimentalen Pose. Der
Hauptmann zu Pferde ist zu Gent und Mecheln
dem Kreuze nahe. Zu Gent reicht dem Heiland
gerade ein Scherge auf einer Lanze den mit Essig
gefüllten Schwamm, wovon dieses Gemälde den
Namen „Christus mit dem Schwamm" erhalten
hat. Jn der Lust schwirren auf Wolken Engel.
Zu Mecheln sind auch die Kreuze mit den beiden
Schächern dargestellt. Der Schächer zur Linken
des Heilands bewegt den Körper in krampshaften
Verrenkungen; hier werfen also Rubenssche Ein-
flüsse ihre Schatten. Die Tafel zu Lille hält den
Augenblick des Hinscheidens fest: Jesus neigt
sein Haupt und stirbt, der Himmel verfinstert
sich, Wolken türmen sich, ein Gewitter bricht
los, die Soldaten ergreifen eilig die Flucht. Nur
die heiligen Frauen bleiben. — Die vom Histo-
rischen losgelöste, rein devotionellgemeinteWieder-
gabe des Gekreuzigten, den Heilige späterer Jahr-
hunderte beklagen, — eine Erfindung des ita-
lienischen Trecento (14. Jahrhundcrts) —zeigen
Altarwerke des Antwerpener Mnseums (Abb. 13)
Abb. 31 (Tcxt S. 30) Sclbstbildnis Phot. F. Bruckmami
S>