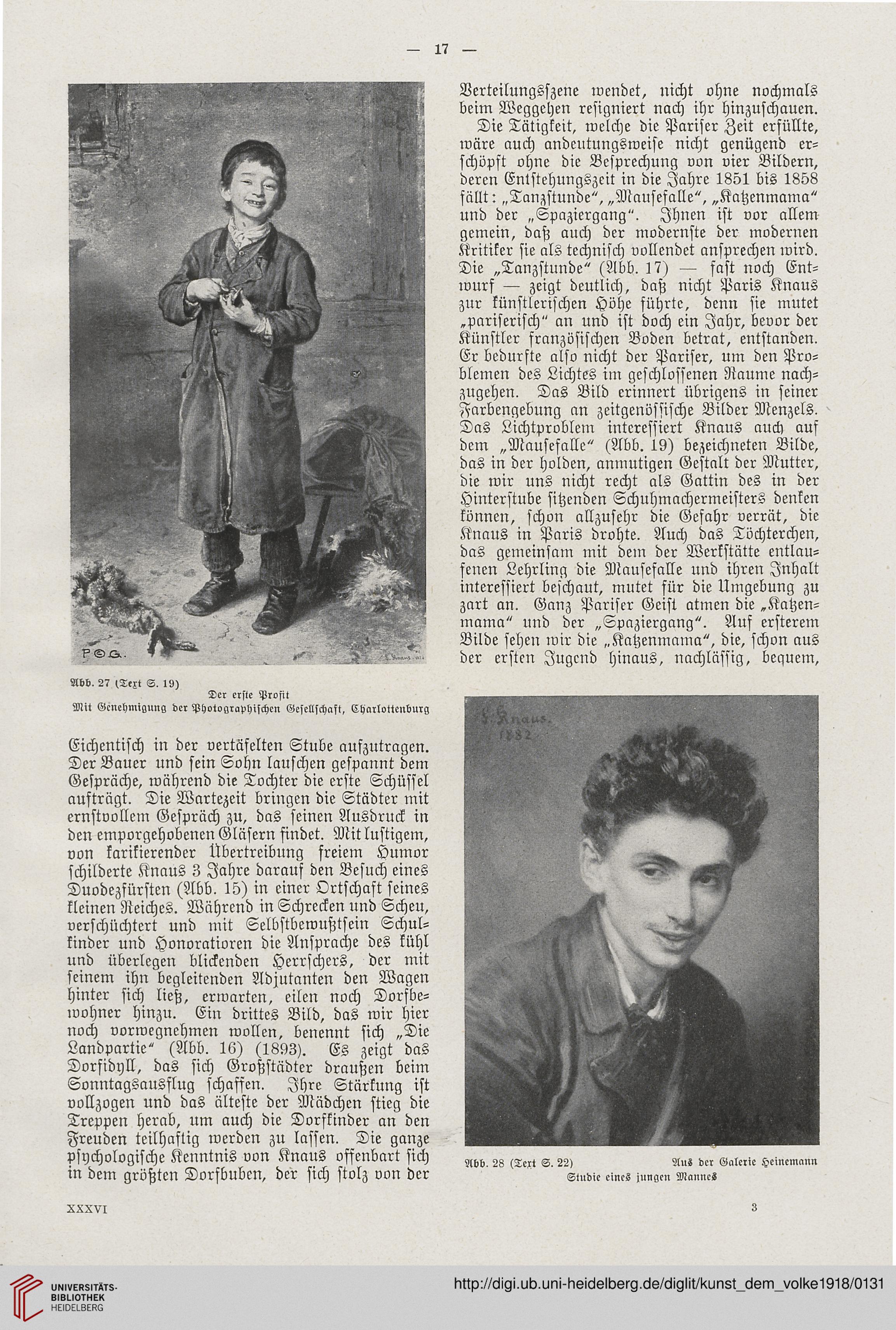17
Abb. 27 (Text S. 19)
Dcr erste Profit
Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft. Charlottcnburg
Eichentisch in der vertäfelten Stube aufzutragen.
Der Bauer und sein Sohn lauschen gespannt dem
Gespräche, während die Tochter die erste Schiissel
aufträgt. Die Wartezeit bringen die Städter mit
ernstvollem Gespräch zu, das seinen Ausdruck in
den emporgehobenen Gläsern findet. Mit lustigem,
von karikierender Ubertreibung freiem Humor
schilderte Knans 3 Jahre darauf den Besuch eines
Duodezfürsten (Abb. 15) in einer Ortschaft seines
kleinen Reiches. Während in Schrecken und Scheu,
verschüchtert und mit Selbstbewußtsein Schul-
kinder und Honoratioren die Ansprache des kühl
und überlegen blickenden Herrschers, der mit
seinem ihn begleitenden Adjutanten den Wagen
hinter sich ließ, erwarten, eilen noch Dorfbe-
wohner hinzu. Ein drittes Bild, das wir hier
noch vorwegnehmen wollen, benennt sich „Die
Landpartie" (Abb. 16) (1893). Es zeigt das
Dorfidyll, das sich Großstädter draußen beim
Sonntagsausflug schaffen. Jhre Stärkung ist
vollzogen und das älteste der Mädchen stieg die
Treppen herab, nm auch die Dorfkinder an den
Freuden teilhaftig werden zu lassen. Die ganze
psychologische Kenntnis von Knaus offenbart sich
in dem größten Dorfbuben, der sich stolz von der
Verteilungsszene wendet, nicht ohne nochmals
beim Weggehen resigniert nach ihr hinzuschauen.
Die Tätigkeit, welche die Pariser Zeit erfüllte,
wäre auch andeutungsweise nicht genügend er-
schöpft ohne die Besprechung von vier Bildern,
deren Entstehungszeit in die Jahre 1851 bis 1858
fällt: „Tanzstunde", „Mausefalle", „Katzenmama"
und der „Spaziergang". Jhnen ist vor allem
gemein, daß auch der modernste der modernen
Kritiker sie als technisch vollendet ansprechen wird.
Die „Tanzstunde" (Abb. 17) — fast noch Ent-
wurf — zeigt deutlich, daß nicht Paris Knaus
zur künstlerischen Höhe führtc, denn sie mutet
„pariserisch" an und ist doch ein Jahr, bevor der
Künstler französischen Boden betrat, entstanden.
Er bedurfte also nicht der Pariser, um den Pro-
blemen des Lichtes im geschlossenen Raume nach-
zugehen. Das Bild erinnert übrigens in seiner
Farbengebung an zeitgenössische Bilder Menzels.
Das Lichtproblem interessiert Knaus auch auf
dem „Mausefalle" (Abb. 19) bezeichneten Bilde,
das in der holden, anmutigen Gestalt der Mutter,
die wir uns nicht recht als Gattin des in der
Hinterstube sitzenden Schuhmachermeisters denken
können, schon allzusehr die Gefahr verrät, die
Knaus in Paris drohte. Auch das Töchterchen,
das gemeinsam mit dem der Werkstätte entlau-
fenen Lehrling die Mausefalle und ihren Jnhalt
interessiert beschaut, mutet für die Umgebung zu
zart an. Ganz Pariser Geist atmen die „Katzen-
mama" und der „Spaziergang". Auf ersterem
Bilde sehen wir die „Katzenmama", die, schon aus
der erstcn Jugcnd hinaus, nachlässig, bequem.
Abb. 28 (Text S. 22) Aus dcr Galeiie Heinemann
Siudie eincs jungcn ManncL
XXXVI
3
Abb. 27 (Text S. 19)
Dcr erste Profit
Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft. Charlottcnburg
Eichentisch in der vertäfelten Stube aufzutragen.
Der Bauer und sein Sohn lauschen gespannt dem
Gespräche, während die Tochter die erste Schiissel
aufträgt. Die Wartezeit bringen die Städter mit
ernstvollem Gespräch zu, das seinen Ausdruck in
den emporgehobenen Gläsern findet. Mit lustigem,
von karikierender Ubertreibung freiem Humor
schilderte Knans 3 Jahre darauf den Besuch eines
Duodezfürsten (Abb. 15) in einer Ortschaft seines
kleinen Reiches. Während in Schrecken und Scheu,
verschüchtert und mit Selbstbewußtsein Schul-
kinder und Honoratioren die Ansprache des kühl
und überlegen blickenden Herrschers, der mit
seinem ihn begleitenden Adjutanten den Wagen
hinter sich ließ, erwarten, eilen noch Dorfbe-
wohner hinzu. Ein drittes Bild, das wir hier
noch vorwegnehmen wollen, benennt sich „Die
Landpartie" (Abb. 16) (1893). Es zeigt das
Dorfidyll, das sich Großstädter draußen beim
Sonntagsausflug schaffen. Jhre Stärkung ist
vollzogen und das älteste der Mädchen stieg die
Treppen herab, nm auch die Dorfkinder an den
Freuden teilhaftig werden zu lassen. Die ganze
psychologische Kenntnis von Knaus offenbart sich
in dem größten Dorfbuben, der sich stolz von der
Verteilungsszene wendet, nicht ohne nochmals
beim Weggehen resigniert nach ihr hinzuschauen.
Die Tätigkeit, welche die Pariser Zeit erfüllte,
wäre auch andeutungsweise nicht genügend er-
schöpft ohne die Besprechung von vier Bildern,
deren Entstehungszeit in die Jahre 1851 bis 1858
fällt: „Tanzstunde", „Mausefalle", „Katzenmama"
und der „Spaziergang". Jhnen ist vor allem
gemein, daß auch der modernste der modernen
Kritiker sie als technisch vollendet ansprechen wird.
Die „Tanzstunde" (Abb. 17) — fast noch Ent-
wurf — zeigt deutlich, daß nicht Paris Knaus
zur künstlerischen Höhe führtc, denn sie mutet
„pariserisch" an und ist doch ein Jahr, bevor der
Künstler französischen Boden betrat, entstanden.
Er bedurfte also nicht der Pariser, um den Pro-
blemen des Lichtes im geschlossenen Raume nach-
zugehen. Das Bild erinnert übrigens in seiner
Farbengebung an zeitgenössische Bilder Menzels.
Das Lichtproblem interessiert Knaus auch auf
dem „Mausefalle" (Abb. 19) bezeichneten Bilde,
das in der holden, anmutigen Gestalt der Mutter,
die wir uns nicht recht als Gattin des in der
Hinterstube sitzenden Schuhmachermeisters denken
können, schon allzusehr die Gefahr verrät, die
Knaus in Paris drohte. Auch das Töchterchen,
das gemeinsam mit dem der Werkstätte entlau-
fenen Lehrling die Mausefalle und ihren Jnhalt
interessiert beschaut, mutet für die Umgebung zu
zart an. Ganz Pariser Geist atmen die „Katzen-
mama" und der „Spaziergang". Auf ersterem
Bilde sehen wir die „Katzenmama", die, schon aus
der erstcn Jugcnd hinaus, nachlässig, bequem.
Abb. 28 (Text S. 22) Aus dcr Galeiie Heinemann
Siudie eincs jungcn ManncL
XXXVI
3