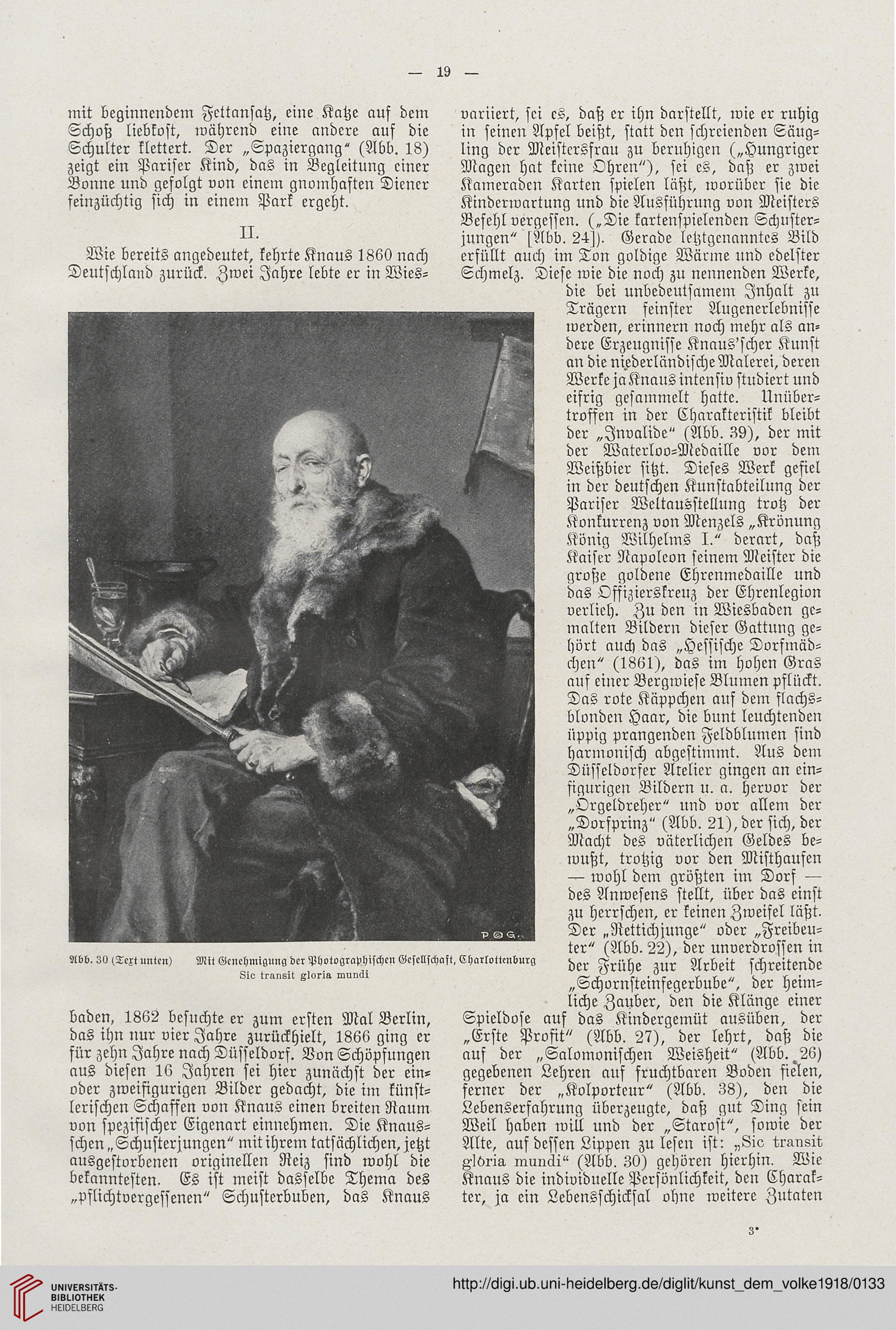19
mit beginnendem Fettansatz, eine Katze auf dem
Schoß liebkost, mährend eine andcre auf die
Schulter klettert. Der „Spaziergang" (Abb. 18)
zeigt ein Pariser Kind, das in Begleitung ciner
Bonne und gefolgt von einem gnomhaften Diener
feinzüchtig sich in einem Park ergeht.
Wie bereits angedeutet, kehrte Knaus 1860 nach
Deutschland zurück. Zwei Jahre lebte er in Wies-
Slbb. 30 (Text unten) Mit Gcnehmigung der Photographischcn Gesellschaft, Charlottenburg
8Le transit Zloria mnnäi
baden, 1862 besuchte er zum ersten Mal Berlin,
das ihn nur vier Jahre zurückhielt, 1866 ging er
für zehn Jahre nach Düsfeldorf. Von Schöpfungen
aus diesen 16 Jahren fei hier zunächst der ein-
oder zweifigurigen Bilder gedacht, die im künst-
lerischen Schaffen von Knaus einen breiten Raum
von spezifischer Eigenart einnehmen. Die Knaus-
schen „ Schusterjungen" mit ihrem tatsächlichen, jetzt
ausgestorbenen originellen Reiz sind wohl die
bekanntesten. Es ist meist dasselbe Thema des
„pflichtvergessenen" Schusterbuben, das Knaus
variiert, sei es, daß er ihn darstellt, wie er ruhig
in seinen Apfel beißt, ftatt den schreienden Säug-
ling der Meistersfrau zu beruhigen („Hungriger
Magen hat kcine Ohren"), sei es, daß er zwei
Kameraden Karten spielen läßt, worüber sie die
Kinderwartung und die Ausführung von Meisters
Besehl vergessen. („Die kartenspielenden Schuster-
jungen" sAbb. 24j). Gerade letztgenanntes Bild
erfüllt auch im Ton goldige Wärme und edelster
Schmelz. Diese wie die nock) zu nennenden Werke,
die bei unbedeutsamem Jnhalt zu
Trägern feinster Augenerlebnisse
werden, erinnern noch mehr als an-
dere Erzeugnisse Knaus'scher Kunst
an die njederländischeMalerei, deren
WerkejaKnaus intensiv studiert und
eifrig gesammelt hatte. Unüber-
troffen in der Charakteristik bleibt
der „Jnvalide" (Abb. 39), der mit
der Waterloo-Medaille vor dem
Weißbier sitzt. Dieses Werk gefiel
in der deutschen Kunstabteilung der
Pariser Weltausstellung trotz der
Konkurrenz von Menzels „Krönung
König Wilhelms I." derart, daß
Kaiser Napoleon seinem Meister die
große goldene Ehrenmedaille und
das Offizierskreuz der Ehrenlegion
verlieh. Zu den in Wiesbaden ge-
malten Bildern dieser Gattung ge-
hört auch das „Hessische Dorfmäd-
chen" (1861), das im hohen Gras
auf einer Bergwiese Blumen pflückt.
Das rote Käppchen auf dem flachs-
blonden Haar, die bunt leuchtenden
üppig prangenden Feldblumen sind
harmonisch abgestimmt. Aus dem
Düsseldorfer Arelier gingen an ein-
figurigen Bildern u. a. hervor der
„Orgeldreher" und vor allem der
„Dorfprinz" (Abb. 21),der sich, der
Macht des väterlichen Geldes be-
wußt, trotzig vor den Misthaufen
— wohl dem größten im Dorf —
des Anwesens stellt, über das einst
zu herrschen, er keinen Zweifel läßt.
Der „Rettichjunge" oder „Freibeu-
ter" (Abb. 22), der unverdrossen in
der Frühe zur Arbeit schreitende
„Schornsteinfegerbube", der heim-
liche Zauber, den die Klänge einer
Spieldose auf das Kindergemüt ausüben, der
„Erste Profit" (Abb. 27), der lehrt, daß die
auf der „Salomonischen Weisheit" (Abb.^26)
gegebenen Lehren auf fruchtbaren Boden fiAen,
ferner der „Kolporteur" (Abb. 38), den die
Lebenserfahrung überzeugte, daß gut Ding sein
Weil haben will und der „Starost", sowie der
Alte, auf dessen Lippen zu lesen ist: „8io trav8it
Alüria manäi" (Abb. 30) gehören hierhin. Wie
Knaus die individuelle Persönlichkeit, den Charak-
ter, ja ein Lebensschicksal ohne weitere Zutaten
s-
mit beginnendem Fettansatz, eine Katze auf dem
Schoß liebkost, mährend eine andcre auf die
Schulter klettert. Der „Spaziergang" (Abb. 18)
zeigt ein Pariser Kind, das in Begleitung ciner
Bonne und gefolgt von einem gnomhaften Diener
feinzüchtig sich in einem Park ergeht.
Wie bereits angedeutet, kehrte Knaus 1860 nach
Deutschland zurück. Zwei Jahre lebte er in Wies-
Slbb. 30 (Text unten) Mit Gcnehmigung der Photographischcn Gesellschaft, Charlottenburg
8Le transit Zloria mnnäi
baden, 1862 besuchte er zum ersten Mal Berlin,
das ihn nur vier Jahre zurückhielt, 1866 ging er
für zehn Jahre nach Düsfeldorf. Von Schöpfungen
aus diesen 16 Jahren fei hier zunächst der ein-
oder zweifigurigen Bilder gedacht, die im künst-
lerischen Schaffen von Knaus einen breiten Raum
von spezifischer Eigenart einnehmen. Die Knaus-
schen „ Schusterjungen" mit ihrem tatsächlichen, jetzt
ausgestorbenen originellen Reiz sind wohl die
bekanntesten. Es ist meist dasselbe Thema des
„pflichtvergessenen" Schusterbuben, das Knaus
variiert, sei es, daß er ihn darstellt, wie er ruhig
in seinen Apfel beißt, ftatt den schreienden Säug-
ling der Meistersfrau zu beruhigen („Hungriger
Magen hat kcine Ohren"), sei es, daß er zwei
Kameraden Karten spielen läßt, worüber sie die
Kinderwartung und die Ausführung von Meisters
Besehl vergessen. („Die kartenspielenden Schuster-
jungen" sAbb. 24j). Gerade letztgenanntes Bild
erfüllt auch im Ton goldige Wärme und edelster
Schmelz. Diese wie die nock) zu nennenden Werke,
die bei unbedeutsamem Jnhalt zu
Trägern feinster Augenerlebnisse
werden, erinnern noch mehr als an-
dere Erzeugnisse Knaus'scher Kunst
an die njederländischeMalerei, deren
WerkejaKnaus intensiv studiert und
eifrig gesammelt hatte. Unüber-
troffen in der Charakteristik bleibt
der „Jnvalide" (Abb. 39), der mit
der Waterloo-Medaille vor dem
Weißbier sitzt. Dieses Werk gefiel
in der deutschen Kunstabteilung der
Pariser Weltausstellung trotz der
Konkurrenz von Menzels „Krönung
König Wilhelms I." derart, daß
Kaiser Napoleon seinem Meister die
große goldene Ehrenmedaille und
das Offizierskreuz der Ehrenlegion
verlieh. Zu den in Wiesbaden ge-
malten Bildern dieser Gattung ge-
hört auch das „Hessische Dorfmäd-
chen" (1861), das im hohen Gras
auf einer Bergwiese Blumen pflückt.
Das rote Käppchen auf dem flachs-
blonden Haar, die bunt leuchtenden
üppig prangenden Feldblumen sind
harmonisch abgestimmt. Aus dem
Düsseldorfer Arelier gingen an ein-
figurigen Bildern u. a. hervor der
„Orgeldreher" und vor allem der
„Dorfprinz" (Abb. 21),der sich, der
Macht des väterlichen Geldes be-
wußt, trotzig vor den Misthaufen
— wohl dem größten im Dorf —
des Anwesens stellt, über das einst
zu herrschen, er keinen Zweifel läßt.
Der „Rettichjunge" oder „Freibeu-
ter" (Abb. 22), der unverdrossen in
der Frühe zur Arbeit schreitende
„Schornsteinfegerbube", der heim-
liche Zauber, den die Klänge einer
Spieldose auf das Kindergemüt ausüben, der
„Erste Profit" (Abb. 27), der lehrt, daß die
auf der „Salomonischen Weisheit" (Abb.^26)
gegebenen Lehren auf fruchtbaren Boden fiAen,
ferner der „Kolporteur" (Abb. 38), den die
Lebenserfahrung überzeugte, daß gut Ding sein
Weil haben will und der „Starost", sowie der
Alte, auf dessen Lippen zu lesen ist: „8io trav8it
Alüria manäi" (Abb. 30) gehören hierhin. Wie
Knaus die individuelle Persönlichkeit, den Charak-
ter, ja ein Lebensschicksal ohne weitere Zutaten
s-