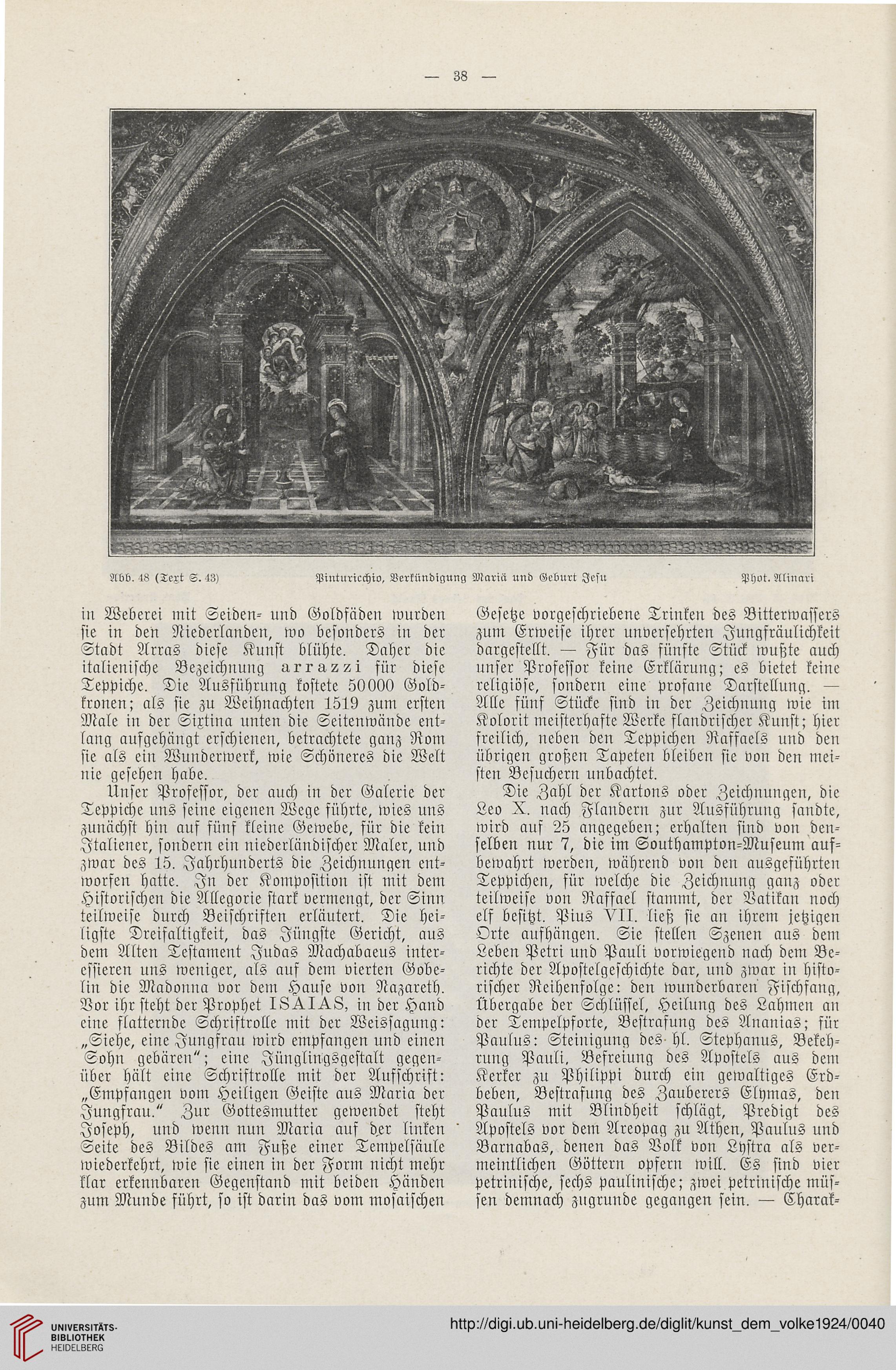38
Abb. 48 <Text S. 43) Pinturicchio, Verkiindigung Mariü und Gcburt Jcsu
Phot. Alinari
in Weberei mit Seiden- und Goldfäden wurden
sie in den Niederlanden, wo besoiiders in der
Stadt Arras diese Kunst blühte. Daher die
italienische Bezeichnung urr 9,221 für diese
Teppiche. Die Ausführung kostete 50000 Gold-
kronen; als sie zu Weihnachten 1519 zum ersten
Male in der Sixtina unten die Seitenwände ent-
lang aufgehängt erschienen, betrachtete ganz Rom
sie als ein Wunderwerk, wie Schöneres die Welt
nie gesehen habe.
Unser Professor, der auch in der Galerie der
Teppiche uns seine eigenen Wege führte, wies uns
zunächst hin aus fünf kleine Gewebe, für die kein
Jtaliener, sondern ein niederländischer Maler, und
zwar des 15. Jahrhunderts die Zeichnungen ent-
worfen hatte. Jn der Komposition ist mit dem
Historischen die Allegorie stark vermengt, der Sinn
teilweise durch Beischriften erläutert. Die hei-
ligste Dreifaltigkeit, das Jüngste Gericht, aus
dem Alten Testament Judas Machabaeus inter-
essieren uns weniger, als auf dem vierten Gobe-
lin die Madonna vor dem Hause von Nazareth.
Vor ihr steht der Prophet I8XIV8, in der Hand
eine flatternde Schristrolle mit der Weissagung:
„Siehe, eine Jungfrau wird empfangen und einen
Sohn gebären"; eine Jünglingsgestalt gegen-
über hält eine Schriftrolle mit der Aufschrift:
„Empfangen vom Heiligen Geiste aus Maria der
Jungfrau." Zur Gottesmutter gewendet steht
Joseph, und wenn nun Maria auf ster linken
Seite des Bildes am Fuße einer Tempelsäule
wiederkehrt, wie sie einen in der Form nicht mehr
klar erkennbaren Gegenstand mit beiden Hlinden
zum Munde führt, so ist darin das vom mosaischen
Gesetze vorgeschriebene Trinken des Bitterwassers
zum Erweise ihrer unversehrten Jungfräulichkeit
dargestellt. — Für das fünfte Stück wußte auch
unser Professor keine Erklärung; es bietet keine
religiöse, sondern eine profane Darstellung. —
Alle fünf Stücke sind in der Zeichnung wie im
Kolorit meisterhafte Werke flandrischer Kunst; hier
freilich, neben den Teppichen Raffaels und den
übrigen großen Tapeten bleiben sie von den mei-
sten Besuchern unbachtet.
Die Zahl der Kartons oder Zeichnungen, die
Leo X. nach Flandern zur Ausführung sandte,
wird auf 25 angegeben; erhalten sind von den-
selben nur 7, die im Southampton-Museum auf-
bewahrt werden, während vou den ausgeführten
Teppichen, für welche die Zeichnung ganz oder
teilweise von Raffael stammt, der Vatikan noch
els besitzt. Pius VII. ließ sie an ihrem jetzigen
Orte aufhängen. Sie stellen Szenen aus dem
Leben Petri und Pauli vorwiegend nach dem Be-
richte der Apostelgeschichte dar, und zwar in histo-
rischer Reihenfolge: den wunderbaren Fischfang,
Übergabe der Schlüssel, Heilung des Lahmen an
der Tempelpforte, Bestrafung des Ananias; für
Paulus: Steinigung des hl. Stephanus, Bekeh-
rung Pauli. Befreiung des Apostels aus dem
Kerker zu Philippi durch ein gewaltiges Erd-
beben, Bestrafung des Zauberers Elymas, den
Paulus mit Blindheit schlägt, Predigt des
Apostels vor dem Areopag zu Athen, Paulus und
Barnabas, denen das Volk von Lystra als ver-
meintlichen Göttern opfern will. Es sind vier
petrinische, sechs paulinische; zwei petrinische müs-
sen demnach ztigrunde gegangen sein. — Charak-
Abb. 48 <Text S. 43) Pinturicchio, Verkiindigung Mariü und Gcburt Jcsu
Phot. Alinari
in Weberei mit Seiden- und Goldfäden wurden
sie in den Niederlanden, wo besoiiders in der
Stadt Arras diese Kunst blühte. Daher die
italienische Bezeichnung urr 9,221 für diese
Teppiche. Die Ausführung kostete 50000 Gold-
kronen; als sie zu Weihnachten 1519 zum ersten
Male in der Sixtina unten die Seitenwände ent-
lang aufgehängt erschienen, betrachtete ganz Rom
sie als ein Wunderwerk, wie Schöneres die Welt
nie gesehen habe.
Unser Professor, der auch in der Galerie der
Teppiche uns seine eigenen Wege führte, wies uns
zunächst hin aus fünf kleine Gewebe, für die kein
Jtaliener, sondern ein niederländischer Maler, und
zwar des 15. Jahrhunderts die Zeichnungen ent-
worfen hatte. Jn der Komposition ist mit dem
Historischen die Allegorie stark vermengt, der Sinn
teilweise durch Beischriften erläutert. Die hei-
ligste Dreifaltigkeit, das Jüngste Gericht, aus
dem Alten Testament Judas Machabaeus inter-
essieren uns weniger, als auf dem vierten Gobe-
lin die Madonna vor dem Hause von Nazareth.
Vor ihr steht der Prophet I8XIV8, in der Hand
eine flatternde Schristrolle mit der Weissagung:
„Siehe, eine Jungfrau wird empfangen und einen
Sohn gebären"; eine Jünglingsgestalt gegen-
über hält eine Schriftrolle mit der Aufschrift:
„Empfangen vom Heiligen Geiste aus Maria der
Jungfrau." Zur Gottesmutter gewendet steht
Joseph, und wenn nun Maria auf ster linken
Seite des Bildes am Fuße einer Tempelsäule
wiederkehrt, wie sie einen in der Form nicht mehr
klar erkennbaren Gegenstand mit beiden Hlinden
zum Munde führt, so ist darin das vom mosaischen
Gesetze vorgeschriebene Trinken des Bitterwassers
zum Erweise ihrer unversehrten Jungfräulichkeit
dargestellt. — Für das fünfte Stück wußte auch
unser Professor keine Erklärung; es bietet keine
religiöse, sondern eine profane Darstellung. —
Alle fünf Stücke sind in der Zeichnung wie im
Kolorit meisterhafte Werke flandrischer Kunst; hier
freilich, neben den Teppichen Raffaels und den
übrigen großen Tapeten bleiben sie von den mei-
sten Besuchern unbachtet.
Die Zahl der Kartons oder Zeichnungen, die
Leo X. nach Flandern zur Ausführung sandte,
wird auf 25 angegeben; erhalten sind von den-
selben nur 7, die im Southampton-Museum auf-
bewahrt werden, während vou den ausgeführten
Teppichen, für welche die Zeichnung ganz oder
teilweise von Raffael stammt, der Vatikan noch
els besitzt. Pius VII. ließ sie an ihrem jetzigen
Orte aufhängen. Sie stellen Szenen aus dem
Leben Petri und Pauli vorwiegend nach dem Be-
richte der Apostelgeschichte dar, und zwar in histo-
rischer Reihenfolge: den wunderbaren Fischfang,
Übergabe der Schlüssel, Heilung des Lahmen an
der Tempelpforte, Bestrafung des Ananias; für
Paulus: Steinigung des hl. Stephanus, Bekeh-
rung Pauli. Befreiung des Apostels aus dem
Kerker zu Philippi durch ein gewaltiges Erd-
beben, Bestrafung des Zauberers Elymas, den
Paulus mit Blindheit schlägt, Predigt des
Apostels vor dem Areopag zu Athen, Paulus und
Barnabas, denen das Volk von Lystra als ver-
meintlichen Göttern opfern will. Es sind vier
petrinische, sechs paulinische; zwei petrinische müs-
sen demnach ztigrunde gegangen sein. — Charak-