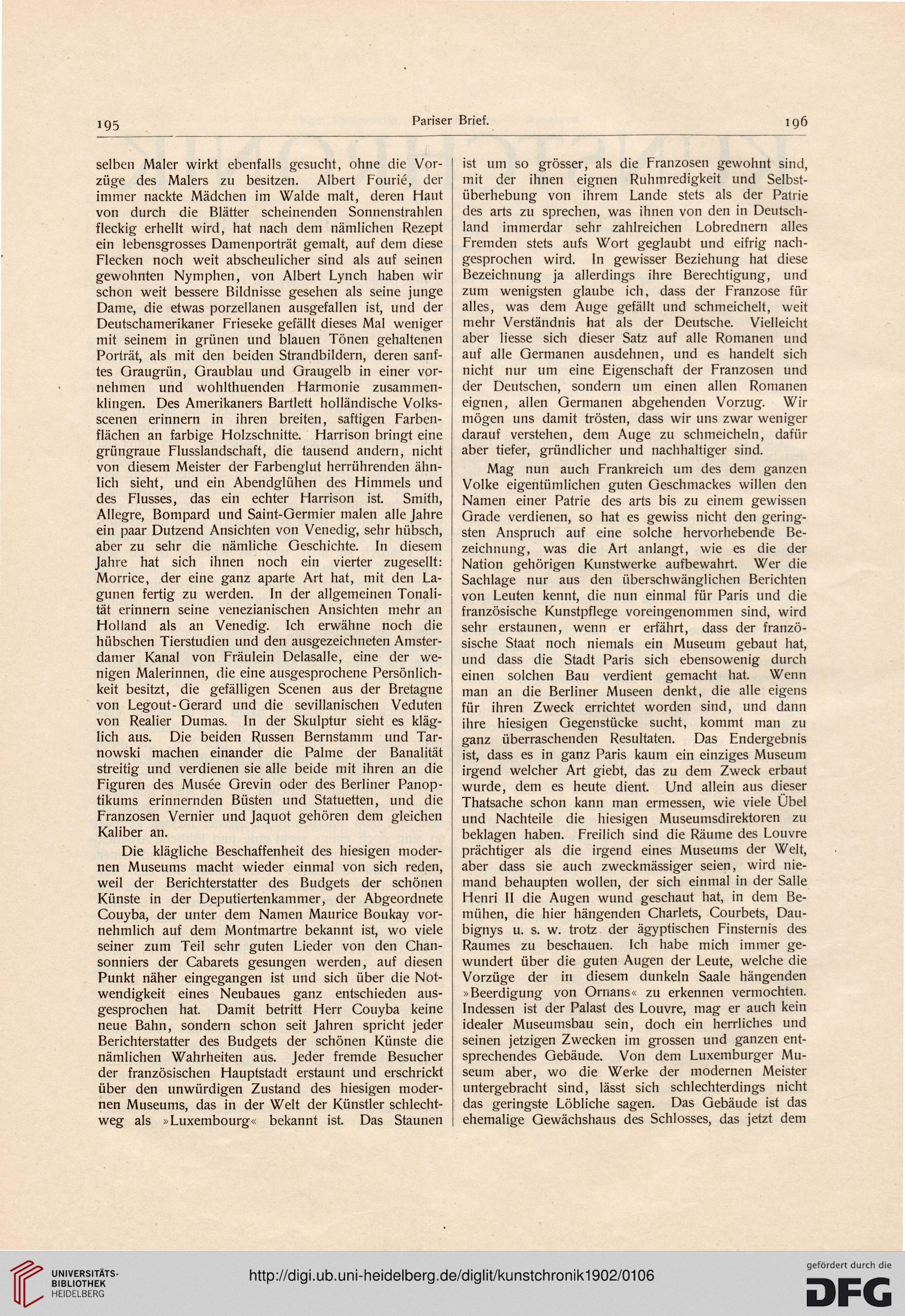195
Pariser Brief.
selben Maler wirkt ebenfalls gesucht, ohne die Vor-
züge des Malers zu besitzen. Albert Fourie, der
immer nackte Mädchen im Walde malt, deren Haut
von durch die Blätter scheinenden Sonnenstrahlen
fleckig erhellt wird, hat nach dem nämlichen Rezept
ein lebensgrosses Damenporträt gemalt, auf dem diese
Flecken noch weit abscheulicher sind als auf seinen
gewohnten Nymphen, von Albert Lynch haben wir
schon weit bessere Bildnisse gesehen als seine junge
Dame, die etwas porzellanen ausgefallen ist, und der
Deutschamerikaner Frieseke gefällt dieses Mal weniger
mit seinem in grünen und blauen Tönen gehaltenen
Porträt, als mit den beiden Strandbildern, deren sanf-
tes Graugrün, Graublau und Graugelb in einer vor-
nehmen und wohlthuenden Harmonie zusammen-
klingen. Des Amerikaners Bartlett holländische Volks-
scenen erinnern in ihren breiten, saftigen Farben-
flächen an farbige Holzschnitte. Harrison bringt eine
grüngraue Flusslandschaft, die tausend andern, nicht
von diesem Meister der Farbenglut herrührenden ähn-
lich sieht, und ein Abendglühen des Himmels und
des Flusses, das ein echter Harrison ist. Smith,
Allegre, Bompard und Saint-Germier malen alle Jahre
ein paar Dutzend Ansichten von Venedig, sehr hübsch,
aber zu sehr die nämliche Geschichte. In diesem
Jahre hat sich ihnen noch ein vierter zugesellt:
Morrice, der eine ganz aparte Art hat, mit den La-
gunen fertig zu werden. In der allgemeinen Tonali-
tät erinnern seine venezianischen Ansichten mehr an
Holland als an Venedig. Ich erwähne noch die
hübschen Tierstudien und den ausgezeichneten Amster-
damer Kanal von Fräulein Delasalle, eine der we-
nigen Malerinnen, die eine ausgesprochene Persönlich-
keit besitzt, die gefälligen Scenen aus der Bretagne
von Legout-Gerard und die sevillanischen Veduten
von Realier Dumas. In der Skulptur sieht es kläg-
lich aus. Die beiden Russen Bernstamm und Tar-
nowski machen einander die Palme der Banalität
streitig und verdienen sie alle beide mit ihren an die
Figuren des Musee Grevin oder des Berliner Panop-
tikums erinnernden Büsten und Statuetten, und die
Franzosen Vernier und Jaquot gehören dem gleichen
Kaliber an.
Die klägliche Beschaffenheit des hiesigen moder-
nen Museums macht wieder einmal von sich reden,
weil der Berichterstatter des Budgets der schönen
Künste in der Deputiertenkammer, der Abgeordnete
Couyba, der unter dem Namen Maurice Boukay vor-
nehmlich auf dem Montmartre bekannt ist, wo viele
seiner zum Teil sehr guten Lieder von den Chan-
sonniers der Cabarets gesungen werden, auf diesen
Punkt näher eingegangen ist und sich über die Not-
wendigkeit eines Neubaues ganz entschieden aus-
gesprochen hat. Damit betritt Herr Couyba keine
neue Bahn, sondern schon seit Jahren spricht jeder
Berichterstatter des Budgets der schönen Künste die
nämlichen Wahrheiten aus. Jeder fremde Besucher
der französischen Hauptstadt erstaunt und erschrickt
über den unwürdigen Zustand des hiesigen moder-
nen Museums, das in der Welt der Künstler schlecht-
weg als »Luxembourg« bekannt ist. Das Staunen
ist um so grösser, als die Franzosen gewohnt sind,
mit der ihnen eignen Ruhmredigkeit und Selbst-
überhebung von ihrem Lande stets als der Patrie
des arts zu sprechen, was ihnen von den in Deutsch-
land immerdar sehr zahlreichen Lobrednern alles
Fremden stets aufs Wort geglaubt und eifrig nach-
gesprochen wird. In gewisser Beziehung hat diese
Bezeichnung ja allerdings ihre Berechtigung, und
zum wenigsten glaube ich, dass der Franzose für
alles, was dem Auge gefällt und schmeichelt, weit
mehr Verständnis hat als der Deutsche. Vielleicht
aber liesse sich dieser Satz auf alle Romanen und
auf alle Germanen ausdehnen, und es handelt sich
nicht nur um eine Eigenschaft der Franzosen und
der Deutschen, sondern um einen allen Romanen
eignen, allen Germanen abgehenden Vorzug. Wir
mögen uns damit trösten, dass wir uns zwar weniger
darauf verstehen, dem Auge zu schmeicheln, dafür
aber tiefer, gründlicher und nachhaltiger sind.
Mag nun auch Frankreich um des dem ganzen
Volke eigentümlichen guten Geschmackes willen den
Namen einer Patrie des arts bis zu einem gewissen
Grade verdienen, so hat es gewiss nicht den gering-
sten Anspruch auf eine solche hervorhebende Be-
zeichnung, was die Art anlangt, wie es die der
Nation gehörigen Kunstwerke aufbewahrt. Wer die
Sachlage nur aus den überschwänglichen Berichten
von Leuten kennt, die nun einmal für Paris und die
französische Kunstpflege voreingenommen sind, wird
sehr erstaunen, wenn er erfährt, dass der franzö-
sische Staat noch niemals ein Museum gebaut hat,
und dass die Stadt Paris sich ebensowenig durch
einen solchen Bau verdient gemacht hat. Wenn
man an die Berliner Museen denkt, die alle eigens
für ihren Zweck errichtet worden sind, und dann
ihre hiesigen Gegenstücke sucht, kommt man zu
ganz überraschenden Resultaten. Das Endergebnis
ist, dass es in ganz Paris kaum ein einziges Museum
irgend welcher Art giebt, das zu dem Zweck erbaut
wurde, dem es heute dient. Und allein aus dieser
Thatsache schon kann man ermessen, wie viele Übel
und Nachteile die hiesigen Museumsdirektoren zu
beklagen haben. Freilich sind die Räume des Louvre
prächtiger als die irgend eines Museums der Welt,
aber dass sie auch zweckmässiger seien, wird nie-
mand behaupten wollen, der sich einmal in der Salle
Henri II die Augen wund geschaut hat, in dem Be-
mühen, die hier hängenden Charlets, Courbets, Dau-
bignys u. s. w. trotz der ägyptischen Finsternis des
Raumes zu beschauen. Ich habe mich immer ge-
wundert über die guten Augen der Leute, welche die
Vorzüge der in diesem dunkeln Saale hängenden
»Beerdigung von Omans« zu erkennen vermochten.
Indessen ist der Palast des Louvre, mag er auch kein
idealer Museumsbau sein, doch ein herrliches und
seinen jetzigen Zwecken im grossen und ganzen ent-
sprechendes Gebäude. Von dem Luxemburger Mu-
seum aber, wo die Werke der modernen Meister
untergebracht sind, lässt sich schlechterdings nicht
das geringste Löbliche sagen. Das Gebäude ist das
ehemalige Gewächshaus des Schlosses, das jetzt dem
Pariser Brief.
selben Maler wirkt ebenfalls gesucht, ohne die Vor-
züge des Malers zu besitzen. Albert Fourie, der
immer nackte Mädchen im Walde malt, deren Haut
von durch die Blätter scheinenden Sonnenstrahlen
fleckig erhellt wird, hat nach dem nämlichen Rezept
ein lebensgrosses Damenporträt gemalt, auf dem diese
Flecken noch weit abscheulicher sind als auf seinen
gewohnten Nymphen, von Albert Lynch haben wir
schon weit bessere Bildnisse gesehen als seine junge
Dame, die etwas porzellanen ausgefallen ist, und der
Deutschamerikaner Frieseke gefällt dieses Mal weniger
mit seinem in grünen und blauen Tönen gehaltenen
Porträt, als mit den beiden Strandbildern, deren sanf-
tes Graugrün, Graublau und Graugelb in einer vor-
nehmen und wohlthuenden Harmonie zusammen-
klingen. Des Amerikaners Bartlett holländische Volks-
scenen erinnern in ihren breiten, saftigen Farben-
flächen an farbige Holzschnitte. Harrison bringt eine
grüngraue Flusslandschaft, die tausend andern, nicht
von diesem Meister der Farbenglut herrührenden ähn-
lich sieht, und ein Abendglühen des Himmels und
des Flusses, das ein echter Harrison ist. Smith,
Allegre, Bompard und Saint-Germier malen alle Jahre
ein paar Dutzend Ansichten von Venedig, sehr hübsch,
aber zu sehr die nämliche Geschichte. In diesem
Jahre hat sich ihnen noch ein vierter zugesellt:
Morrice, der eine ganz aparte Art hat, mit den La-
gunen fertig zu werden. In der allgemeinen Tonali-
tät erinnern seine venezianischen Ansichten mehr an
Holland als an Venedig. Ich erwähne noch die
hübschen Tierstudien und den ausgezeichneten Amster-
damer Kanal von Fräulein Delasalle, eine der we-
nigen Malerinnen, die eine ausgesprochene Persönlich-
keit besitzt, die gefälligen Scenen aus der Bretagne
von Legout-Gerard und die sevillanischen Veduten
von Realier Dumas. In der Skulptur sieht es kläg-
lich aus. Die beiden Russen Bernstamm und Tar-
nowski machen einander die Palme der Banalität
streitig und verdienen sie alle beide mit ihren an die
Figuren des Musee Grevin oder des Berliner Panop-
tikums erinnernden Büsten und Statuetten, und die
Franzosen Vernier und Jaquot gehören dem gleichen
Kaliber an.
Die klägliche Beschaffenheit des hiesigen moder-
nen Museums macht wieder einmal von sich reden,
weil der Berichterstatter des Budgets der schönen
Künste in der Deputiertenkammer, der Abgeordnete
Couyba, der unter dem Namen Maurice Boukay vor-
nehmlich auf dem Montmartre bekannt ist, wo viele
seiner zum Teil sehr guten Lieder von den Chan-
sonniers der Cabarets gesungen werden, auf diesen
Punkt näher eingegangen ist und sich über die Not-
wendigkeit eines Neubaues ganz entschieden aus-
gesprochen hat. Damit betritt Herr Couyba keine
neue Bahn, sondern schon seit Jahren spricht jeder
Berichterstatter des Budgets der schönen Künste die
nämlichen Wahrheiten aus. Jeder fremde Besucher
der französischen Hauptstadt erstaunt und erschrickt
über den unwürdigen Zustand des hiesigen moder-
nen Museums, das in der Welt der Künstler schlecht-
weg als »Luxembourg« bekannt ist. Das Staunen
ist um so grösser, als die Franzosen gewohnt sind,
mit der ihnen eignen Ruhmredigkeit und Selbst-
überhebung von ihrem Lande stets als der Patrie
des arts zu sprechen, was ihnen von den in Deutsch-
land immerdar sehr zahlreichen Lobrednern alles
Fremden stets aufs Wort geglaubt und eifrig nach-
gesprochen wird. In gewisser Beziehung hat diese
Bezeichnung ja allerdings ihre Berechtigung, und
zum wenigsten glaube ich, dass der Franzose für
alles, was dem Auge gefällt und schmeichelt, weit
mehr Verständnis hat als der Deutsche. Vielleicht
aber liesse sich dieser Satz auf alle Romanen und
auf alle Germanen ausdehnen, und es handelt sich
nicht nur um eine Eigenschaft der Franzosen und
der Deutschen, sondern um einen allen Romanen
eignen, allen Germanen abgehenden Vorzug. Wir
mögen uns damit trösten, dass wir uns zwar weniger
darauf verstehen, dem Auge zu schmeicheln, dafür
aber tiefer, gründlicher und nachhaltiger sind.
Mag nun auch Frankreich um des dem ganzen
Volke eigentümlichen guten Geschmackes willen den
Namen einer Patrie des arts bis zu einem gewissen
Grade verdienen, so hat es gewiss nicht den gering-
sten Anspruch auf eine solche hervorhebende Be-
zeichnung, was die Art anlangt, wie es die der
Nation gehörigen Kunstwerke aufbewahrt. Wer die
Sachlage nur aus den überschwänglichen Berichten
von Leuten kennt, die nun einmal für Paris und die
französische Kunstpflege voreingenommen sind, wird
sehr erstaunen, wenn er erfährt, dass der franzö-
sische Staat noch niemals ein Museum gebaut hat,
und dass die Stadt Paris sich ebensowenig durch
einen solchen Bau verdient gemacht hat. Wenn
man an die Berliner Museen denkt, die alle eigens
für ihren Zweck errichtet worden sind, und dann
ihre hiesigen Gegenstücke sucht, kommt man zu
ganz überraschenden Resultaten. Das Endergebnis
ist, dass es in ganz Paris kaum ein einziges Museum
irgend welcher Art giebt, das zu dem Zweck erbaut
wurde, dem es heute dient. Und allein aus dieser
Thatsache schon kann man ermessen, wie viele Übel
und Nachteile die hiesigen Museumsdirektoren zu
beklagen haben. Freilich sind die Räume des Louvre
prächtiger als die irgend eines Museums der Welt,
aber dass sie auch zweckmässiger seien, wird nie-
mand behaupten wollen, der sich einmal in der Salle
Henri II die Augen wund geschaut hat, in dem Be-
mühen, die hier hängenden Charlets, Courbets, Dau-
bignys u. s. w. trotz der ägyptischen Finsternis des
Raumes zu beschauen. Ich habe mich immer ge-
wundert über die guten Augen der Leute, welche die
Vorzüge der in diesem dunkeln Saale hängenden
»Beerdigung von Omans« zu erkennen vermochten.
Indessen ist der Palast des Louvre, mag er auch kein
idealer Museumsbau sein, doch ein herrliches und
seinen jetzigen Zwecken im grossen und ganzen ent-
sprechendes Gebäude. Von dem Luxemburger Mu-
seum aber, wo die Werke der modernen Meister
untergebracht sind, lässt sich schlechterdings nicht
das geringste Löbliche sagen. Das Gebäude ist das
ehemalige Gewächshaus des Schlosses, das jetzt dem