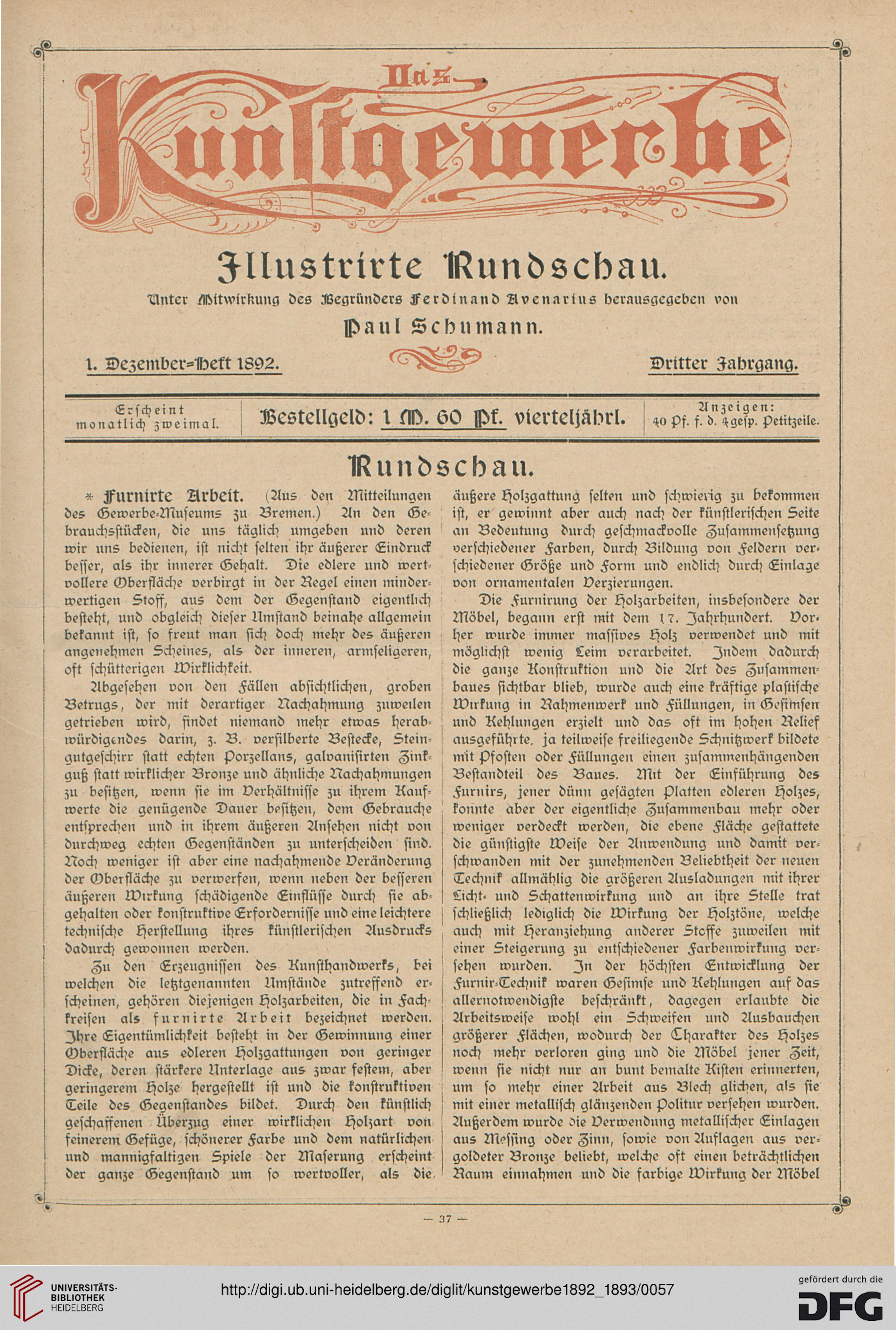Allustrirte lkundsckkm.
Anter /Dttrvirkung dcs Wegründers Ferdtnsnd Avennrtns berausgegebcn von
panl Lcdumnnn.
l. Dezember-Dekt tSS2. Dritter Aalir§ang.
Lrscheint
rnonatlich zweimal.
Westellgeld: t M. 60 pk. vierteljädrl.
Änzeigen:
^c» pf. f. d. H gesp. petitzeile.
IKu ndsckau.
* Furntrte Tlrbett. (Aus den rnttteilungen
des Gewerbe-tNuseums zu Bremen.) An den Ge-
brauchsstücken, die uns täglich umgeben und deren
wir nns bedienen, ist nicht selten chr äußerer Lindrnck
besser, als chr innerer Gehalt. Die edlere und wert-
vollere Mberfläche verbirgt in der Regel einen minder-
wertigen Stoff, aus dem der Gegenstand eigentbch ^
besteht, und obgleich dieser llmstand beinahe allgemein
bekannt ist, so freut man sich doch mehr des äußeren
angenehmen Scheines, als der inneren, armseligeren,
oft schütterigen Virklichkeit.
Abgesehen von den Fällen absichtlichen, groben ^
Betrugs, der mit derartiger Nachahmung zuweilen !
getrieben wird, findet niemand mehr etwas herab- !
würdigendes darin, z. B. versilberte Bestecke, Stein- !
gutgeschirr statt echten porzellans, galvanisirten Zink- !
guß stait wirklicher Bronze und ähnliche Nachahmungen !
zu besitzen, wenn sie im verhältnisse zu ihrem Rauf- !
werte dis genügende Dauer besitzen, dem Gebrauche !
entsprechen und in ihrem äußeren Ansehen nicht von ^
durchweg echten Gegenständen zu unterscheiden sind.
Noch weniger ist aber eine nachahmende veränderung
der Vberfläche zu verwerfen, wenn neben der besseren
äußeren IVirkung schädigende Linflüsse durch sie ab-
gehalten oder konstruktive Lrfordernisse und eine leichtere
technische kierstellung ihres künstlerischen Ausdrucks !
dadurch gewonnen werden.
Zu den Lrzeugnissen des Aunsthandwerks, bei !
welchen die letztgenannten Nmstände zutreffend er- !
scheinen, gehären diejenigen ^olzarbeiten, die in Fach- I
kreisen als furnirte Arbeik bezeichnet werden. !
Zhre Ligentümlichkeit besteht in der Gewinnung einer
Gberfläche aus edleren ksolzgattungen von geringer
Dicke, deren stärkere Unterlage aus zwar festem, aber
geringerem ksolze hergestellt ist und die konstruktiven -
Teile des Gegenstandes bildet. Durch den künstlich !
geschaffenen Überzug einer wirklichen kjolzart von
feinerein Gefüge, schänerer Larbe und dem natürlichen
nnd mannigfaltigen Spiele der Maserung erscheint
der ganze Gegenstand um so wertvoller, als die
Ttt___
äußere ksolzgattung selten und schwierig zu bekommen
ist, er gewinnt aber auch nach der künstlerischen Seite
an Bedeutung durch geschmackoolle Zusammensetzung
verschiedener Larben, durch Bildung von Leldern ver-
schiedener Größe und Lorm und endlich dnrch Ginlage
von ornamentalen Verzierungen.
Die Lurnirung der ksolzarbeiten, insbesondere der
Nlöbel, begann erst mit dem 17. Zahrhundert. vor-
her wurde immer massives Ljolz oerwendet und mit
möglichst wenig ^eim verarbeitet. Zndem dadurch
die ganze Aonstruktion und die Art des Zusammen-
baues sichtbar blieb, wurde auch eine kräftige plastische
Mirkung in Nahmenwerk und Lüllungen, in Gesiinsen
und Aehlungen erzielt und das oft im hohen Nelief
ausgefühi te. ja teilweise freiliegende Schnitzwerk bildete
mit pfosten oder Lüllungen einen zusammenhängenden
Bestandteil des Baues. Nlit der Linführung des
Lnrnirs, jener dünn gesägten platten edleren ksolzes,
konnte aber der eigentliche Zusammenbau mehr oder
weniger verdeckt werden, die ebene Lläche gestattete
die günstigste weise der Anwendung und damit ver-
schwanden mit der zunehmenden Beliebtheit der neuen
Technik allmählig die gräßeren Ausladungsn mit ihrer
Licht- und Achattenwirkung und an ihre Stelle trat
schließlich lediglich die wirkung der l^olztöne, welche
auch mit ^eranziehung anderer Stoffe zuweilen init
einer Steigerung zu entschiedener Larbenwirkung ver-
sehen wurden. Zn der hächsten Lntwicklung der
Lurnir-Technik waren Gesimse und Aehlungen auf das
allernotweiidigsle beschränkt, dagegen erlanbte die
Arbeitsweise wohl ein Schweifen und Ausbauchen
gräßerer Llächen, wodurch dev iLharakter des ksolzes
noch inehr verloren ging und die Niöbel jener Zeit,
wenn sie nicht nur an bunt bemalte Risten erinnerten,
um so mehr einer Arbeit aus Blech glichen, als sie
mit einer metallisch glänzenden politur versehen wurden.
Außerdem wurde oie verwendung metallischer Ginlagen
aus Messing oder Zinn, sowie von Auflagen aus ver-
goldeter Bronze beliebt, welchc oft einen beträchtlichen
Naum einnahmen und die farbige Mirkung der Möbel
Anter /Dttrvirkung dcs Wegründers Ferdtnsnd Avennrtns berausgegebcn von
panl Lcdumnnn.
l. Dezember-Dekt tSS2. Dritter Aalir§ang.
Lrscheint
rnonatlich zweimal.
Westellgeld: t M. 60 pk. vierteljädrl.
Änzeigen:
^c» pf. f. d. H gesp. petitzeile.
IKu ndsckau.
* Furntrte Tlrbett. (Aus den rnttteilungen
des Gewerbe-tNuseums zu Bremen.) An den Ge-
brauchsstücken, die uns täglich umgeben und deren
wir nns bedienen, ist nicht selten chr äußerer Lindrnck
besser, als chr innerer Gehalt. Die edlere und wert-
vollere Mberfläche verbirgt in der Regel einen minder-
wertigen Stoff, aus dem der Gegenstand eigentbch ^
besteht, und obgleich dieser llmstand beinahe allgemein
bekannt ist, so freut man sich doch mehr des äußeren
angenehmen Scheines, als der inneren, armseligeren,
oft schütterigen Virklichkeit.
Abgesehen von den Fällen absichtlichen, groben ^
Betrugs, der mit derartiger Nachahmung zuweilen !
getrieben wird, findet niemand mehr etwas herab- !
würdigendes darin, z. B. versilberte Bestecke, Stein- !
gutgeschirr statt echten porzellans, galvanisirten Zink- !
guß stait wirklicher Bronze und ähnliche Nachahmungen !
zu besitzen, wenn sie im verhältnisse zu ihrem Rauf- !
werte dis genügende Dauer besitzen, dem Gebrauche !
entsprechen und in ihrem äußeren Ansehen nicht von ^
durchweg echten Gegenständen zu unterscheiden sind.
Noch weniger ist aber eine nachahmende veränderung
der Vberfläche zu verwerfen, wenn neben der besseren
äußeren IVirkung schädigende Linflüsse durch sie ab-
gehalten oder konstruktive Lrfordernisse und eine leichtere
technische kierstellung ihres künstlerischen Ausdrucks !
dadurch gewonnen werden.
Zu den Lrzeugnissen des Aunsthandwerks, bei !
welchen die letztgenannten Nmstände zutreffend er- !
scheinen, gehären diejenigen ^olzarbeiten, die in Fach- I
kreisen als furnirte Arbeik bezeichnet werden. !
Zhre Ligentümlichkeit besteht in der Gewinnung einer
Gberfläche aus edleren ksolzgattungen von geringer
Dicke, deren stärkere Unterlage aus zwar festem, aber
geringerem ksolze hergestellt ist und die konstruktiven -
Teile des Gegenstandes bildet. Durch den künstlich !
geschaffenen Überzug einer wirklichen kjolzart von
feinerein Gefüge, schänerer Larbe und dem natürlichen
nnd mannigfaltigen Spiele der Maserung erscheint
der ganze Gegenstand um so wertvoller, als die
Ttt___
äußere ksolzgattung selten und schwierig zu bekommen
ist, er gewinnt aber auch nach der künstlerischen Seite
an Bedeutung durch geschmackoolle Zusammensetzung
verschiedener Larben, durch Bildung von Leldern ver-
schiedener Größe und Lorm und endlich dnrch Ginlage
von ornamentalen Verzierungen.
Die Lurnirung der ksolzarbeiten, insbesondere der
Nlöbel, begann erst mit dem 17. Zahrhundert. vor-
her wurde immer massives Ljolz oerwendet und mit
möglichst wenig ^eim verarbeitet. Zndem dadurch
die ganze Aonstruktion und die Art des Zusammen-
baues sichtbar blieb, wurde auch eine kräftige plastische
Mirkung in Nahmenwerk und Lüllungen, in Gesiinsen
und Aehlungen erzielt und das oft im hohen Nelief
ausgefühi te. ja teilweise freiliegende Schnitzwerk bildete
mit pfosten oder Lüllungen einen zusammenhängenden
Bestandteil des Baues. Nlit der Linführung des
Lnrnirs, jener dünn gesägten platten edleren ksolzes,
konnte aber der eigentliche Zusammenbau mehr oder
weniger verdeckt werden, die ebene Lläche gestattete
die günstigste weise der Anwendung und damit ver-
schwanden mit der zunehmenden Beliebtheit der neuen
Technik allmählig die gräßeren Ausladungsn mit ihrer
Licht- und Achattenwirkung und an ihre Stelle trat
schließlich lediglich die wirkung der l^olztöne, welche
auch mit ^eranziehung anderer Stoffe zuweilen init
einer Steigerung zu entschiedener Larbenwirkung ver-
sehen wurden. Zn der hächsten Lntwicklung der
Lurnir-Technik waren Gesimse und Aehlungen auf das
allernotweiidigsle beschränkt, dagegen erlanbte die
Arbeitsweise wohl ein Schweifen und Ausbauchen
gräßerer Llächen, wodurch dev iLharakter des ksolzes
noch inehr verloren ging und die Niöbel jener Zeit,
wenn sie nicht nur an bunt bemalte Risten erinnerten,
um so mehr einer Arbeit aus Blech glichen, als sie
mit einer metallisch glänzenden politur versehen wurden.
Außerdem wurde oie verwendung metallischer Ginlagen
aus Messing oder Zinn, sowie von Auflagen aus ver-
goldeter Bronze beliebt, welchc oft einen beträchtlichen
Naum einnahmen und die farbige Mirkung der Möbel