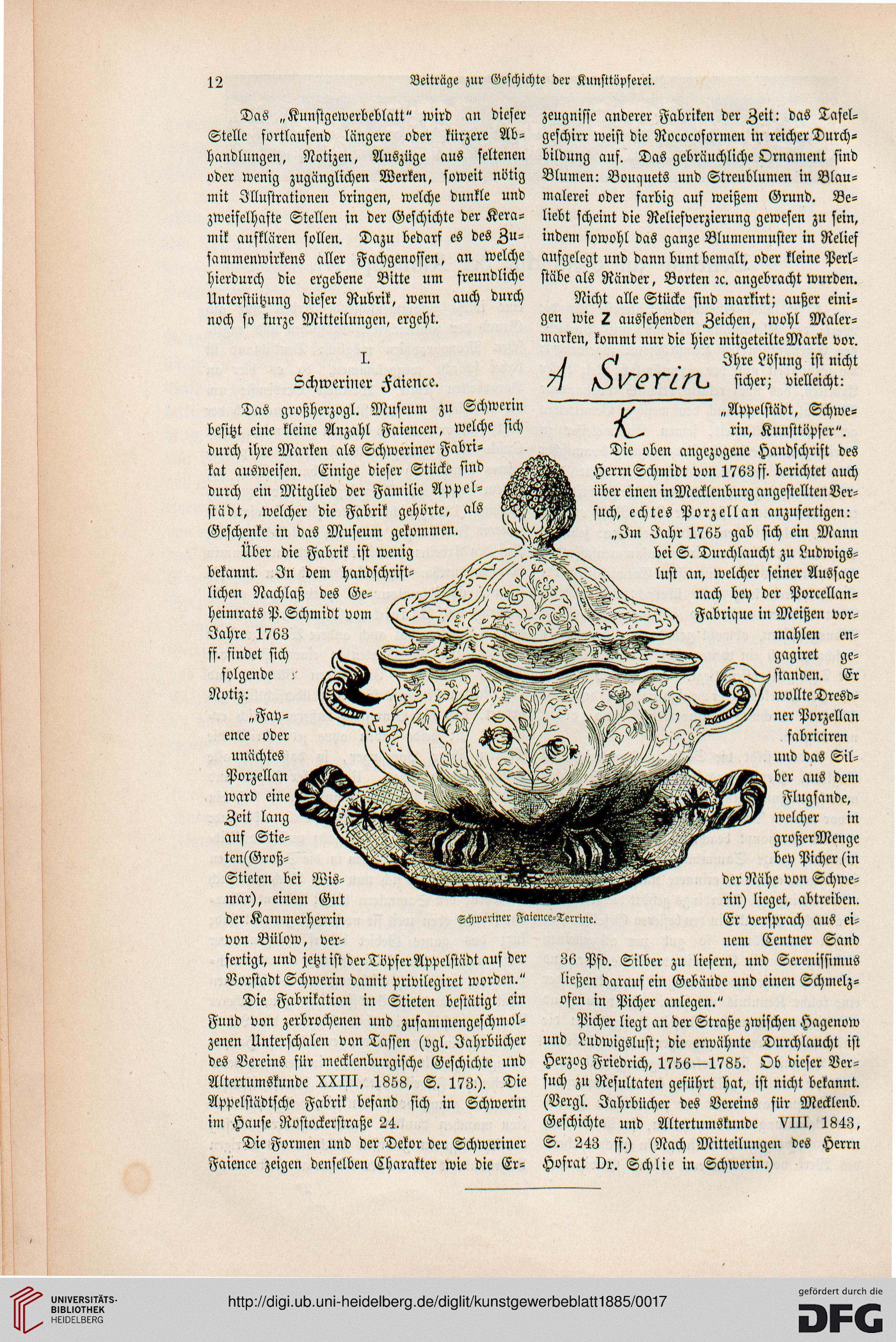12
Beiträgo zur Geschichte der Kunsttöpferei.
Das „Kunstgewerbeblatt" tvird an dieser
Stelle fortlauscnd längere odcr kiirzere Ab-
handlungen, Notizen, Auszüge aus scltcnen
vder wcnig zuganglichen Werken, svweit nbtig
mit Jllustrationen bringen, welche dunkle und
zweifelhafte Stellen in der Geschichte der Kera-
mik ausklären sollen. Dazu bedarf es des Zu-
sammenwirkens aller Fachgenossen, an welche
hierdurch die ergebene Bitte nm freundliche
Untcrstiitznng dieser Rubrik, wcnn auch durch
nvch sv kurzc Mitteilungc», crgcht.
I.
Schweriner Faience.
Das grvßherzogl. Museum zu Schwerin
besitzt eine kleine Anzahl Faiencen, wclche sich
durch ihre Marken als Schwcriner Fabri-
kat ausweisen. Einige dieser Stücke sind
durch ein Mitglicd der Familie Appel-
städt, welcher die Fabrik gehbrte, als
Geschenkc in das Museum gekommen.
Über die Fabrik ist wenig
bekannt. Jn dein handschrift-
lichen Nachlaß des Ge-
heimrats P.Schmidt vom
Jahre 1763
ff. sindet sich
folgcnde
Nvtiz:
„Fay-
ence oder
unächtes
Pvrzellan
ward eine
Zeit lang
auf Stie-
tensGroß-
Stietcn bci Wis-
mar), einem Gut
der Kammerhcrrin
von Bülow, ver-
fertigt, und jetzt ist derTbPserAppclstädt aus dcr
Vvrstadt Schwerin damit privilegiret worden."
Dic Fabrikation in Stietcn bestätigt cin
Fnnd von zerbrochenen und zusammcngeschmvl-
zencn Unterschalen von Tassen (vgl. Jahrbücher
des Vereins für mccklenburgische Geschichte und
Altertumskundc XXIII, 1858, S. 173.). Die
Appelstädtsche Fabrik befand sich in Schwerin
im Hause Rvstvckerstraße 24.
Die Fvrmen und der Dekor dcr Schweriner
Faienee zeigen denselben Charakter wie die Er-
Schwcriner Faicnce-Terrine.
zeugnisse anderer Fabriken der Zeit: das Tafel-
geschirr weist die Rveocvformen in reicherDurch-
bildung auf. Das gcbräuchliche Ornamcnt sind
Blumen: Bonguets und Streublumen in Blau-
malerei oder farbig auf weißem Grund. Be-
liebt scheint die Reliesverzierung gewesen zu sein,
indeni sowohl das ganze Blumenmustcr in Relief
aufgelegt und dann bunt bemalt, oder kleine Perl-
stäbe als Ränder, Borten rc. angebracht wurden.
Nicht alle Stücke sind markirt; außer eini-
gen wie 2 aussehenden Zeichen, wohl Maler-
marken, kvmmt nur die hicr mitgeteilteMarke vor.
/ Jhre Lbsung ist nicht
sich-r; vielleicht:
„Appelstädt, Schwe-
rin, Kunsttöpfer".
Die oben angezogene Handschrist des
HerrnSchmidt von 1763 ff. berichtet anch
iiber cincn inMecklenburgangestelltenVcr-
such, echtes Porzellan anzufertigen:
„Jin Jahr 1765 gab sich ein Mann
bei S. Dnrchlaucht zu Ludwigs-
lust an, welcher seincr Aussage
nach bey der Porccllan-
Fabrigue in Meißen vor-
mahlen en-
gagiret ge-
standen. Er
wollteDresd-
ner Porzellan
fabriciren
und das Sil-
ber aus dem
Flugsande,
welcher in
grvßerMenge
bey Picher (in
der Nähe von Schwe-
rin) lieget, abtrciben.
Er versprach aus ci-
nem Centner Sand
36 Pfd. Silber zu liefern, und Serenissimus
licßen darauf ein Gebände und eincu Schmelz-
ofen in Pjcher anlegen."
Picher liegt an der Straße zwischen Hagenow
und Ludwigslust; die erwähnte Durchlaucht ist
Herzog Friedrich, 1756—1785. Ob dicser Ver-
such zu Resultatcn geführt hat, ist nicht bekannt.
(Vergl. Jahrbüchcr des Vereins für Mccklenb.
Geschichte und Altcrtumskunde VIII, 1843,
S. 243 ff.) (Nach Mitteilungen dcs Herrn
Hofrat 1)r. Schlie in Schwerin.)
Beiträgo zur Geschichte der Kunsttöpferei.
Das „Kunstgewerbeblatt" tvird an dieser
Stelle fortlauscnd längere odcr kiirzere Ab-
handlungen, Notizen, Auszüge aus scltcnen
vder wcnig zuganglichen Werken, svweit nbtig
mit Jllustrationen bringen, welche dunkle und
zweifelhafte Stellen in der Geschichte der Kera-
mik ausklären sollen. Dazu bedarf es des Zu-
sammenwirkens aller Fachgenossen, an welche
hierdurch die ergebene Bitte nm freundliche
Untcrstiitznng dieser Rubrik, wcnn auch durch
nvch sv kurzc Mitteilungc», crgcht.
I.
Schweriner Faience.
Das grvßherzogl. Museum zu Schwerin
besitzt eine kleine Anzahl Faiencen, wclche sich
durch ihre Marken als Schwcriner Fabri-
kat ausweisen. Einige dieser Stücke sind
durch ein Mitglicd der Familie Appel-
städt, welcher die Fabrik gehbrte, als
Geschenkc in das Museum gekommen.
Über die Fabrik ist wenig
bekannt. Jn dein handschrift-
lichen Nachlaß des Ge-
heimrats P.Schmidt vom
Jahre 1763
ff. sindet sich
folgcnde
Nvtiz:
„Fay-
ence oder
unächtes
Pvrzellan
ward eine
Zeit lang
auf Stie-
tensGroß-
Stietcn bci Wis-
mar), einem Gut
der Kammerhcrrin
von Bülow, ver-
fertigt, und jetzt ist derTbPserAppclstädt aus dcr
Vvrstadt Schwerin damit privilegiret worden."
Dic Fabrikation in Stietcn bestätigt cin
Fnnd von zerbrochenen und zusammcngeschmvl-
zencn Unterschalen von Tassen (vgl. Jahrbücher
des Vereins für mccklenburgische Geschichte und
Altertumskundc XXIII, 1858, S. 173.). Die
Appelstädtsche Fabrik befand sich in Schwerin
im Hause Rvstvckerstraße 24.
Die Fvrmen und der Dekor dcr Schweriner
Faienee zeigen denselben Charakter wie die Er-
Schwcriner Faicnce-Terrine.
zeugnisse anderer Fabriken der Zeit: das Tafel-
geschirr weist die Rveocvformen in reicherDurch-
bildung auf. Das gcbräuchliche Ornamcnt sind
Blumen: Bonguets und Streublumen in Blau-
malerei oder farbig auf weißem Grund. Be-
liebt scheint die Reliesverzierung gewesen zu sein,
indeni sowohl das ganze Blumenmustcr in Relief
aufgelegt und dann bunt bemalt, oder kleine Perl-
stäbe als Ränder, Borten rc. angebracht wurden.
Nicht alle Stücke sind markirt; außer eini-
gen wie 2 aussehenden Zeichen, wohl Maler-
marken, kvmmt nur die hicr mitgeteilteMarke vor.
/ Jhre Lbsung ist nicht
sich-r; vielleicht:
„Appelstädt, Schwe-
rin, Kunsttöpfer".
Die oben angezogene Handschrist des
HerrnSchmidt von 1763 ff. berichtet anch
iiber cincn inMecklenburgangestelltenVcr-
such, echtes Porzellan anzufertigen:
„Jin Jahr 1765 gab sich ein Mann
bei S. Dnrchlaucht zu Ludwigs-
lust an, welcher seincr Aussage
nach bey der Porccllan-
Fabrigue in Meißen vor-
mahlen en-
gagiret ge-
standen. Er
wollteDresd-
ner Porzellan
fabriciren
und das Sil-
ber aus dem
Flugsande,
welcher in
grvßerMenge
bey Picher (in
der Nähe von Schwe-
rin) lieget, abtrciben.
Er versprach aus ci-
nem Centner Sand
36 Pfd. Silber zu liefern, und Serenissimus
licßen darauf ein Gebände und eincu Schmelz-
ofen in Pjcher anlegen."
Picher liegt an der Straße zwischen Hagenow
und Ludwigslust; die erwähnte Durchlaucht ist
Herzog Friedrich, 1756—1785. Ob dicser Ver-
such zu Resultatcn geführt hat, ist nicht bekannt.
(Vergl. Jahrbüchcr des Vereins für Mccklenb.
Geschichte und Altcrtumskunde VIII, 1843,
S. 243 ff.) (Nach Mitteilungen dcs Herrn
Hofrat 1)r. Schlie in Schwerin.)