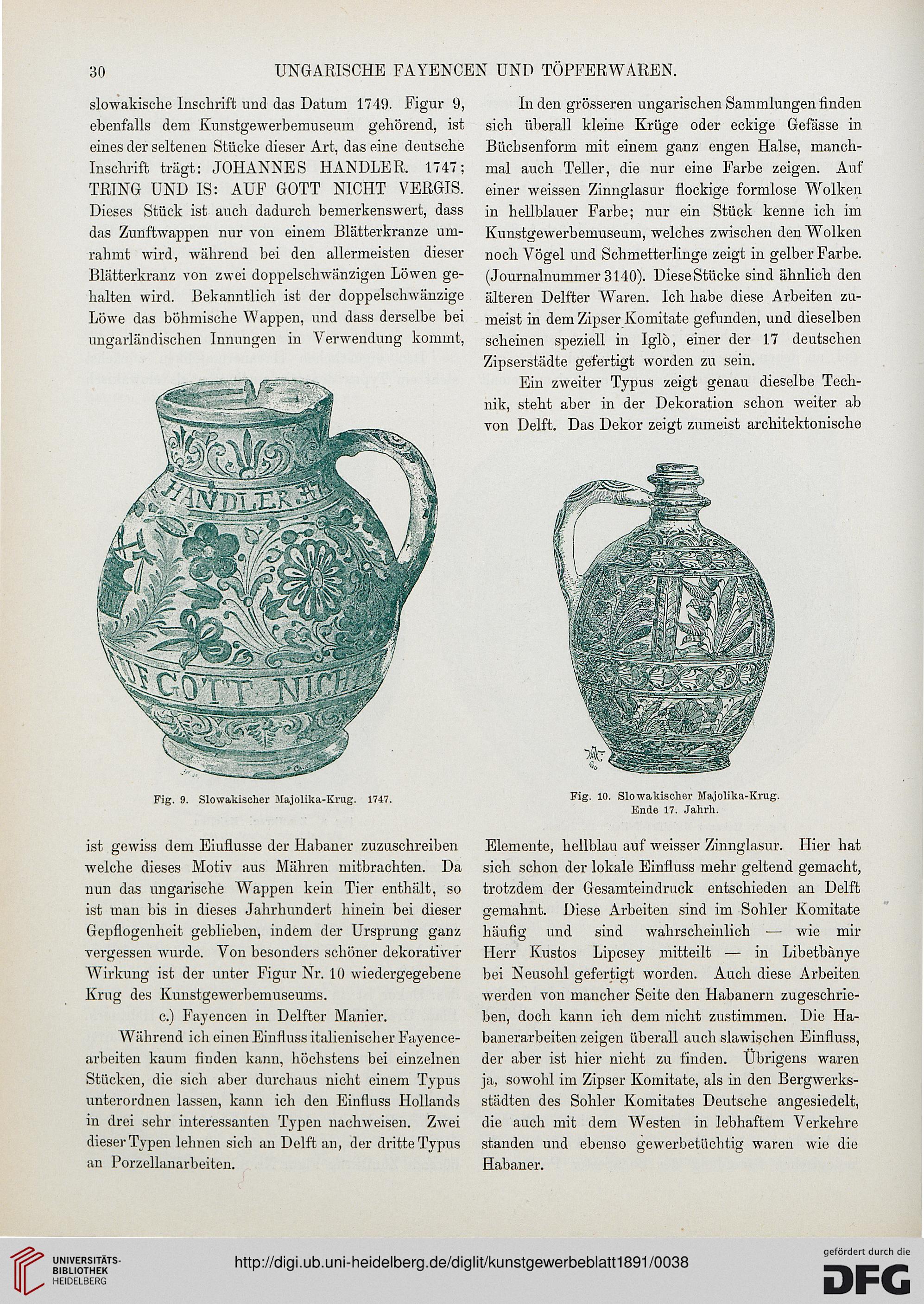30
UNGARISCHE FAYENCEN UND TÖPFERWAREN.
slowakische Inschrift und das Datum 1749. Figur 9,
ebenfalls dem Kunstgewerbemuseum gehörend, ist
eines der seltenen Stücke dieser Art, das eine deutsche
Inschrift trägt: JOHANNES HANDLER. 1747;
TRING UND IS: AUF GOTT NICHT VERGIS.
Dieses Stück ist auch dadurch bemerkenswert, dass
das Zunftwappen nur von einem Blätterkranze um-
rahmt wird, während bei den allermeisten dieser
Blätterkranz von zwei doppelschwänzigen Löwen ge-
halten wird. Bekanntlich ist der doppelschwänzige
Löwe das böhmische Wappen, und dass derselbe bei
unsrarländischen Innungen in Verwendung kommt,
In den grösseren ungarischen Sammlungen finden
sich überall kleine Krüge oder eckige Gefässe in
Bücbsenform mit einem ganz engen Halse, manch-
mal auch Teller, die nur eine Farbe zeigen. Auf
einer weissen Zinnglasur flockige formlose Wolken
in hellblauer Farbe; nur ein Stück kenne ich im
Kunstgewerbemuseum, welches zwischen den Wolken
noch Vögel und Schmetterlinge zeigt in gelber Farbe.
(Journalnummer 3140). DieseStücke sind ähnlich den
älteren Delfter Waren. Ich habe diese Arbeiten zu-
meist in dem Zipser Komitate gefunden, und dieselben
scheinen speziell in Iglö, einer der 17 deutschen
Zipserstädte gefertigt worden zu sein.
Ein zweiter Typus zeigt genau dieselbe Tech-
nik, steht aber in der Dekoration schon weiter ab
von Delft. Das Dekor zeigt zumeist architektonische
Fig. 9. Slowakischer Majolika-Krug. 1747.
Fig. 10. Slowakischer Majolika-Krug.
Ende 17. Jahrh.
ist gewiss dem Eiuflusse der Habaner zuzuschreiben
welche dieses Motiv aus Mähren mitbrachten. Da
nun das ungarische Wappen kein Tier enthält, so
ist man bis in dieses Jahrhundert hinein bei dieser
Gepflogenheit geblieben, indem der Ursprung ganz
vergessen wurde. Von besonders schöner dekorativer
Wirkung ist der unter Figur Nr. 10 wiedergegebene
Krug des Kunstgewerbemuseums.
c.) Fayencen in Delfter Manier.
vVahrend ich einen Einfluss italienischer Fayence-
arbeiten kaum finden kann, höchstens bei einzelnen
Stücken, die sich aber durchaus nicht einem Typus
unterordnen lassen, kann ich den Einfluss Hollands
in drei sehr interessanten Typen nachweisen. Zwei
dieser Typen lehnen sich an Delft an, der dritte Typus
an Porzellanarbeiten.
Elemente, hellblau auf weisser Zinnglasur. Hier hat
sich schon der lokale Einfluss mehr geltend gemacht,
trotzdem der Gesamteindruck entschieden an Delft
gemahnt. Diese Arbeiten sind im Sohler Komitate
häufig und sind wahrscheinlich ■— wie mir
Herr Kustos Lipcsey mitteilt — in Libetbänye
bei Neusohl gefertigt worden. Auch diese Arbeiten
werden von mancher Seite den Habanern zugeschrie-
ben, doch kann ich dem nicht zustimmen. Die Ha-
banerarbeiten zeigen überall auch slawischen Einfluss,
der aber ist hier nicht zu finden. Übrigens waren
ja, sowohl im Zipser Komitate, als in den Bergwerks-
städten des Sohler Komitates Deutsche angesiedelt,
die auch mit dem Westen in lebhaftem Verkehre
standen und ebenso gewerbetüchtig waren wie die
Habaner.
UNGARISCHE FAYENCEN UND TÖPFERWAREN.
slowakische Inschrift und das Datum 1749. Figur 9,
ebenfalls dem Kunstgewerbemuseum gehörend, ist
eines der seltenen Stücke dieser Art, das eine deutsche
Inschrift trägt: JOHANNES HANDLER. 1747;
TRING UND IS: AUF GOTT NICHT VERGIS.
Dieses Stück ist auch dadurch bemerkenswert, dass
das Zunftwappen nur von einem Blätterkranze um-
rahmt wird, während bei den allermeisten dieser
Blätterkranz von zwei doppelschwänzigen Löwen ge-
halten wird. Bekanntlich ist der doppelschwänzige
Löwe das böhmische Wappen, und dass derselbe bei
unsrarländischen Innungen in Verwendung kommt,
In den grösseren ungarischen Sammlungen finden
sich überall kleine Krüge oder eckige Gefässe in
Bücbsenform mit einem ganz engen Halse, manch-
mal auch Teller, die nur eine Farbe zeigen. Auf
einer weissen Zinnglasur flockige formlose Wolken
in hellblauer Farbe; nur ein Stück kenne ich im
Kunstgewerbemuseum, welches zwischen den Wolken
noch Vögel und Schmetterlinge zeigt in gelber Farbe.
(Journalnummer 3140). DieseStücke sind ähnlich den
älteren Delfter Waren. Ich habe diese Arbeiten zu-
meist in dem Zipser Komitate gefunden, und dieselben
scheinen speziell in Iglö, einer der 17 deutschen
Zipserstädte gefertigt worden zu sein.
Ein zweiter Typus zeigt genau dieselbe Tech-
nik, steht aber in der Dekoration schon weiter ab
von Delft. Das Dekor zeigt zumeist architektonische
Fig. 9. Slowakischer Majolika-Krug. 1747.
Fig. 10. Slowakischer Majolika-Krug.
Ende 17. Jahrh.
ist gewiss dem Eiuflusse der Habaner zuzuschreiben
welche dieses Motiv aus Mähren mitbrachten. Da
nun das ungarische Wappen kein Tier enthält, so
ist man bis in dieses Jahrhundert hinein bei dieser
Gepflogenheit geblieben, indem der Ursprung ganz
vergessen wurde. Von besonders schöner dekorativer
Wirkung ist der unter Figur Nr. 10 wiedergegebene
Krug des Kunstgewerbemuseums.
c.) Fayencen in Delfter Manier.
vVahrend ich einen Einfluss italienischer Fayence-
arbeiten kaum finden kann, höchstens bei einzelnen
Stücken, die sich aber durchaus nicht einem Typus
unterordnen lassen, kann ich den Einfluss Hollands
in drei sehr interessanten Typen nachweisen. Zwei
dieser Typen lehnen sich an Delft an, der dritte Typus
an Porzellanarbeiten.
Elemente, hellblau auf weisser Zinnglasur. Hier hat
sich schon der lokale Einfluss mehr geltend gemacht,
trotzdem der Gesamteindruck entschieden an Delft
gemahnt. Diese Arbeiten sind im Sohler Komitate
häufig und sind wahrscheinlich ■— wie mir
Herr Kustos Lipcsey mitteilt — in Libetbänye
bei Neusohl gefertigt worden. Auch diese Arbeiten
werden von mancher Seite den Habanern zugeschrie-
ben, doch kann ich dem nicht zustimmen. Die Ha-
banerarbeiten zeigen überall auch slawischen Einfluss,
der aber ist hier nicht zu finden. Übrigens waren
ja, sowohl im Zipser Komitate, als in den Bergwerks-
städten des Sohler Komitates Deutsche angesiedelt,
die auch mit dem Westen in lebhaftem Verkehre
standen und ebenso gewerbetüchtig waren wie die
Habaner.