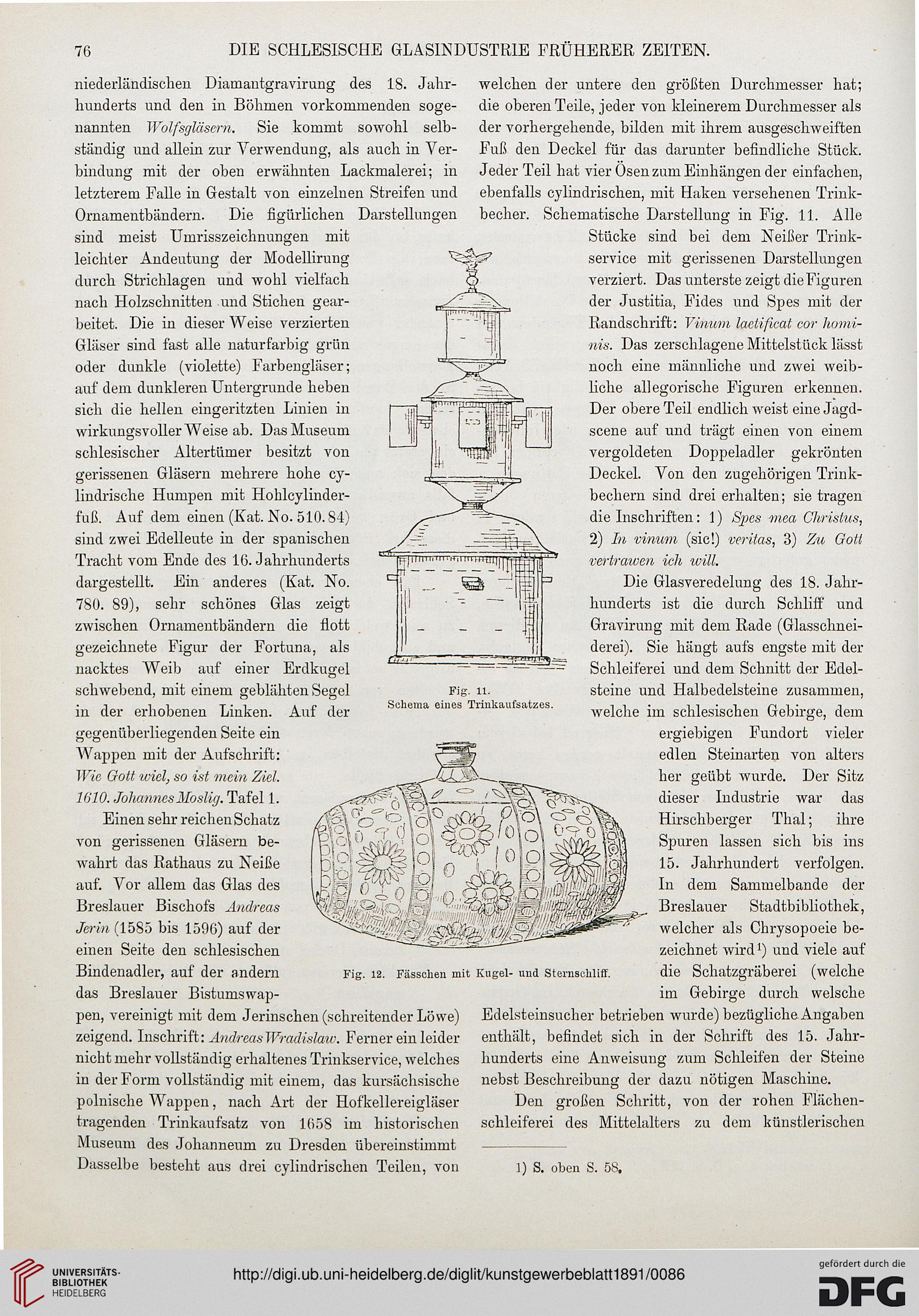76
DIE SCHLESISCHE GLASINDUSTRIE FRÜHERER ZEITEN.
niederländischen Diamantgravirung des 18. Jahr-
hunderts und den in Böhmen vorkommenden soge-
nannten Wolfsgläsern. Sie kommt sowohl selb-
ständig und allein zur Verwendung, als auch in Ver-
bindung mit der oben erwähnten Lackmalerei; in
letzterem Falle in Gestalt von einzelnen Streifen und
Ornamentbändern. Die figürlichen Darstellungen
sind meist Umrisszeichnungen mit
leichter Andeutung der Modellirung
durch Strichlagen und wohl vielfach
nach Holzschnitten und Stichen gear-
beitet. Die in dieser Weise verzierten
Gläser sind fast alle naturfarbig grün
oder dunkle (violette) Farbengläser;
auf dem dunkleren Untergrunde heben
sich die hellen eingeritzten Linien in
wirkungsvoller Weise ab. Das Museum
schlesischer Altertümer besitzt von
gerissenen Gläsern mehrere hohe cy-
lindrische Humpen mit Hoblcylinder-
fuß. Auf dem einen (Kai No. 510.84)
sind zwei Edelleute in der spanischen
Tracht vom Ende des 16. Jahrhunderts
dargestellt. Ein anderes (Kat. No.
780. 89), sehr schönes Glas zeigt
zwischen Ornamentbändern die flott
gezeichnete Figur der Fortuna, als
nacktes Weib auf einer Erdkugel
schwebend, mit einem geblähten Segel
in der erhobenen Linken. Auf der
gegenüberliegenden Seite ein
Wappen mit der Aufschrift:
Wie Gott wiel, so ist mein Ziel.
1610. Johannes Moslig. Tafel 1.
Einen sehr reichen Schatz
von gerissenen Gläsern be-
wahrt das Rathaus zu Neiße
auf. Vor allem das Glas des
Breslauer Bischofs Andreas
Jerin (1585 bis 1596) auf der
einen Seite den schlesischen
Bindenadler, auf der andern
das Breslauer Bistumswap-
pen, vereinigt mit dem Jerinschen (schreitender Löwe)
zeigend. Inschrift: ÄndreasWradislaw. Ferner ein leider
nicht mehr vollständig erhaltenes Trinkservice, welches
in der Form vollständig mit einem, das kursächsische
polnische Wappen, nach Art der Hofkellereigläser
tragenden Trinkaufsatz von 1658 im historischen
Museum des Johanneum zu Dresden übereinstimmt
Dasselbe besteht aus drei cylindrischen Teilen, von
Fig. 11.
Schema eines Trinkaufsatzes
Fig. 12. Fässchen mit Kugel- und Sternseliliff.
welchen der untere den größten Durchmesser hat;
die oberen Teile, jeder von kleinerem Durchmesser als
der vorhergehende, bilden mit ihrem ausgeschweiften
Fuß den Deckel für das darunter befindliche Stück.
Jeder Teil hat vier Ösen zum Einhängen der einfachen,
ebenfalls cylindrischen, mit Haken versehenen Trink-
becher. Schematische Darstellung in Fig. 11. Alle
Stücke sind bei dem Neißer Trink-
service mit gerissenen Darstellungen
verziert. Das unterste zeigt die Figuren
der Justitia, Fides und Spes mit der
Randschrift: Vinum laetißcat cor homi-
nis. Das zerschlagene Mittelstück lässt
noch eine männliche und zwei weib-
liche allegorische Figuren erkennen.
Der obere Teil endlich weist eine Jagd-
scene auf und trägt einen von einem
vergoldeten Doppeladler gekrönten
Deckel. Von den zugehörigen Trink-
bechern sind drei erhalten; sie tragen
die Inschriften: 1) Spes mea Christus,
2) In vinum (sie!) veritas, 3) Zu Gott
vertrawen ich will.
Die Glasveredelung des 18. Jahr-
hunderts ist die durch Schliff und
Gravirung mit dem Rade (Glasschnei-
derei). Sie hängt aufs engste mit der
Schleiferei und dem Schnitt der Edel-
steine und Halbedelsteine zusammen,
welche im schlesischen Gebirge, dem
ergiebigen Fundort vieler
edlen Steinarten von alters
her geübt wurde. Der Sitz
dieser Industrie war das
Hirschberger Thal; ihre
Spuren lassen sich bis ins
15. Jahrhundert verfolgen.
In dem Sammelbande der
Breslauer Stadtbibliothek,
welcher als Chrysopoeie be-
zeichnet wirdl) und viele auf
die Schatzgräberei (welche
im Gebirge durch welsche
Edelsteinsucher betrieben wurde) bezügliche Angaben
enthält, befindet sich in der Schrift des 15. Jahr-
hunderts eine Anweisung zum Schleifen der Steine
nebst Beschreibung der dazu nötigen Maschine.
Den großen Schritt, von der rohen Flächen-
schleiferei des Mittelalters zu dem künstlerischen
]) S. oben S. 58.
DIE SCHLESISCHE GLASINDUSTRIE FRÜHERER ZEITEN.
niederländischen Diamantgravirung des 18. Jahr-
hunderts und den in Böhmen vorkommenden soge-
nannten Wolfsgläsern. Sie kommt sowohl selb-
ständig und allein zur Verwendung, als auch in Ver-
bindung mit der oben erwähnten Lackmalerei; in
letzterem Falle in Gestalt von einzelnen Streifen und
Ornamentbändern. Die figürlichen Darstellungen
sind meist Umrisszeichnungen mit
leichter Andeutung der Modellirung
durch Strichlagen und wohl vielfach
nach Holzschnitten und Stichen gear-
beitet. Die in dieser Weise verzierten
Gläser sind fast alle naturfarbig grün
oder dunkle (violette) Farbengläser;
auf dem dunkleren Untergrunde heben
sich die hellen eingeritzten Linien in
wirkungsvoller Weise ab. Das Museum
schlesischer Altertümer besitzt von
gerissenen Gläsern mehrere hohe cy-
lindrische Humpen mit Hoblcylinder-
fuß. Auf dem einen (Kai No. 510.84)
sind zwei Edelleute in der spanischen
Tracht vom Ende des 16. Jahrhunderts
dargestellt. Ein anderes (Kat. No.
780. 89), sehr schönes Glas zeigt
zwischen Ornamentbändern die flott
gezeichnete Figur der Fortuna, als
nacktes Weib auf einer Erdkugel
schwebend, mit einem geblähten Segel
in der erhobenen Linken. Auf der
gegenüberliegenden Seite ein
Wappen mit der Aufschrift:
Wie Gott wiel, so ist mein Ziel.
1610. Johannes Moslig. Tafel 1.
Einen sehr reichen Schatz
von gerissenen Gläsern be-
wahrt das Rathaus zu Neiße
auf. Vor allem das Glas des
Breslauer Bischofs Andreas
Jerin (1585 bis 1596) auf der
einen Seite den schlesischen
Bindenadler, auf der andern
das Breslauer Bistumswap-
pen, vereinigt mit dem Jerinschen (schreitender Löwe)
zeigend. Inschrift: ÄndreasWradislaw. Ferner ein leider
nicht mehr vollständig erhaltenes Trinkservice, welches
in der Form vollständig mit einem, das kursächsische
polnische Wappen, nach Art der Hofkellereigläser
tragenden Trinkaufsatz von 1658 im historischen
Museum des Johanneum zu Dresden übereinstimmt
Dasselbe besteht aus drei cylindrischen Teilen, von
Fig. 11.
Schema eines Trinkaufsatzes
Fig. 12. Fässchen mit Kugel- und Sternseliliff.
welchen der untere den größten Durchmesser hat;
die oberen Teile, jeder von kleinerem Durchmesser als
der vorhergehende, bilden mit ihrem ausgeschweiften
Fuß den Deckel für das darunter befindliche Stück.
Jeder Teil hat vier Ösen zum Einhängen der einfachen,
ebenfalls cylindrischen, mit Haken versehenen Trink-
becher. Schematische Darstellung in Fig. 11. Alle
Stücke sind bei dem Neißer Trink-
service mit gerissenen Darstellungen
verziert. Das unterste zeigt die Figuren
der Justitia, Fides und Spes mit der
Randschrift: Vinum laetißcat cor homi-
nis. Das zerschlagene Mittelstück lässt
noch eine männliche und zwei weib-
liche allegorische Figuren erkennen.
Der obere Teil endlich weist eine Jagd-
scene auf und trägt einen von einem
vergoldeten Doppeladler gekrönten
Deckel. Von den zugehörigen Trink-
bechern sind drei erhalten; sie tragen
die Inschriften: 1) Spes mea Christus,
2) In vinum (sie!) veritas, 3) Zu Gott
vertrawen ich will.
Die Glasveredelung des 18. Jahr-
hunderts ist die durch Schliff und
Gravirung mit dem Rade (Glasschnei-
derei). Sie hängt aufs engste mit der
Schleiferei und dem Schnitt der Edel-
steine und Halbedelsteine zusammen,
welche im schlesischen Gebirge, dem
ergiebigen Fundort vieler
edlen Steinarten von alters
her geübt wurde. Der Sitz
dieser Industrie war das
Hirschberger Thal; ihre
Spuren lassen sich bis ins
15. Jahrhundert verfolgen.
In dem Sammelbande der
Breslauer Stadtbibliothek,
welcher als Chrysopoeie be-
zeichnet wirdl) und viele auf
die Schatzgräberei (welche
im Gebirge durch welsche
Edelsteinsucher betrieben wurde) bezügliche Angaben
enthält, befindet sich in der Schrift des 15. Jahr-
hunderts eine Anweisung zum Schleifen der Steine
nebst Beschreibung der dazu nötigen Maschine.
Den großen Schritt, von der rohen Flächen-
schleiferei des Mittelalters zu dem künstlerischen
]) S. oben S. 58.