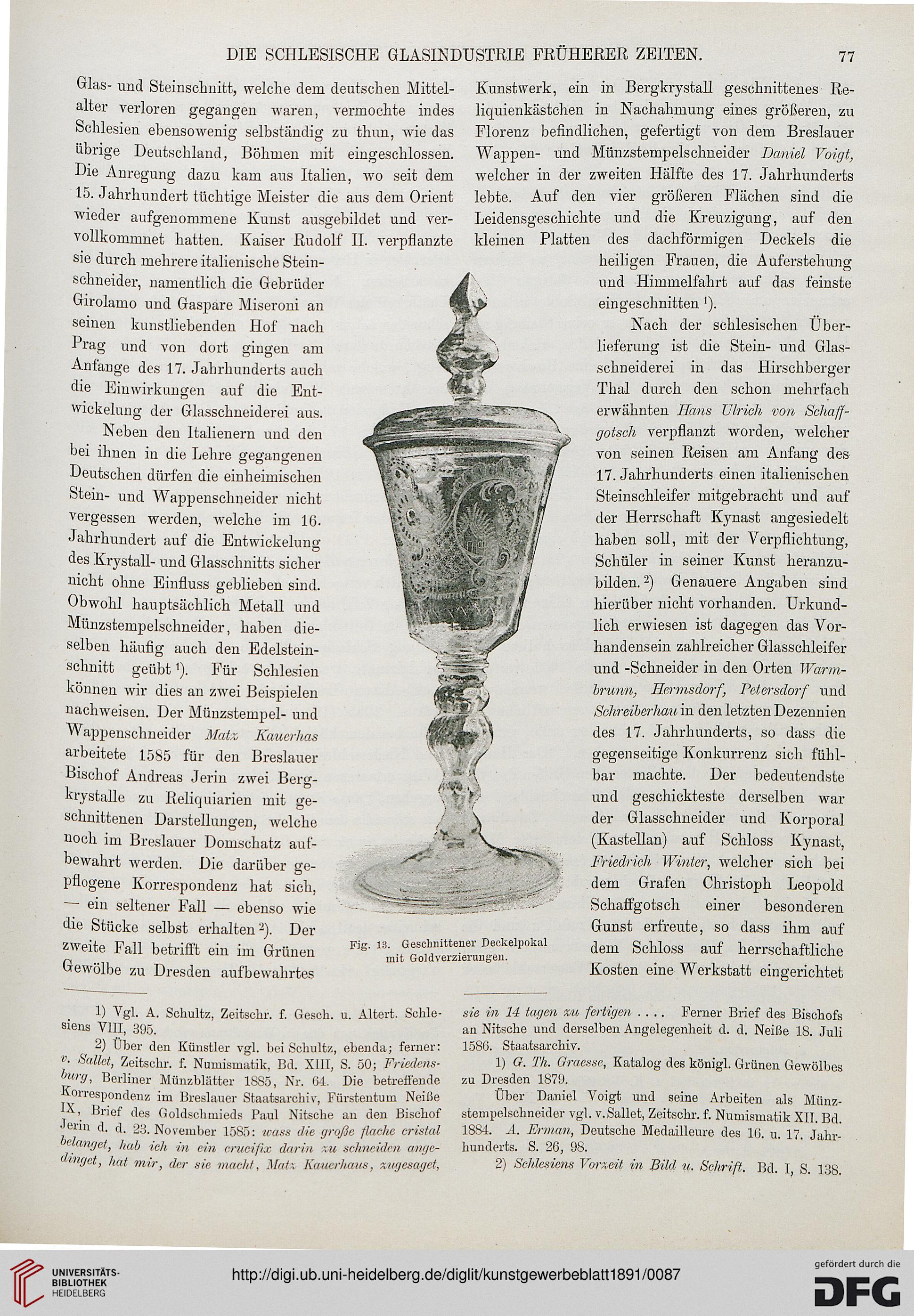DIE SCHLESISCHE GLASINDUSTRIE FRÜHERER ZEITEN.
77
Glas- und Steinschnitt, welche dem deutschen Mittel-
alter verloren gegangen waren, vermochte indes
Schlesien ebensowenig selbständig zu thun, wie das
übrige Deutschland, Böhmen mit eingeschlossen.
Die Anregung dazu kam aus Italien, wo seit dem
15. Jahrhundert tüchtige Meister die aus dem Orient
wieder aufgenommene Kunst ausgebildet und ver-
vollkommnet hatten. Kaiser Rudolf IL verpflanzte
sie durch mehrere italienische Stein-
schneider, namentlich die Gebrüder
Girolamo und Gaspare Miseroni an
seinen kunstliebenden Hof nach
"rag und von dort gingen am
Anfange des 17. Jahrhunderts auch
die Einwirkungen auf die Ent-
wickelung der Glasschneiderei aus.
Neben den Italienern und den
bei ihnen in die Lehre gegangenen
Deutschen dürfen die einheimischen
Stein- und Wappenschneider nicht
vergessen werden, welche im 16.
Jahrhundert auf die Entwickelung
des Krystall- und Glasschnitts sicher
nicht ohne Einfluss geblieben sind.
Obwohl hauptsächlich Metall und
Münzstempelschneider, haben die-
selben häufig auch den Edelstein-
schnitt geübt1). Für Schlesien
können wir dies an zwei Beispielen
nachweisen. Der Münzstempel- und
Wappenschneider Matz Kaucrhas
arbeitete 1585 für den Breslauer
Bischof Andreas Jerin zwei Berg-
krystulle zu Reliquiarien mit ge-
schnittenen Darstellungen, welche
noch im Breslauer Domschatz auf-
bewahrt werden. Die darüber ge-
pflogene Korrespondenz hat sich,
— ein seltener Fall — ebenso wie
die Stücke selbst erhalten'2). Der
zweite Fall betrifft ein im Grünen
Gewölbe zu Dresden aufbewahrtes
Fig. 13. Geschnittener Deckelpokul
mit Goldverzierungen.
Kunstwerk, ein in Bergkrystall geschnittenes Re-
licmienkästchen in Nachahmung eines größeren, zu
Florenz befindlichen, gefertigt von dem Breslauer
Wappen- und Münzstempelschneider Daniel Voigt,
welcher in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
lebte. Auf den vier größeren Flächen sind die
Leidensgeschichte und die Kreuzigung, auf den
kleinen Platten des dachförmigen Deckels die
heiligen Frauen, die Auferstehung
\ und Himmelfahrt auf das feinste
eingeschnitten ').
Nach der schlesischen Über-
lieferung ist die Stein- und Glas-
schneiderei in das Hirschberger
Thal durch den schon mehrfach
erwähnten Hirns Ulrich von Schaff-
gotsch verpflanzt worden, welcher
von seinen Reisen am Anfang des
17. Jahrhunderts einen italienischen
Steinschleifer mitgebracht und auf
der Herrschaft Kvnast angesiedelt
haben soll, mit der Verpflichtung,
Schüler in seiner Kunst heranzu-
bilden. 2) Genauere Angaben sind
hierüber nicht vorhanden. Urkund-
lich erwiesen ist dagegen das Vor-
handensein zahlreicher Glasschleifer
und -Schneider in den Orten Warm-
brunn, Ilcrmsdorf, Petersdorf und
Sehreiberhau in den letzten Dezennien
des 17. Jahrhunderts, so dass die
gegenseitige Konkurrenz sich fühl-
bar machte. Der bedeutendste
und geschickteste derselben war
der Glasschneider und Korporal
(Kastellan) auf Schloss Kynast,
Friedrich Winter, welcher sich bei
dem Grafen Christoph Leopold
Schaffgotsch einer besonderen
Gunst erfreute, so dass ihm auf
dem Schloss auf herrschaftliche
Kosten eine Werkstatt eingerichtet
1) Vgl. A. Schultz, Zeitschr. f. Gesch. u. Altert. Schle-
siens VIII, 395.
2) Über den Künstler vgl. bei Schultz, ebenda; ferner:
*• Sattct, Zeitschr. f. Numismatik, Bd. XIII, S. 50; Friedens-
'""V, Berliner Münzblätter 1885, Nr. 04. Die betreuende
Korrespondenz im Breslauer Staatsarchiv, Fürstentum Neilie
IX, Brief des Goldschmieds Paul Nitsche an den Bischof
erm d. d. 23. November 1585: wass die große fluche er isla!
etangei, //ab ich in ein erudfix darin :u schneiden eiin/e-
dinget, hat mir, der sie macht, Mut: Kauerhaus, xugesaget,
sie in 14 tagen x,u fertigen .... Ferner Brief des Bischofs
an Nitsche und derselben Angelegenheit d. d. Neiße 18. Juli
1580. Staatsarchiv.
1) Cr. Th. Graesse, Katalog des königl. Grünen Gewölbes
zu Dresden 1870.
Ober Daniel Voigt und seine Arbeiten als Münz-
stempelschneider vgl. v.Sallet, Zeitschr. f. Numismatik XII. Bd.
1884. A. Erman, Deutsche Medailleure des 10. u. 17 Jahr-
hunderts. S. 26, 98.
2) Schlesiens Vorzeit in Bild u. Schrift. Bd. I S. 138
77
Glas- und Steinschnitt, welche dem deutschen Mittel-
alter verloren gegangen waren, vermochte indes
Schlesien ebensowenig selbständig zu thun, wie das
übrige Deutschland, Böhmen mit eingeschlossen.
Die Anregung dazu kam aus Italien, wo seit dem
15. Jahrhundert tüchtige Meister die aus dem Orient
wieder aufgenommene Kunst ausgebildet und ver-
vollkommnet hatten. Kaiser Rudolf IL verpflanzte
sie durch mehrere italienische Stein-
schneider, namentlich die Gebrüder
Girolamo und Gaspare Miseroni an
seinen kunstliebenden Hof nach
"rag und von dort gingen am
Anfange des 17. Jahrhunderts auch
die Einwirkungen auf die Ent-
wickelung der Glasschneiderei aus.
Neben den Italienern und den
bei ihnen in die Lehre gegangenen
Deutschen dürfen die einheimischen
Stein- und Wappenschneider nicht
vergessen werden, welche im 16.
Jahrhundert auf die Entwickelung
des Krystall- und Glasschnitts sicher
nicht ohne Einfluss geblieben sind.
Obwohl hauptsächlich Metall und
Münzstempelschneider, haben die-
selben häufig auch den Edelstein-
schnitt geübt1). Für Schlesien
können wir dies an zwei Beispielen
nachweisen. Der Münzstempel- und
Wappenschneider Matz Kaucrhas
arbeitete 1585 für den Breslauer
Bischof Andreas Jerin zwei Berg-
krystulle zu Reliquiarien mit ge-
schnittenen Darstellungen, welche
noch im Breslauer Domschatz auf-
bewahrt werden. Die darüber ge-
pflogene Korrespondenz hat sich,
— ein seltener Fall — ebenso wie
die Stücke selbst erhalten'2). Der
zweite Fall betrifft ein im Grünen
Gewölbe zu Dresden aufbewahrtes
Fig. 13. Geschnittener Deckelpokul
mit Goldverzierungen.
Kunstwerk, ein in Bergkrystall geschnittenes Re-
licmienkästchen in Nachahmung eines größeren, zu
Florenz befindlichen, gefertigt von dem Breslauer
Wappen- und Münzstempelschneider Daniel Voigt,
welcher in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
lebte. Auf den vier größeren Flächen sind die
Leidensgeschichte und die Kreuzigung, auf den
kleinen Platten des dachförmigen Deckels die
heiligen Frauen, die Auferstehung
\ und Himmelfahrt auf das feinste
eingeschnitten ').
Nach der schlesischen Über-
lieferung ist die Stein- und Glas-
schneiderei in das Hirschberger
Thal durch den schon mehrfach
erwähnten Hirns Ulrich von Schaff-
gotsch verpflanzt worden, welcher
von seinen Reisen am Anfang des
17. Jahrhunderts einen italienischen
Steinschleifer mitgebracht und auf
der Herrschaft Kvnast angesiedelt
haben soll, mit der Verpflichtung,
Schüler in seiner Kunst heranzu-
bilden. 2) Genauere Angaben sind
hierüber nicht vorhanden. Urkund-
lich erwiesen ist dagegen das Vor-
handensein zahlreicher Glasschleifer
und -Schneider in den Orten Warm-
brunn, Ilcrmsdorf, Petersdorf und
Sehreiberhau in den letzten Dezennien
des 17. Jahrhunderts, so dass die
gegenseitige Konkurrenz sich fühl-
bar machte. Der bedeutendste
und geschickteste derselben war
der Glasschneider und Korporal
(Kastellan) auf Schloss Kynast,
Friedrich Winter, welcher sich bei
dem Grafen Christoph Leopold
Schaffgotsch einer besonderen
Gunst erfreute, so dass ihm auf
dem Schloss auf herrschaftliche
Kosten eine Werkstatt eingerichtet
1) Vgl. A. Schultz, Zeitschr. f. Gesch. u. Altert. Schle-
siens VIII, 395.
2) Über den Künstler vgl. bei Schultz, ebenda; ferner:
*• Sattct, Zeitschr. f. Numismatik, Bd. XIII, S. 50; Friedens-
'""V, Berliner Münzblätter 1885, Nr. 04. Die betreuende
Korrespondenz im Breslauer Staatsarchiv, Fürstentum Neilie
IX, Brief des Goldschmieds Paul Nitsche an den Bischof
erm d. d. 23. November 1585: wass die große fluche er isla!
etangei, //ab ich in ein erudfix darin :u schneiden eiin/e-
dinget, hat mir, der sie macht, Mut: Kauerhaus, xugesaget,
sie in 14 tagen x,u fertigen .... Ferner Brief des Bischofs
an Nitsche und derselben Angelegenheit d. d. Neiße 18. Juli
1580. Staatsarchiv.
1) Cr. Th. Graesse, Katalog des königl. Grünen Gewölbes
zu Dresden 1870.
Ober Daniel Voigt und seine Arbeiten als Münz-
stempelschneider vgl. v.Sallet, Zeitschr. f. Numismatik XII. Bd.
1884. A. Erman, Deutsche Medailleure des 10. u. 17 Jahr-
hunderts. S. 26, 98.
2) Schlesiens Vorzeit in Bild u. Schrift. Bd. I S. 138