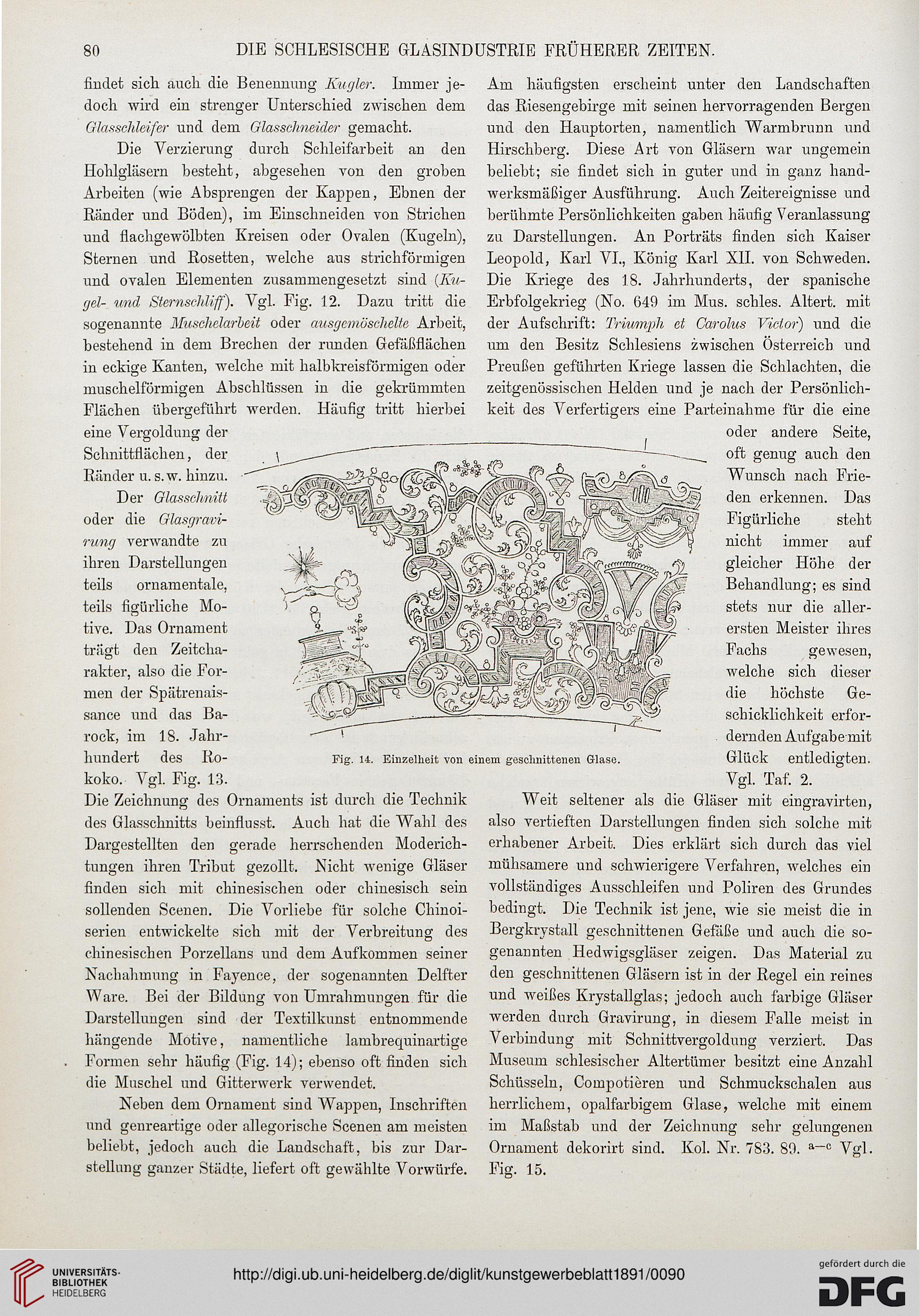80
DIE SCHLESISCHE GLASINDUSTRIE FRÜHERER ZEITEN.
findet sich auch die Benennung Kugler. Immer je-
doch wird ein strenger Unterschied zwischen dem
Glasschleifer und dem Glasschneider gemacht.
Die Verzierung durch Schleifarbeit an den
Hohlgläsern besteht, abgesehen von den groben
Arbeiten (wie Absprengen der Kappen, Ebnen der
Ränder und Böden), im Einschneiden von Strichen
und flachgewölbten Kreisen oder Ovalen (Kugeln),
Sternen und Rosetten, welche aus strichförmigen
und ovalen Elementen zusammengesetzt sind (Ku-
gel- und Sternschliff). Vgl. Fig. 12. Dazu tritt die
sogenannte Muschelarbeit oder ausgemöschelte Arbeit,
bestehend in dem Brechen der runden Gefäßflächen
in eckige Kanten, welche mit halbkreisförmigen oder
muschelförmigen Abschlüssen in die gekrümmten
Flächen übergeführt werden. Häufig tritt hierbei
eine Vergoldung der
. \
Schnittflächen, der
Ränder u. s. w. hinzu.
Der Glasschnitt
oder die Glasgravi-
rung verwandte zu
ihren Darstellungen
teils ornamentale,
teils figürliche Mo-
tive. Das Ornament
trägt den Zeitcha-
rakter, also die For-
men der Spätrenais-
sance und das Ba-
rock, im 18. Jahr-
hundert des Ro-
koko. Vgl. Fig. 13.
Die Zeichnung des Ornaments ist durch die Technik
des Glasschnitts beinflusst. Auch hat die Wahl des
Dargestellten den gerade herrschenden Moderich-
tungen ihren Tribut gezollt. Nicht wenige Gläser
finden sich mit chinesischen oder chinesisch sein
sollenden Scenen. Die Vorliebe für solche Chinoi-
serien entwickelte sich mit der Verbreitung des
chinesischen Porzellans und dem Aufkommen seiner
Nachahmung in Fayence, der sogenannten Delfter
Ware. Bei der Bildung von Umrahmungen für die
Darstellungen sind der Textilkunst entnommende
hängende Motive, namentliche lambrequinartige
Formen sehr häufig (Fig. 14); ebenso oft finden sich
die Muschel und Gitterwerk verwendet.
Neben dem Ornament sind Wappen, Inschriften
und genreartige oder allegorische Scenen am meisten
beliebt, jedoch auch die Landschaft, bis zur Dar-
stellung ganzer Städte, liefert oft gewählte Vorwürfe.
Fig. 14. Einzelheit von einem geschnittenen Glase.
Am häufigsten erscheint unter den Landschaften
das Riesengebirge mit seinen hervorragenden Bergen
und den Hauptorten, namentlich Warmbrunn und
Hirschberg. Diese Art von Gläsern war ungemein
beliebt; sie findet sich in guter und in ganz hand-
werksmäßiger Ausführung. Auch Zeitereignisse und
berühmte Persönlichkeiten gaben häufig Veranlassung
zu Darstellungen. An Porträts finden sich Kaiser
Leopold, Karl VI., König Karl XII. von Schweden.
Die Kriege des 18. Jahrhunderts, der spanische
Erbfolgekrieg (No. 649 im Mus. schles. Altert, mit
der Aufschrift: Triumph et Carolus Victor) und die
um den Besitz Schlesiens zwischen Österreich und
Preußen geführten Kriege lassen die Schlachten, die
zeitgenössischen Helden und je nach der Persönlich-
keit des Verfertigers eine Parteinahme für die eine
oder andere Seite,
oft genug auch den
Wunsch nach Frie-
den erkennen. Das
Figürliche steht
nicht immer auf
gleicher Höhe der
Behandlung; es sind
stets nur die aller-
ersten Meister ihres
Fachs gewesen,
welche sich dieser
die höchste Ge-
schicklichkeit erfor-
dernden Aufgabe mit
Glück entledigten.
Vgl. Taf. 2.
Weit seltener als die Gläser mit eingravirten,
also vertieften Darstellungen finden sich solche mit
erhabener Arbeit. Dies erklärt sich durch das viel
mühsamere und schwierigere Verfahren, welches ein
vollständiges Ausschleifen und Poliren des Grundes
bedingt. Die Technik ist jene, wie sie meist die in
Bergkrystall geschnittenen Gefäße und auch die so-
genannten Hedwigsgläser zeigen. Das Material zu
den geschnittenen Gläsern ist in der Regel ein reines
und weißes Krystallglas; jedoch auch farbige Gläser
werden durch Gravirung, in diesem Falle meist in
Verbindung mit Schnittvergoldung verziert. Das
Museum schlesischer Altertümer besitzt eine Anzahl
Schüsseln, Compotieren und Schmuckschalen aus
herrlichem, opalfarbigein Glase, welche mit einem
im Maßstab und der Zeichnung sehr gelungenen
Ornament dekorirt sind. Kol. Nr. 783. 89. a~c Vgl.
Fig. 15.
DIE SCHLESISCHE GLASINDUSTRIE FRÜHERER ZEITEN.
findet sich auch die Benennung Kugler. Immer je-
doch wird ein strenger Unterschied zwischen dem
Glasschleifer und dem Glasschneider gemacht.
Die Verzierung durch Schleifarbeit an den
Hohlgläsern besteht, abgesehen von den groben
Arbeiten (wie Absprengen der Kappen, Ebnen der
Ränder und Böden), im Einschneiden von Strichen
und flachgewölbten Kreisen oder Ovalen (Kugeln),
Sternen und Rosetten, welche aus strichförmigen
und ovalen Elementen zusammengesetzt sind (Ku-
gel- und Sternschliff). Vgl. Fig. 12. Dazu tritt die
sogenannte Muschelarbeit oder ausgemöschelte Arbeit,
bestehend in dem Brechen der runden Gefäßflächen
in eckige Kanten, welche mit halbkreisförmigen oder
muschelförmigen Abschlüssen in die gekrümmten
Flächen übergeführt werden. Häufig tritt hierbei
eine Vergoldung der
. \
Schnittflächen, der
Ränder u. s. w. hinzu.
Der Glasschnitt
oder die Glasgravi-
rung verwandte zu
ihren Darstellungen
teils ornamentale,
teils figürliche Mo-
tive. Das Ornament
trägt den Zeitcha-
rakter, also die For-
men der Spätrenais-
sance und das Ba-
rock, im 18. Jahr-
hundert des Ro-
koko. Vgl. Fig. 13.
Die Zeichnung des Ornaments ist durch die Technik
des Glasschnitts beinflusst. Auch hat die Wahl des
Dargestellten den gerade herrschenden Moderich-
tungen ihren Tribut gezollt. Nicht wenige Gläser
finden sich mit chinesischen oder chinesisch sein
sollenden Scenen. Die Vorliebe für solche Chinoi-
serien entwickelte sich mit der Verbreitung des
chinesischen Porzellans und dem Aufkommen seiner
Nachahmung in Fayence, der sogenannten Delfter
Ware. Bei der Bildung von Umrahmungen für die
Darstellungen sind der Textilkunst entnommende
hängende Motive, namentliche lambrequinartige
Formen sehr häufig (Fig. 14); ebenso oft finden sich
die Muschel und Gitterwerk verwendet.
Neben dem Ornament sind Wappen, Inschriften
und genreartige oder allegorische Scenen am meisten
beliebt, jedoch auch die Landschaft, bis zur Dar-
stellung ganzer Städte, liefert oft gewählte Vorwürfe.
Fig. 14. Einzelheit von einem geschnittenen Glase.
Am häufigsten erscheint unter den Landschaften
das Riesengebirge mit seinen hervorragenden Bergen
und den Hauptorten, namentlich Warmbrunn und
Hirschberg. Diese Art von Gläsern war ungemein
beliebt; sie findet sich in guter und in ganz hand-
werksmäßiger Ausführung. Auch Zeitereignisse und
berühmte Persönlichkeiten gaben häufig Veranlassung
zu Darstellungen. An Porträts finden sich Kaiser
Leopold, Karl VI., König Karl XII. von Schweden.
Die Kriege des 18. Jahrhunderts, der spanische
Erbfolgekrieg (No. 649 im Mus. schles. Altert, mit
der Aufschrift: Triumph et Carolus Victor) und die
um den Besitz Schlesiens zwischen Österreich und
Preußen geführten Kriege lassen die Schlachten, die
zeitgenössischen Helden und je nach der Persönlich-
keit des Verfertigers eine Parteinahme für die eine
oder andere Seite,
oft genug auch den
Wunsch nach Frie-
den erkennen. Das
Figürliche steht
nicht immer auf
gleicher Höhe der
Behandlung; es sind
stets nur die aller-
ersten Meister ihres
Fachs gewesen,
welche sich dieser
die höchste Ge-
schicklichkeit erfor-
dernden Aufgabe mit
Glück entledigten.
Vgl. Taf. 2.
Weit seltener als die Gläser mit eingravirten,
also vertieften Darstellungen finden sich solche mit
erhabener Arbeit. Dies erklärt sich durch das viel
mühsamere und schwierigere Verfahren, welches ein
vollständiges Ausschleifen und Poliren des Grundes
bedingt. Die Technik ist jene, wie sie meist die in
Bergkrystall geschnittenen Gefäße und auch die so-
genannten Hedwigsgläser zeigen. Das Material zu
den geschnittenen Gläsern ist in der Regel ein reines
und weißes Krystallglas; jedoch auch farbige Gläser
werden durch Gravirung, in diesem Falle meist in
Verbindung mit Schnittvergoldung verziert. Das
Museum schlesischer Altertümer besitzt eine Anzahl
Schüsseln, Compotieren und Schmuckschalen aus
herrlichem, opalfarbigein Glase, welche mit einem
im Maßstab und der Zeichnung sehr gelungenen
Ornament dekorirt sind. Kol. Nr. 783. 89. a~c Vgl.
Fig. 15.