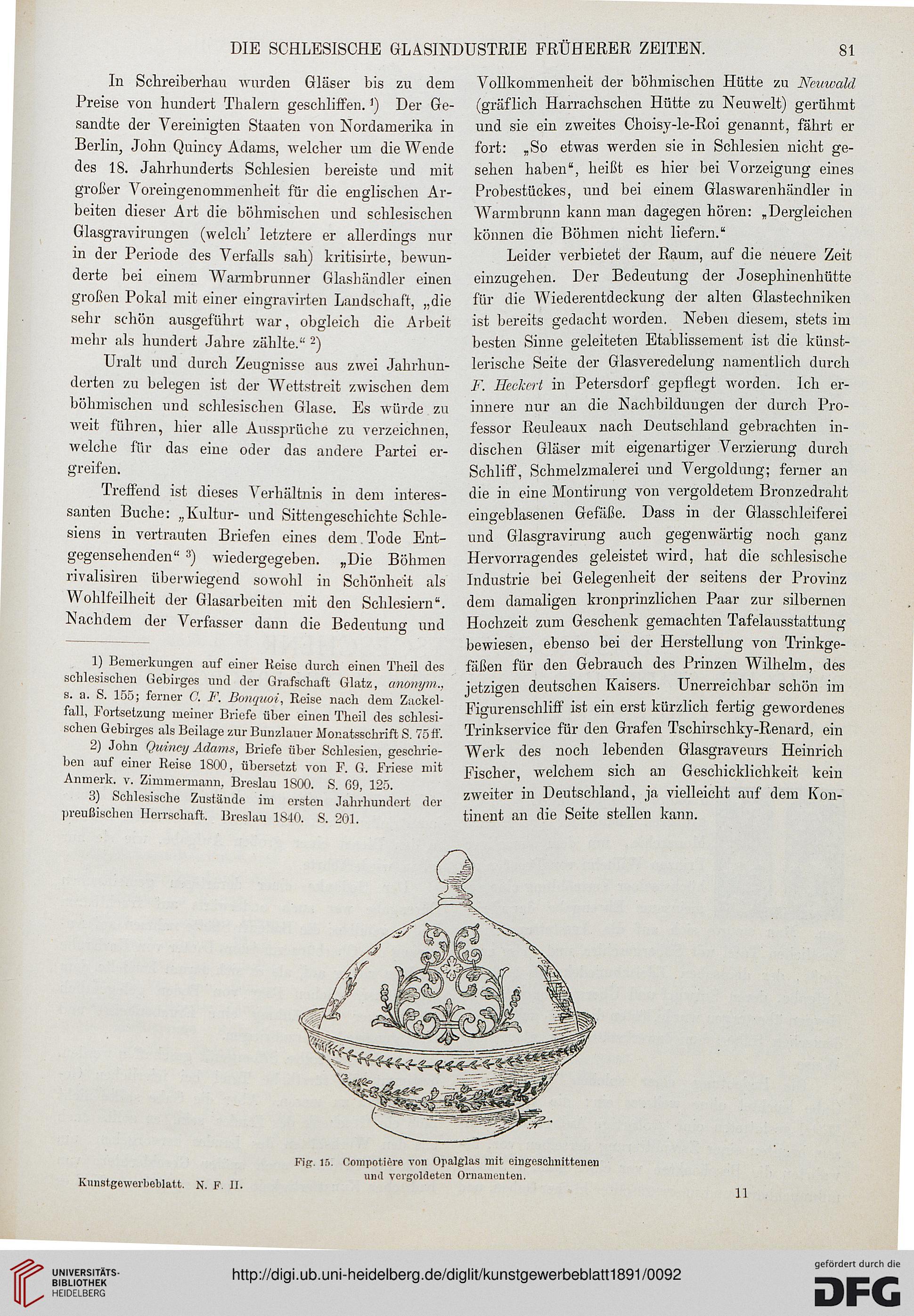DIE SCHLESISCHE GLÄSINDUSTRIE FRÜHERER ZEITEN.
81
In Schreiberhau wurden Gläser bis zu dem
Preise von hundert Thalern geschliffen.]) Der Ge-
sandte der Vereinigten Staaten von Nordamerika in
Berlin, John Quincy Adams, welcher um die Wende
des 18. Jahrhunderts Schlesien bereiste und mit
großer Voreingenommenheit für die englischen Ar-
beiten dieser Art die böhmischen und schlesischen
Glasgravirungen (welch' letztere er allerdings nur
in der Periode des Verfalls sah) kritisirte, bewun-
derte bei einem Warmbrunner Glashändler einen
großen Pokal mit einer eingravirten Landschaft, „die
sehr schön ausgeführt war, obgleich die Arbeit
mehr als hundert Jahre zählte." 2)
Uralt und durch Zeugnisse aus zwei Jahrhun-
derten zu belegen ist der Wettstreit zwischen dem
böhmischen und schlesischen Glase. Es würde zu
weit führen, hier alle Aussprüche zu verzeichnen,
welche für das eine oder das andere Partei er-
greifen.
Treffend ist dieses Verhältnis in dem interes-
santen Buche: „Kultur- und Sittengeschichte Schle-
siens in vertrauten Briefen eines dem.Tode Ent-
gegensehenden" 3) wiedergegeben. „Die Böhmen
rivalisiren überwiegend sowohl in Schönheit als
Wohlfeilheit der Glasarbeiten mit den Schlesiern".
Nachdem der Verfasser dann die Bedeutung und
1) Bemerkungen auf einer Reise durch einen Theil des
schlesischen Gebirges und der Grafschaft Glatz, anonym.,
s. a. S. 155; ferner 0. F. ßoiiquoi, Reise nach dem Zackel-
fall, Fortsetzung meiner Briefe über einen Theil des schlesi-
schen Gebirges als Beilage zur Btwzlauer Monatsschrift S. 75ff.
2) John Quincy Adams, Briefe über Schlesien, geschrie-
ben auf einer Reise 1800, übersetzt von F. G. Friese mit
Anmerk. v. Zimmermann, Breslau 1800. S. G9, 125.
3) Schlesische Zustände im ersten Jahrhundert der
preußischen Herrschaft. Breslau 1840. S. 201.
Vollkommenheit der böhmischen Hütte zu Neuwald
(gräflich Harrachschen Hütte zu Neuwelt) gerühmt
und sie ein zweites Choisy-le-Roi genannt, fährt er
fort: „So etwas werden sie in Schlesien nicht ge-
sehen haben", heißt es hier bei Vorzeigung eines
Probestückes, und bei einem Glaswarenhändler in
Warmbrunn kann man dagegen hören: „Dergleichen
können die Böhmen nicht liefern."
Leider verbietet der Raum, auf die neuere Zeit
einzugehen. Der Bedeutung der Josephinenhütte
für die Wiederentdeckung der alten Glastechniken
ist bereits gedacht worden. Neben diesem, stets im
besten Sinne geleiteten Etablissement ist die künst-
lerische Seite der Glasveredelung namentlich durch
F. Beehrt in Petersdorf gepflegt worden. Ich er-
innere nur an die Nächbildungen der durch Pro-
fessor Reuleaux nach Deutschland gebrachten in-
dischen Gläser mit eigenartiger Verzierung durch
Schliff, Schmelzmalerei und Vergoldung; ferner an
die in eine Montirung von vergoldetem Bronzedraht
eingeblasenen Gefäße. Dass in der Glasschleiferei
und Glasgravirung auch gegenwärtig noch ganz
Hervorragendes geleistet wird, hat die schlesische
Industrie bei Gelegenheit der seitens der Provinz
dem damaligen kronprinzlichen Paar zur silbernen
Hochzeit zum Geschenk gemachten Tafelausstattung
bewiesen, ebenso bei der Herstellung von Trinkge-
fäßen für den Gebrauch des Prinzen Wilhelm, des
jetzigen deutschen Kaisers. Unerreichbar schön im
Figurenschliff ist ein erst kürzlich fertig gewordenes
Trinkservice für den Grafen Tschirschky-Renard, ein
Werk des noch lebenden Glasgraveurs Heinrich
Fischer, welchem sich an Geschicklichkeit kein
zweiter in Deutschland, ja vielleicht auf dem Kon-
tinent an die Seite stellen kann.
Kunstgewerljeblatt. N. F. II.
Fig. ir>. Oompotiere von Opalglas mit eingeschnittenen
und vergoldeten Ornamenten.
11
81
In Schreiberhau wurden Gläser bis zu dem
Preise von hundert Thalern geschliffen.]) Der Ge-
sandte der Vereinigten Staaten von Nordamerika in
Berlin, John Quincy Adams, welcher um die Wende
des 18. Jahrhunderts Schlesien bereiste und mit
großer Voreingenommenheit für die englischen Ar-
beiten dieser Art die böhmischen und schlesischen
Glasgravirungen (welch' letztere er allerdings nur
in der Periode des Verfalls sah) kritisirte, bewun-
derte bei einem Warmbrunner Glashändler einen
großen Pokal mit einer eingravirten Landschaft, „die
sehr schön ausgeführt war, obgleich die Arbeit
mehr als hundert Jahre zählte." 2)
Uralt und durch Zeugnisse aus zwei Jahrhun-
derten zu belegen ist der Wettstreit zwischen dem
böhmischen und schlesischen Glase. Es würde zu
weit führen, hier alle Aussprüche zu verzeichnen,
welche für das eine oder das andere Partei er-
greifen.
Treffend ist dieses Verhältnis in dem interes-
santen Buche: „Kultur- und Sittengeschichte Schle-
siens in vertrauten Briefen eines dem.Tode Ent-
gegensehenden" 3) wiedergegeben. „Die Böhmen
rivalisiren überwiegend sowohl in Schönheit als
Wohlfeilheit der Glasarbeiten mit den Schlesiern".
Nachdem der Verfasser dann die Bedeutung und
1) Bemerkungen auf einer Reise durch einen Theil des
schlesischen Gebirges und der Grafschaft Glatz, anonym.,
s. a. S. 155; ferner 0. F. ßoiiquoi, Reise nach dem Zackel-
fall, Fortsetzung meiner Briefe über einen Theil des schlesi-
schen Gebirges als Beilage zur Btwzlauer Monatsschrift S. 75ff.
2) John Quincy Adams, Briefe über Schlesien, geschrie-
ben auf einer Reise 1800, übersetzt von F. G. Friese mit
Anmerk. v. Zimmermann, Breslau 1800. S. G9, 125.
3) Schlesische Zustände im ersten Jahrhundert der
preußischen Herrschaft. Breslau 1840. S. 201.
Vollkommenheit der böhmischen Hütte zu Neuwald
(gräflich Harrachschen Hütte zu Neuwelt) gerühmt
und sie ein zweites Choisy-le-Roi genannt, fährt er
fort: „So etwas werden sie in Schlesien nicht ge-
sehen haben", heißt es hier bei Vorzeigung eines
Probestückes, und bei einem Glaswarenhändler in
Warmbrunn kann man dagegen hören: „Dergleichen
können die Böhmen nicht liefern."
Leider verbietet der Raum, auf die neuere Zeit
einzugehen. Der Bedeutung der Josephinenhütte
für die Wiederentdeckung der alten Glastechniken
ist bereits gedacht worden. Neben diesem, stets im
besten Sinne geleiteten Etablissement ist die künst-
lerische Seite der Glasveredelung namentlich durch
F. Beehrt in Petersdorf gepflegt worden. Ich er-
innere nur an die Nächbildungen der durch Pro-
fessor Reuleaux nach Deutschland gebrachten in-
dischen Gläser mit eigenartiger Verzierung durch
Schliff, Schmelzmalerei und Vergoldung; ferner an
die in eine Montirung von vergoldetem Bronzedraht
eingeblasenen Gefäße. Dass in der Glasschleiferei
und Glasgravirung auch gegenwärtig noch ganz
Hervorragendes geleistet wird, hat die schlesische
Industrie bei Gelegenheit der seitens der Provinz
dem damaligen kronprinzlichen Paar zur silbernen
Hochzeit zum Geschenk gemachten Tafelausstattung
bewiesen, ebenso bei der Herstellung von Trinkge-
fäßen für den Gebrauch des Prinzen Wilhelm, des
jetzigen deutschen Kaisers. Unerreichbar schön im
Figurenschliff ist ein erst kürzlich fertig gewordenes
Trinkservice für den Grafen Tschirschky-Renard, ein
Werk des noch lebenden Glasgraveurs Heinrich
Fischer, welchem sich an Geschicklichkeit kein
zweiter in Deutschland, ja vielleicht auf dem Kon-
tinent an die Seite stellen kann.
Kunstgewerljeblatt. N. F. II.
Fig. ir>. Oompotiere von Opalglas mit eingeschnittenen
und vergoldeten Ornamenten.
11