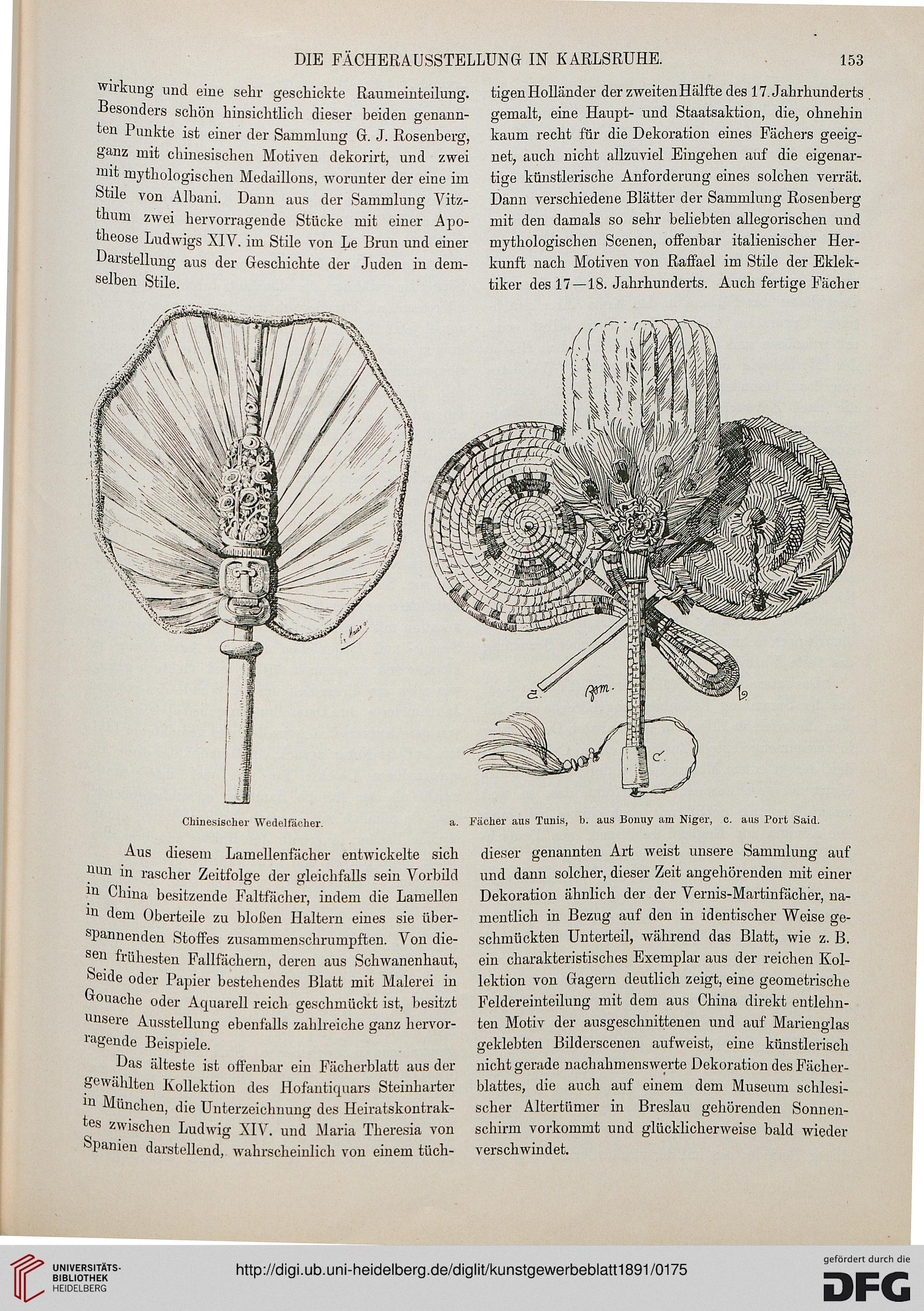DIE FÄCHERAUSSTELLUNG IN KARLSRUHE.
153
Wirkung und eine sehr geschickte Raunieinteilung.
-Besonders schön hinsichtlich dieser beiden genann-
ten Punkte ist einer der Sammlung G. J. Rosenberg,
ganz mit chinesischen Motiven dekorirt, und zwei
mit mythologischen Medaillons, worunter der eine im
Stile von Albani. Dann aus der Sammlung Vitz-
thum zwei hervorragende Stücke mit einer Apo-
theose Ludwigs XIV. im Stile von Le Brun und einer
Darstellung aus der Geschichte der Juden in dem-
selben Stile.
tigen Holländer der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
gemalt, eine Haupt- und Staatsaktion, die, ohnehin
kaum recht für die Dekoration eines Fächers geeig-
net, auch nicht allzuviel Eingehen auf die eigenar-
tige künstlerische Anforderung eines solchen verrät.
Dann verschiedene Blätter der Sammlung Rosenberg
mit den damals so sehr beliebten allegorischen und
mythologischen Scenen, offenbar italienischer Her-
kunft nach Motiven von Raffael im Stile der Eklek-
tiker des 17 —18. Jahrhunderts. Auch fertige Fächer
Chinesischer Wedelfächer. a.
Aus diesem Lamellenfächer entwickelte sich
nun in rascher Zeitfolge der gleichfalls sein Vorbild
m China besitzende Faltfächer, indem die Lamellen
m dem Oberteile zu bloßen Haltern eines sie über-
spannenden Stoffes zusammenschrumpften. Von die-
sen frühesten Fallfächern, deren aus Schwanenhaut,
Seide oder Papier bestehendes Blatt mit Malerei in
Gouache oder Aquarell reich geschmückt ist, besitzt
unsere Ausstellung ebenfalls zahlreiche ganz hervor-
ragende Beispiele.
Das älteste ist offenbar ein Fächerblatt aus der
gewählten Kollektion des Hofantiquars Steinharter
111 München, die Unterzeichnung des Heiratskontrak-
tes zwischen Ludwig XIV. und Maria Theresia von
Timmen darstellend, wahrscheinlich von einem tüch-
Fächer aus Tunis, b. aus Bonuy am Niger, c. aus Tort Said.
dieser genannten Art weist unsere Sammlung auf
und dann solcher, dieser Zeit angehörenden mit einer
Dekoration ähnlich der der Vernis-Martinfächer, na-
mentlich in Bezug auf den in identischer Weise ge-
schmückten Unterteil, während das Blatt, wie z. B.
ein charakteristisches Exemplar aus der reichen Kol-
lektion von Gagern deutlich zeigt, eine geometrische
Feldereinteilung mit dem aus China direkt entlehn-
ten Motiv der ausgeschnittenen und auf Marienglas
geklebten Bilderscencn aufweist, eine künstlerisch
nicht gerade nachahmenswerte Dekoration des Fächer-
blattes, die auch auf einem dem Museum schlesi-
scher Altertümer in Breslau gehörenden Sonnen-
schirm vorkommt und glücklicherweise bald wieder
verschwindet.
153
Wirkung und eine sehr geschickte Raunieinteilung.
-Besonders schön hinsichtlich dieser beiden genann-
ten Punkte ist einer der Sammlung G. J. Rosenberg,
ganz mit chinesischen Motiven dekorirt, und zwei
mit mythologischen Medaillons, worunter der eine im
Stile von Albani. Dann aus der Sammlung Vitz-
thum zwei hervorragende Stücke mit einer Apo-
theose Ludwigs XIV. im Stile von Le Brun und einer
Darstellung aus der Geschichte der Juden in dem-
selben Stile.
tigen Holländer der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
gemalt, eine Haupt- und Staatsaktion, die, ohnehin
kaum recht für die Dekoration eines Fächers geeig-
net, auch nicht allzuviel Eingehen auf die eigenar-
tige künstlerische Anforderung eines solchen verrät.
Dann verschiedene Blätter der Sammlung Rosenberg
mit den damals so sehr beliebten allegorischen und
mythologischen Scenen, offenbar italienischer Her-
kunft nach Motiven von Raffael im Stile der Eklek-
tiker des 17 —18. Jahrhunderts. Auch fertige Fächer
Chinesischer Wedelfächer. a.
Aus diesem Lamellenfächer entwickelte sich
nun in rascher Zeitfolge der gleichfalls sein Vorbild
m China besitzende Faltfächer, indem die Lamellen
m dem Oberteile zu bloßen Haltern eines sie über-
spannenden Stoffes zusammenschrumpften. Von die-
sen frühesten Fallfächern, deren aus Schwanenhaut,
Seide oder Papier bestehendes Blatt mit Malerei in
Gouache oder Aquarell reich geschmückt ist, besitzt
unsere Ausstellung ebenfalls zahlreiche ganz hervor-
ragende Beispiele.
Das älteste ist offenbar ein Fächerblatt aus der
gewählten Kollektion des Hofantiquars Steinharter
111 München, die Unterzeichnung des Heiratskontrak-
tes zwischen Ludwig XIV. und Maria Theresia von
Timmen darstellend, wahrscheinlich von einem tüch-
Fächer aus Tunis, b. aus Bonuy am Niger, c. aus Tort Said.
dieser genannten Art weist unsere Sammlung auf
und dann solcher, dieser Zeit angehörenden mit einer
Dekoration ähnlich der der Vernis-Martinfächer, na-
mentlich in Bezug auf den in identischer Weise ge-
schmückten Unterteil, während das Blatt, wie z. B.
ein charakteristisches Exemplar aus der reichen Kol-
lektion von Gagern deutlich zeigt, eine geometrische
Feldereinteilung mit dem aus China direkt entlehn-
ten Motiv der ausgeschnittenen und auf Marienglas
geklebten Bilderscencn aufweist, eine künstlerisch
nicht gerade nachahmenswerte Dekoration des Fächer-
blattes, die auch auf einem dem Museum schlesi-
scher Altertümer in Breslau gehörenden Sonnen-
schirm vorkommt und glücklicherweise bald wieder
verschwindet.