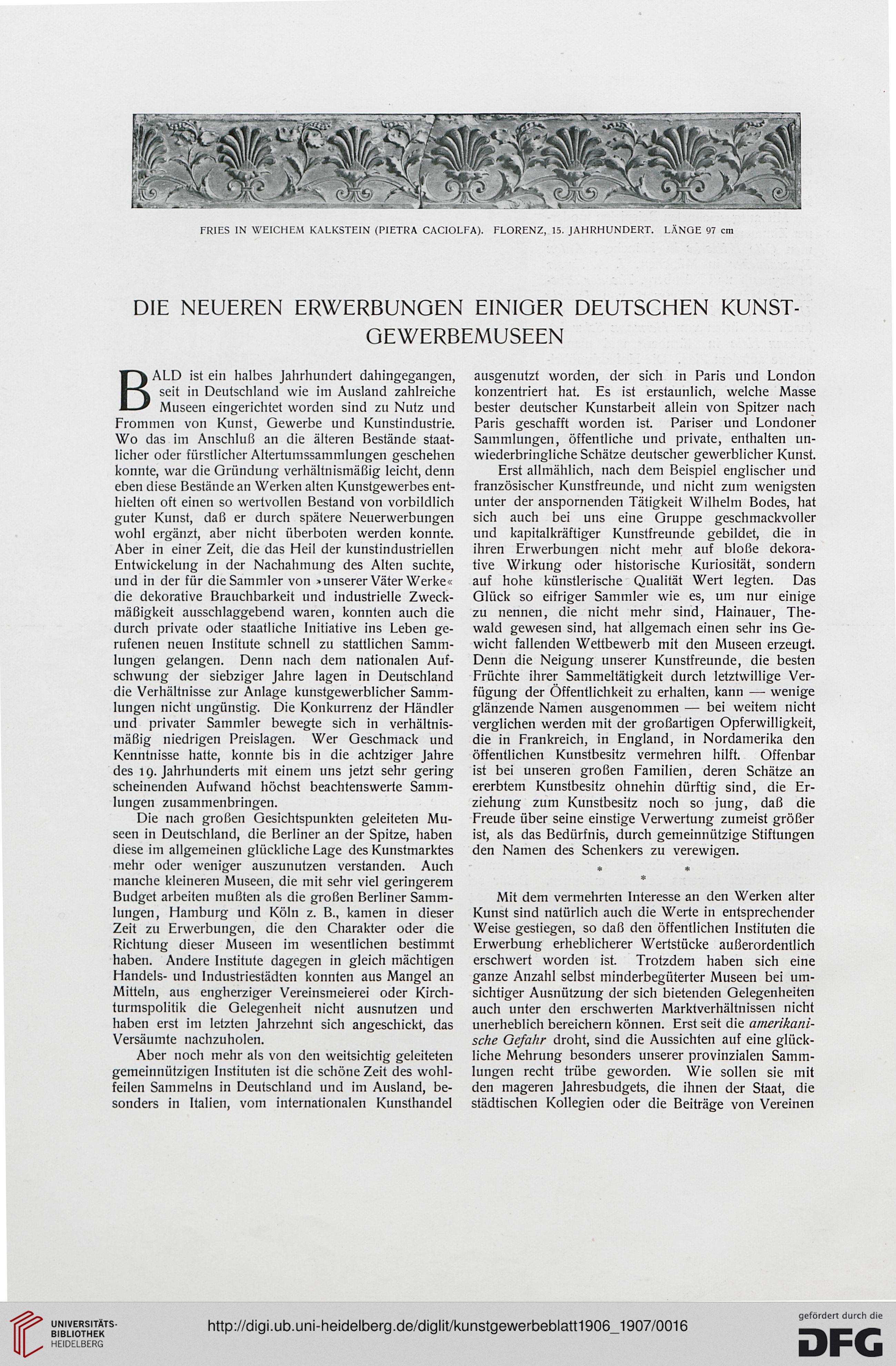FRIES IN WEICHEM KALKSTEIN (PIETRA CACIOLFA). FLORENZ, 15. JAHRHUNDERT. LÄNGE 97 cm
DIE NEUEREN ERWERBUNGEN EINIGER DEUTSCHEN KUNST-
GEWERBEMUSEEN
BALD ist ein halbes Jahrhundert dahingegangen,
seit in Deutschland wie im Ausland zahlreiche
Museen eingerichtet worden sind zu Nutz und
Frommen von Kunst, Gewerbe und Kunstindustrie.
Wo das im Anschluß an die älteren Bestände staat-
licher oder fürstlicher Altertumssammlungen geschehen
konnte, war die Gründung verhältnismäßig leicht, denn
eben diese Bestände an Werken alten Kunstgewerbes ent-
hielten oft einen so wertvollen Bestand von vorbildlich
guter Kunst, daß er durch spätere Neuerwerbungen
wohl ergänzt, aber nicht überboten werden konnte.
Aber in einer Zeit, die das Heil der kunstindustriellen
Entwickelung in der Nachahmung des Alten suchte,
und in der für die Sammler von >unserer Väter Werke«
die dekorative Brauchbarkeit und industrielle Zweck-
mäßigkeit ausschlaggebend waren, konnten auch die
durch private oder staatliche Initiative ins Leben ge-
rufenen neuen Institute schnell zu stattlichen Samm-
lungen gelangen. Denn nach dem nationalen Auf-
schwung der siebziger Jahre lagen in Deutschland
die Verhältnisse zur Anlage kunstgewerblicher Samm-
lungen nicht ungünstig. Die Konkurrenz der Händler
und privater Sammler bewegte sich in verhältnis-
mäßig niedrigen Preislagen. Wer Geschmack und
Kenntnisse hatte, konnte bis in die achtziger Jahre
des 19. Jahrhunderts mit einem uns jetzt sehr gering
scheinenden Aufwand höchst beachtenswerte Samm-
lungen zusammenbringen.
Die nach großen Gesichtspunkten geleiteten Mu-
seen in Deutschland, die Berliner an der Spitze, haben
diese im allgemeinen glückliche Lage des Kunstmarktes
mehr oder weniger auszunutzen verstanden. Auch
manche kleineren Museen, die mit sehr viel geringerem
Budget arbeiten mußten als die großen Berliner Samm-
lungen, Hamburg und Köln z. B., kamen in dieser
Zeit zu Erwerbungen, die den Charakter oder die
Richtung dieser Museen im wesentlichen bestimmt
haben. Andere Institute dagegen in gleich mächtigen
Handels- und Industriestädten konnten aus Mangel an
Mitteln, aus engherziger Vereinsmeierei oder Kirch-
turmspolitik die Gelegenheit nicht ausnutzen und
haben erst im letzten Jahrzehnt sich angeschickt, das
Versäumte nachzuholen.
Aber noch mehr als von den weitsichtig geleiteten
gemeinnützigen Instituten ist die schöne Zeit des wohl-
feilen Sammelns in Deutschland und im Ausland, be-
sonders in Italien, vom internationalen Kunsthandel
ausgenutzt worden, der sich in Paris und London
konzentriert hat. Es ist erstaunlich, welche Masse
bester deutscher Kunstarbeit allein von Spitzer nach
Paris geschafft worden ist. Pariser und Londoner
Sammlungen, öffentliche und private, enthalten un-
wiederbringliche Schätze deutscher gewerblicher Kunst.
Erst allmählich, nach dem Beispiel englischer und
französischer Kunstfreunde, und nicht zum wenigsten
unter der anspornenden Tätigkeit Wilhelm Bodes, hat
sich auch bei uns eine Gruppe geschmackvoller
und kapitalkräftiger Kunstfreunde gebildet, die in
ihren Erwerbungen nicht mehr auf bloße dekora-
tive Wirkung oder historische Kuriosität, sondern
auf hohe künstlerische Qualität Wert legten. Das
Glück so eifriger Sammler wie es, um nur einige
zu nennen, die nicht mehr sind, Hainauer, The-
wald gewesen sind, hat allgemach einen sehr ins Ge-
wicht fallenden Wettbewerb mit den Museen erzeugt.
Denn die Neigung unserer Kunstfreunde, die besten
Früchte ihrer Sammeltätigkeit durch letztwillige Ver-
fügung der Öffentlichkeit zu erhalten, kann — wenige
glänzende Namen ausgenommen — bei weitem nicht
verglichen werden mit der großartigen Opferwilligkeit,
die in Frankreich, in England, in Nordamerika den
öffentlichen Kunstbesitz vermehren hilft. Offenbar
ist bei unseren großen Familien, deren Schätze an
ererbtem Kunstbesitz ohnehin dürftig sind, die Er-
ziehung zum Kunstbesitz noch so jung, daß die
Freude über seine einstige Verwertung zumeist größer
ist, als das Bedürfnis, durch gemeinnützige Stiftungen
den Namen des Schenkers zu verewigen.
Mit dem vermehrten Interesse an den Werken alter
Kunst sind natürlich auch die Werte in entsprechender
Weise gestiegen, so daß den öffentlichen Instituten die
Erwerbung erheblicherer Wertstücke außerordentlich
erschwert worden ist. Trotzdem haben sich eine
ganze Anzahl selbst minderbegüterter Museen bei um-
sichtiger Ausnützung der sich bietenden Gelegenheiten
auch unter den erschwerten Marktverhältnissen nicht
unerheblich bereichern können. Erst seit die amerikani-
sche Gefahr droht, sind die Aussichten auf eine glück-
liche Mehrung besonders unserer provinzialen Samm-
lungen recht trübe geworden. Wie sollen sie mit
den mageren Jahresbudgets, die ihnen der Staat, die
städtischen Kollegien oder die Beiträge von Vereinen
DIE NEUEREN ERWERBUNGEN EINIGER DEUTSCHEN KUNST-
GEWERBEMUSEEN
BALD ist ein halbes Jahrhundert dahingegangen,
seit in Deutschland wie im Ausland zahlreiche
Museen eingerichtet worden sind zu Nutz und
Frommen von Kunst, Gewerbe und Kunstindustrie.
Wo das im Anschluß an die älteren Bestände staat-
licher oder fürstlicher Altertumssammlungen geschehen
konnte, war die Gründung verhältnismäßig leicht, denn
eben diese Bestände an Werken alten Kunstgewerbes ent-
hielten oft einen so wertvollen Bestand von vorbildlich
guter Kunst, daß er durch spätere Neuerwerbungen
wohl ergänzt, aber nicht überboten werden konnte.
Aber in einer Zeit, die das Heil der kunstindustriellen
Entwickelung in der Nachahmung des Alten suchte,
und in der für die Sammler von >unserer Väter Werke«
die dekorative Brauchbarkeit und industrielle Zweck-
mäßigkeit ausschlaggebend waren, konnten auch die
durch private oder staatliche Initiative ins Leben ge-
rufenen neuen Institute schnell zu stattlichen Samm-
lungen gelangen. Denn nach dem nationalen Auf-
schwung der siebziger Jahre lagen in Deutschland
die Verhältnisse zur Anlage kunstgewerblicher Samm-
lungen nicht ungünstig. Die Konkurrenz der Händler
und privater Sammler bewegte sich in verhältnis-
mäßig niedrigen Preislagen. Wer Geschmack und
Kenntnisse hatte, konnte bis in die achtziger Jahre
des 19. Jahrhunderts mit einem uns jetzt sehr gering
scheinenden Aufwand höchst beachtenswerte Samm-
lungen zusammenbringen.
Die nach großen Gesichtspunkten geleiteten Mu-
seen in Deutschland, die Berliner an der Spitze, haben
diese im allgemeinen glückliche Lage des Kunstmarktes
mehr oder weniger auszunutzen verstanden. Auch
manche kleineren Museen, die mit sehr viel geringerem
Budget arbeiten mußten als die großen Berliner Samm-
lungen, Hamburg und Köln z. B., kamen in dieser
Zeit zu Erwerbungen, die den Charakter oder die
Richtung dieser Museen im wesentlichen bestimmt
haben. Andere Institute dagegen in gleich mächtigen
Handels- und Industriestädten konnten aus Mangel an
Mitteln, aus engherziger Vereinsmeierei oder Kirch-
turmspolitik die Gelegenheit nicht ausnutzen und
haben erst im letzten Jahrzehnt sich angeschickt, das
Versäumte nachzuholen.
Aber noch mehr als von den weitsichtig geleiteten
gemeinnützigen Instituten ist die schöne Zeit des wohl-
feilen Sammelns in Deutschland und im Ausland, be-
sonders in Italien, vom internationalen Kunsthandel
ausgenutzt worden, der sich in Paris und London
konzentriert hat. Es ist erstaunlich, welche Masse
bester deutscher Kunstarbeit allein von Spitzer nach
Paris geschafft worden ist. Pariser und Londoner
Sammlungen, öffentliche und private, enthalten un-
wiederbringliche Schätze deutscher gewerblicher Kunst.
Erst allmählich, nach dem Beispiel englischer und
französischer Kunstfreunde, und nicht zum wenigsten
unter der anspornenden Tätigkeit Wilhelm Bodes, hat
sich auch bei uns eine Gruppe geschmackvoller
und kapitalkräftiger Kunstfreunde gebildet, die in
ihren Erwerbungen nicht mehr auf bloße dekora-
tive Wirkung oder historische Kuriosität, sondern
auf hohe künstlerische Qualität Wert legten. Das
Glück so eifriger Sammler wie es, um nur einige
zu nennen, die nicht mehr sind, Hainauer, The-
wald gewesen sind, hat allgemach einen sehr ins Ge-
wicht fallenden Wettbewerb mit den Museen erzeugt.
Denn die Neigung unserer Kunstfreunde, die besten
Früchte ihrer Sammeltätigkeit durch letztwillige Ver-
fügung der Öffentlichkeit zu erhalten, kann — wenige
glänzende Namen ausgenommen — bei weitem nicht
verglichen werden mit der großartigen Opferwilligkeit,
die in Frankreich, in England, in Nordamerika den
öffentlichen Kunstbesitz vermehren hilft. Offenbar
ist bei unseren großen Familien, deren Schätze an
ererbtem Kunstbesitz ohnehin dürftig sind, die Er-
ziehung zum Kunstbesitz noch so jung, daß die
Freude über seine einstige Verwertung zumeist größer
ist, als das Bedürfnis, durch gemeinnützige Stiftungen
den Namen des Schenkers zu verewigen.
Mit dem vermehrten Interesse an den Werken alter
Kunst sind natürlich auch die Werte in entsprechender
Weise gestiegen, so daß den öffentlichen Instituten die
Erwerbung erheblicherer Wertstücke außerordentlich
erschwert worden ist. Trotzdem haben sich eine
ganze Anzahl selbst minderbegüterter Museen bei um-
sichtiger Ausnützung der sich bietenden Gelegenheiten
auch unter den erschwerten Marktverhältnissen nicht
unerheblich bereichern können. Erst seit die amerikani-
sche Gefahr droht, sind die Aussichten auf eine glück-
liche Mehrung besonders unserer provinzialen Samm-
lungen recht trübe geworden. Wie sollen sie mit
den mageren Jahresbudgets, die ihnen der Staat, die
städtischen Kollegien oder die Beiträge von Vereinen