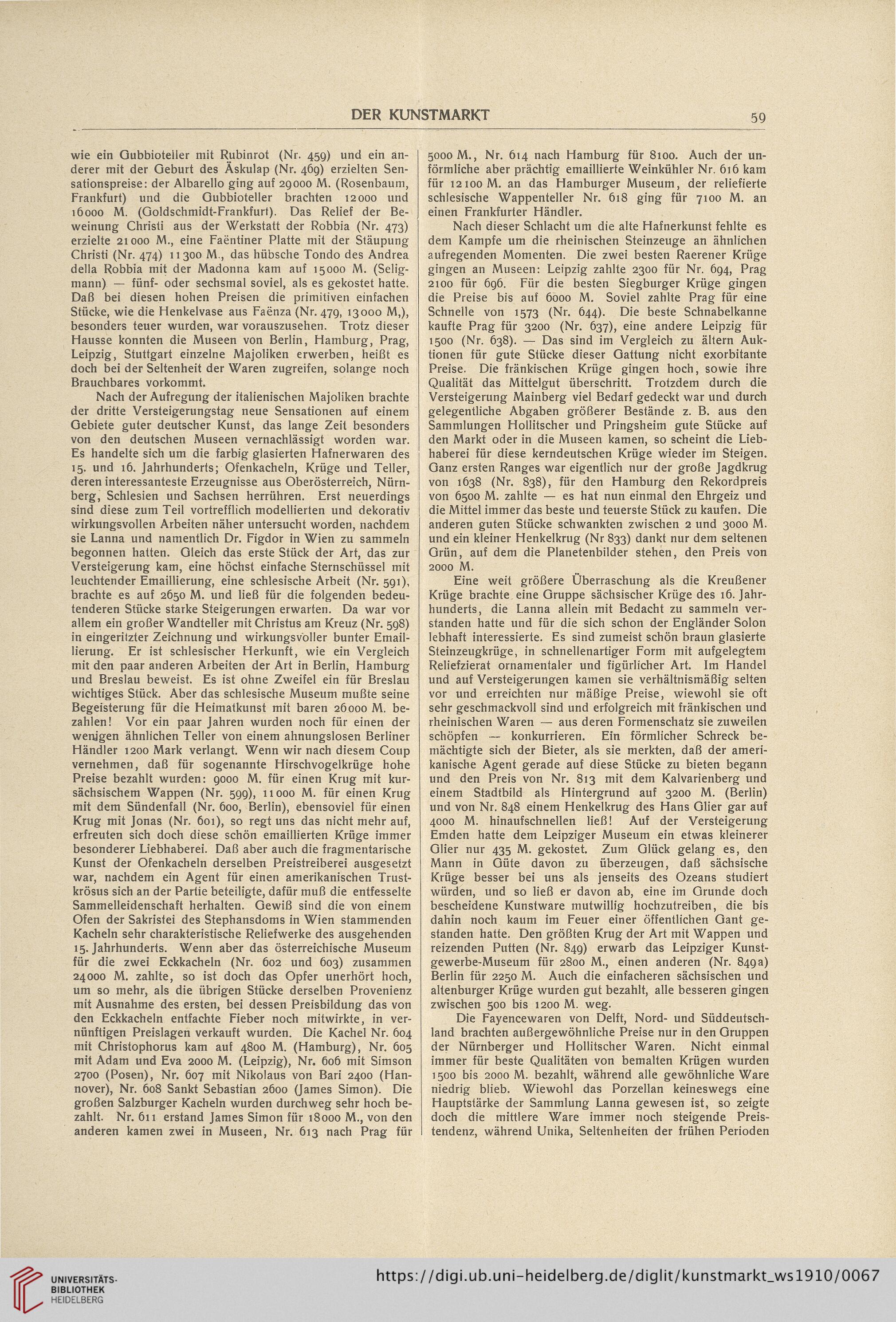DER KUNSTMARKT
59
wie ein Qubbioteiler mit Rubinrot (Nr. 459) und ein an-
derer mit der Geburt des Äskulap (Nr. 469) erzielten Sen-
sationspreise: der Albarello ging auf 29000 M. (Rosenbaum,
Frankfurt) und die Qubbioteiler brachten 12000 und
16000 M. (Goldschmidt-Frankfurt). Das Relief der Be-
weinung Christi aus der Werkstatt der Robbia (Nr. 473)
erzielte 21000 M., eine Faentiner Platte mit der Stäupung
Christi (Nr. 474) 11300 M., das hübsche Tondo des Andrea
della Robbia mit der Madonna kam auf 15000 M. (Selig-
mann) — fünf- oder sechsmal soviel, als es gekostet hatte.
Daß bei diesen hohen Preisen die primitiven einfachen
Stücke, wie die Henkelvase aus Faenza (Nr. 479, 13000 M,),
besonders teuer wurden, war vorauszusehen. Trotz dieser
Hausse konnten die Museen von Berlin, Hamburg, Prag,
Leipzig, Stuttgart einzelne Majoliken erwerben, heißt es
doch bei der Seltenheit der Waren zugreifen, solange noch
Brauchbares vorkommt.
Nach der Aufregung der italienischen Majoliken brachte
der dritte Versteigerungstag neue Sensationen auf einem
Gebiete guter deutscher Kunst, das lange Zeit besonders
von den deutschen Museen vernachlässigt worden war.
Es handelte sich um die farbig glasierten Hafnerwaren des
15. und 16. Jahrhunderts; Ofenkacheln, Krüge und Teller,
deren interessanteste Erzeugnisse aus Oberösterreich, Nürn-
berg, Schlesien und Sachsen herrühren. Erst neuerdings
sind diese zum Teil vortrefflich modellierten und dekorativ
wirkungsvollen Arbeiten näher untersucht worden, nachdem
sie Lanna und namentlich Dr. Figdor in Wien zu sammeln
begonnen hatten. Gleich das erste Stück der Art, das zur
Versteigerung kam, eine höchst einfache Sternschüssel mit
leuchtender Emaillierung, eine schlesische Arbeit (Nr. 591),
brachte es auf 2650 M. und ließ für die folgenden bedeu-
tenderen Stücke starke Steigerungen erwarten. Da war vor
allem ein großer Wandteller mit Christus am Kreuz (Nr. 598)
in eingeritzter Zeichnung und wirkungsvoller bunter Email-
lierung. Er ist schlesischer Herkunft, wie ein Vergleich
mit den paar anderen Arbeiten der Art in Berlin, Hamburg
und Breslau beweist. Es ist ohne Zweifel ein für Breslau
wichtiges Stück. Aber das schlesische Museum mußte seine
Begeisterung für die Heimatkunst mit baren 26000 M. be-
zahlen! Vor ein paar Jahren wurden noch für einen der
wenigen ähnlichen Teller von einem ahnungslosen Berliner
Händler 1200 Mark verlangt. Wenn wir nach diesem Coup
vernehmen, daß für sogenannte Hirschvogelkrüge hohe
Preise bezahlt wurden: 9000 M. für einen Krug mit kur-
sächsischem Wappen (Nr. 599), 11000 M. für einen Krug
mit dem Sündenfall (Nr. 600, Berlin), ebensoviel für einen
Krug mit Jonas (Nr. 601), so regt uns das nicht mehr auf,
erfreuten sich doch diese schön emaillierten Krüge immer
besonderer Liebhaberei. Daß aber auch die fragmentarische
Kunst der Ofenkacheln derselben Preistreiberei ausgesetzt
war, nachdem ein Agent für einen amerikanischen Trust-
krösus sich an der Partie beteiligte, dafür muß die entfesselte
Sammelleidenschaft herhalten. Gewiß sind die von einem
Ofen der Sakristei des Stephansdoms in Wien stammenden
Kacheln sehr charakteristische Reliefwerke des ausgehenden
15. Jahrhunderts. Wenn aber das österreichische Museum
für die zwei Eckkacheln (Nr. 602 und 603) zusammen
24000 M. zahlte, so ist doch das Opfer unerhört hoch,
um so mehr, als die übrigen Stücke derselben Provenienz
mit Ausnahme des ersten, bei dessen Preisbildung das von
den Eckkacheln entfachte Fieber noch mitwirkte, in ver-
nünftigen Preislagen verkauft wurden. Die Kachel Nr. 604
mit Christophorus kam auf 4800 M. (Hamburg), Nr. 605
mit Adam und Eva 2000 M. (Leipzig), Nr. 606 mit Simson
2700 (Posen), Nr. 607 mit Nikolaus von Bari 2400 (Han-
nover), Nr. 608 Sankt Sebastian 2600 (James Simon). Die
großen Salzburger Kacheln wurden durchweg sehr hoch be-
zahlt. Nr. 611 erstand James Simon für 18000 M., von den
anderen kamen zwei in Museen, Nr. 613 nach Prag für
5000 M., Nr. 614 nach Hamburg für 8100. Auch der un-
förmliche aber prächtig emaillierte Weinkühler Nr. 616 kam
für 12100 M. an das Hamburger Museum, der reliefierte
schlesische Wappenteller Nr. 618 ging für 7100 M. an
einen Frankfurter Händler.
Nach dieser Schlacht um die alte Hafnerkunst fehlte es
dem Kampfe um die rheinischen Steinzeuge an ähnlichen
aufregenden Momenten. Die zwei besten Raerener Krüge
gingen an Museen: Leipzig zahlte 2300 für Nr. 694, Prag
2100 für 696. Für die besten Siegburger Krüge gingen
die Preise bis auf 6000 M. Soviel zahlte Prag für eine
Schnelle von 1573 (Nr. 644). Die beste Schnabelkanne
kaufte Prag für 3200 (Nr. 637), eine andere Leipzig für
1500 (Nr. 638). — Das sind im Vergleich zu ältern Auk-
tionen für gute Stücke dieser Gattung nicht exorbitante
Preise. Die fränkischen Krüge gingen hoch, sowie ihre
Qualität das Mittelgut überschritt. Trotzdem durch die
Versteigerung Mainberg viel Bedarf gedeckt war und durch
gelegentliche Abgaben größerer Bestände z. B. aus den
Sammlungen Hollitscher und Pringsheim gute Stücke auf
den Markt oder in die Museen kamen, so scheint die Lieb-
haberei für diese kerndeutschen Krüge wieder im Steigen.
Ganz ersten Ranges war eigentlich nur der große Jagdkrug
von 1638 (Nr. 838), für den Hamburg den Rekordpreis
von 6500 M. zahlte — es hat nun einmal den Ehrgeiz und
die Mittel immer das beste und teuerste Stück zu kaufen. Die
anderen guten Stücke schwankten zwischen 2 und 3000 M.
und ein kleiner Henkelkrug (Nr 833) dankt nur dem seltenen
Grün, auf dem die Planetenbilder stehen, den Preis von
2000 M.
Eine weit größere Überraschung als die Kreußener
Krüge brachte eine Gruppe sächsischer Krüge des 16. Jahr-
hunderts, die Lanna allein mit Bedacht zu sammeln ver-
standen hatte und für die sich schon der Engländer Solon
lebhaft interessierte. Es sind zumeist schön braun glasierte
Steinzeugkrüge, in schnellenartiger Form mit aufgelegtem
Reliefzierat ornamentaler und figürlicher Art. Im Handel
und auf Versteigerungen kamen sie verhältnismäßig selten
vor und erreichten nur mäßige Preise, wiewohl sie oft
sehr geschmackvoll sind und erfolgreich mit fränkischen und
rheinischen Waren — aus deren Formenschatz sie zuweilen
schöpfen — konkurrieren. Ein förmlicher Schreck be-
mächtigte sich der Bieter, als sie merkten, daß der ameri-
kanische Agent gerade auf diese Stücke zu bieten begann
und den Preis von Nr. 813 mit dem Kalvarienberg und
einem Stadtbild als Hintergrund auf 3200 M. (Berlin)
und von Nr. 848 einem Henkelkrug des Hans Glier gar auf
4000 M. hinaufschnellen ließ! Auf der Versteigerung
Emden hatte dem Leipziger Museum ein etwas kleinerer
Glier nur 435 M. gekostet. Zum Glück gelang es, den
Mann in Güte davon zu überzeugen, daß sächsische
Krüge besser bei uns als jenseits des Ozeans studiert
würden, und so ließ er davon ab, eine im Grunde doch
bescheidene Kunstware mutwillig hochzutreiben, die bis
dahin noch kaum im Feuer einer öffentlichen Gant ge-
standen hatte. Den größten Krug der Art mit Wappen und
reizenden Putten (Nr. 84g) erwarb das Leipziger Kunst-
gewerbe-Museum für 2800 M., einen anderen (Nr. 849 a)
Berlin für 2250 M. Auch die einfacheren sächsischen und
altenburger Krüge wurden gut bezahlt, alle besseren gingen
zwischen 500 bis 1200 M. weg.
Die Fayencewaren von Delft, Nord- und Süddeutsch-
land brachten außergewöhnliche Preise nur in den Gruppen
der Nürnberger und Hollitscher Waren. Nicht einmal
immer für beste Qualitäten von bemalten Krügen wurden
1500 bis 2000 M. bezahlt, während alle gewöhnliche Ware
niedrig blieb. Wiewohl das Porzellan keineswegs eine
Hauptstärke der Sammlung Lanna gewesen ist, so zeigte
doch die mittlere Ware immer noch steigende Preis-
tendenz, während Unika, Seltenheiten der frühen Perioden
59
wie ein Qubbioteiler mit Rubinrot (Nr. 459) und ein an-
derer mit der Geburt des Äskulap (Nr. 469) erzielten Sen-
sationspreise: der Albarello ging auf 29000 M. (Rosenbaum,
Frankfurt) und die Qubbioteiler brachten 12000 und
16000 M. (Goldschmidt-Frankfurt). Das Relief der Be-
weinung Christi aus der Werkstatt der Robbia (Nr. 473)
erzielte 21000 M., eine Faentiner Platte mit der Stäupung
Christi (Nr. 474) 11300 M., das hübsche Tondo des Andrea
della Robbia mit der Madonna kam auf 15000 M. (Selig-
mann) — fünf- oder sechsmal soviel, als es gekostet hatte.
Daß bei diesen hohen Preisen die primitiven einfachen
Stücke, wie die Henkelvase aus Faenza (Nr. 479, 13000 M,),
besonders teuer wurden, war vorauszusehen. Trotz dieser
Hausse konnten die Museen von Berlin, Hamburg, Prag,
Leipzig, Stuttgart einzelne Majoliken erwerben, heißt es
doch bei der Seltenheit der Waren zugreifen, solange noch
Brauchbares vorkommt.
Nach der Aufregung der italienischen Majoliken brachte
der dritte Versteigerungstag neue Sensationen auf einem
Gebiete guter deutscher Kunst, das lange Zeit besonders
von den deutschen Museen vernachlässigt worden war.
Es handelte sich um die farbig glasierten Hafnerwaren des
15. und 16. Jahrhunderts; Ofenkacheln, Krüge und Teller,
deren interessanteste Erzeugnisse aus Oberösterreich, Nürn-
berg, Schlesien und Sachsen herrühren. Erst neuerdings
sind diese zum Teil vortrefflich modellierten und dekorativ
wirkungsvollen Arbeiten näher untersucht worden, nachdem
sie Lanna und namentlich Dr. Figdor in Wien zu sammeln
begonnen hatten. Gleich das erste Stück der Art, das zur
Versteigerung kam, eine höchst einfache Sternschüssel mit
leuchtender Emaillierung, eine schlesische Arbeit (Nr. 591),
brachte es auf 2650 M. und ließ für die folgenden bedeu-
tenderen Stücke starke Steigerungen erwarten. Da war vor
allem ein großer Wandteller mit Christus am Kreuz (Nr. 598)
in eingeritzter Zeichnung und wirkungsvoller bunter Email-
lierung. Er ist schlesischer Herkunft, wie ein Vergleich
mit den paar anderen Arbeiten der Art in Berlin, Hamburg
und Breslau beweist. Es ist ohne Zweifel ein für Breslau
wichtiges Stück. Aber das schlesische Museum mußte seine
Begeisterung für die Heimatkunst mit baren 26000 M. be-
zahlen! Vor ein paar Jahren wurden noch für einen der
wenigen ähnlichen Teller von einem ahnungslosen Berliner
Händler 1200 Mark verlangt. Wenn wir nach diesem Coup
vernehmen, daß für sogenannte Hirschvogelkrüge hohe
Preise bezahlt wurden: 9000 M. für einen Krug mit kur-
sächsischem Wappen (Nr. 599), 11000 M. für einen Krug
mit dem Sündenfall (Nr. 600, Berlin), ebensoviel für einen
Krug mit Jonas (Nr. 601), so regt uns das nicht mehr auf,
erfreuten sich doch diese schön emaillierten Krüge immer
besonderer Liebhaberei. Daß aber auch die fragmentarische
Kunst der Ofenkacheln derselben Preistreiberei ausgesetzt
war, nachdem ein Agent für einen amerikanischen Trust-
krösus sich an der Partie beteiligte, dafür muß die entfesselte
Sammelleidenschaft herhalten. Gewiß sind die von einem
Ofen der Sakristei des Stephansdoms in Wien stammenden
Kacheln sehr charakteristische Reliefwerke des ausgehenden
15. Jahrhunderts. Wenn aber das österreichische Museum
für die zwei Eckkacheln (Nr. 602 und 603) zusammen
24000 M. zahlte, so ist doch das Opfer unerhört hoch,
um so mehr, als die übrigen Stücke derselben Provenienz
mit Ausnahme des ersten, bei dessen Preisbildung das von
den Eckkacheln entfachte Fieber noch mitwirkte, in ver-
nünftigen Preislagen verkauft wurden. Die Kachel Nr. 604
mit Christophorus kam auf 4800 M. (Hamburg), Nr. 605
mit Adam und Eva 2000 M. (Leipzig), Nr. 606 mit Simson
2700 (Posen), Nr. 607 mit Nikolaus von Bari 2400 (Han-
nover), Nr. 608 Sankt Sebastian 2600 (James Simon). Die
großen Salzburger Kacheln wurden durchweg sehr hoch be-
zahlt. Nr. 611 erstand James Simon für 18000 M., von den
anderen kamen zwei in Museen, Nr. 613 nach Prag für
5000 M., Nr. 614 nach Hamburg für 8100. Auch der un-
förmliche aber prächtig emaillierte Weinkühler Nr. 616 kam
für 12100 M. an das Hamburger Museum, der reliefierte
schlesische Wappenteller Nr. 618 ging für 7100 M. an
einen Frankfurter Händler.
Nach dieser Schlacht um die alte Hafnerkunst fehlte es
dem Kampfe um die rheinischen Steinzeuge an ähnlichen
aufregenden Momenten. Die zwei besten Raerener Krüge
gingen an Museen: Leipzig zahlte 2300 für Nr. 694, Prag
2100 für 696. Für die besten Siegburger Krüge gingen
die Preise bis auf 6000 M. Soviel zahlte Prag für eine
Schnelle von 1573 (Nr. 644). Die beste Schnabelkanne
kaufte Prag für 3200 (Nr. 637), eine andere Leipzig für
1500 (Nr. 638). — Das sind im Vergleich zu ältern Auk-
tionen für gute Stücke dieser Gattung nicht exorbitante
Preise. Die fränkischen Krüge gingen hoch, sowie ihre
Qualität das Mittelgut überschritt. Trotzdem durch die
Versteigerung Mainberg viel Bedarf gedeckt war und durch
gelegentliche Abgaben größerer Bestände z. B. aus den
Sammlungen Hollitscher und Pringsheim gute Stücke auf
den Markt oder in die Museen kamen, so scheint die Lieb-
haberei für diese kerndeutschen Krüge wieder im Steigen.
Ganz ersten Ranges war eigentlich nur der große Jagdkrug
von 1638 (Nr. 838), für den Hamburg den Rekordpreis
von 6500 M. zahlte — es hat nun einmal den Ehrgeiz und
die Mittel immer das beste und teuerste Stück zu kaufen. Die
anderen guten Stücke schwankten zwischen 2 und 3000 M.
und ein kleiner Henkelkrug (Nr 833) dankt nur dem seltenen
Grün, auf dem die Planetenbilder stehen, den Preis von
2000 M.
Eine weit größere Überraschung als die Kreußener
Krüge brachte eine Gruppe sächsischer Krüge des 16. Jahr-
hunderts, die Lanna allein mit Bedacht zu sammeln ver-
standen hatte und für die sich schon der Engländer Solon
lebhaft interessierte. Es sind zumeist schön braun glasierte
Steinzeugkrüge, in schnellenartiger Form mit aufgelegtem
Reliefzierat ornamentaler und figürlicher Art. Im Handel
und auf Versteigerungen kamen sie verhältnismäßig selten
vor und erreichten nur mäßige Preise, wiewohl sie oft
sehr geschmackvoll sind und erfolgreich mit fränkischen und
rheinischen Waren — aus deren Formenschatz sie zuweilen
schöpfen — konkurrieren. Ein förmlicher Schreck be-
mächtigte sich der Bieter, als sie merkten, daß der ameri-
kanische Agent gerade auf diese Stücke zu bieten begann
und den Preis von Nr. 813 mit dem Kalvarienberg und
einem Stadtbild als Hintergrund auf 3200 M. (Berlin)
und von Nr. 848 einem Henkelkrug des Hans Glier gar auf
4000 M. hinaufschnellen ließ! Auf der Versteigerung
Emden hatte dem Leipziger Museum ein etwas kleinerer
Glier nur 435 M. gekostet. Zum Glück gelang es, den
Mann in Güte davon zu überzeugen, daß sächsische
Krüge besser bei uns als jenseits des Ozeans studiert
würden, und so ließ er davon ab, eine im Grunde doch
bescheidene Kunstware mutwillig hochzutreiben, die bis
dahin noch kaum im Feuer einer öffentlichen Gant ge-
standen hatte. Den größten Krug der Art mit Wappen und
reizenden Putten (Nr. 84g) erwarb das Leipziger Kunst-
gewerbe-Museum für 2800 M., einen anderen (Nr. 849 a)
Berlin für 2250 M. Auch die einfacheren sächsischen und
altenburger Krüge wurden gut bezahlt, alle besseren gingen
zwischen 500 bis 1200 M. weg.
Die Fayencewaren von Delft, Nord- und Süddeutsch-
land brachten außergewöhnliche Preise nur in den Gruppen
der Nürnberger und Hollitscher Waren. Nicht einmal
immer für beste Qualitäten von bemalten Krügen wurden
1500 bis 2000 M. bezahlt, während alle gewöhnliche Ware
niedrig blieb. Wiewohl das Porzellan keineswegs eine
Hauptstärke der Sammlung Lanna gewesen ist, so zeigte
doch die mittlere Ware immer noch steigende Preis-
tendenz, während Unika, Seltenheiten der frühen Perioden