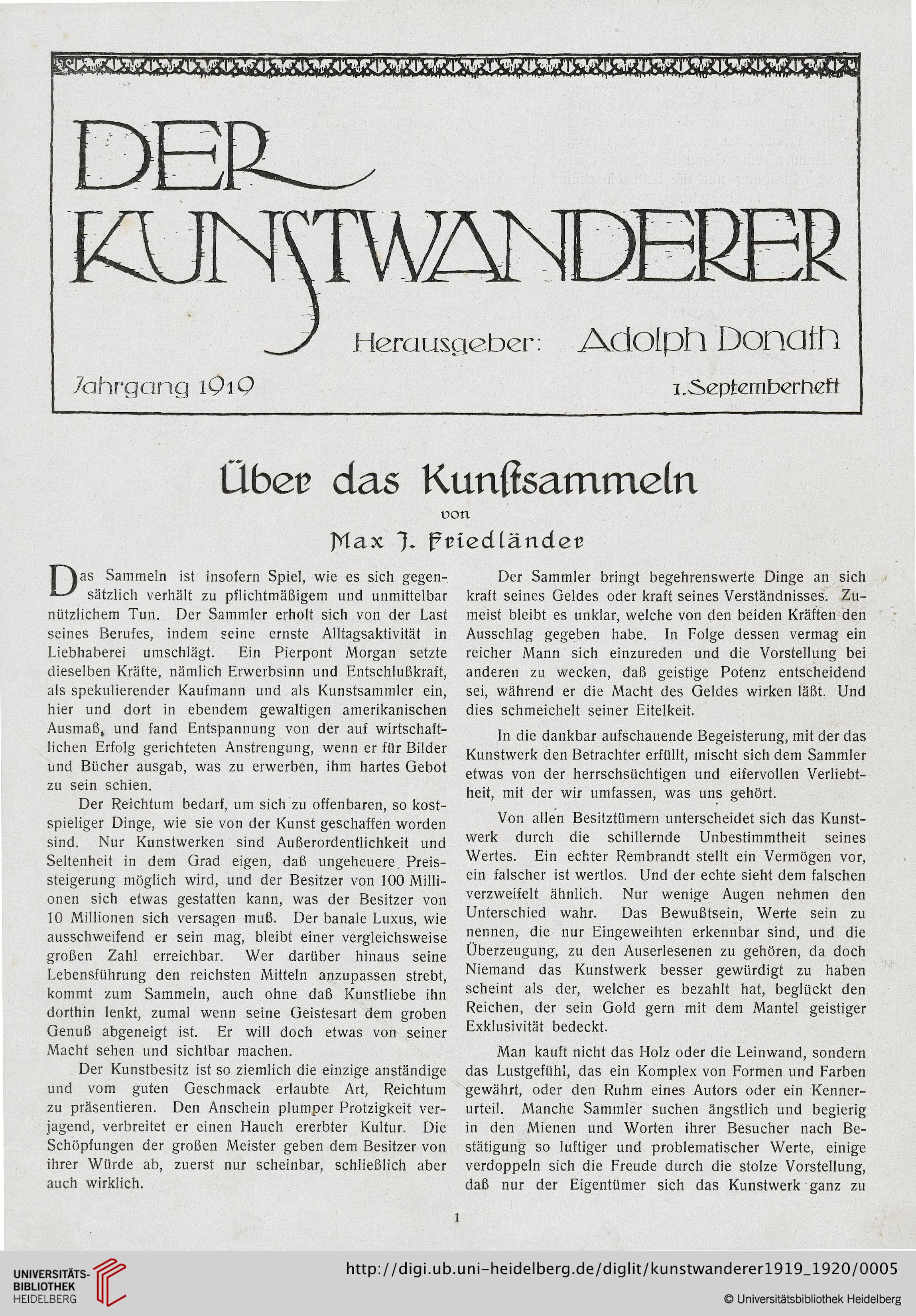/ahrgang 1Q1Q
Herausgeber: Adolph DOHQtH
i. Septembemeft
Übec das Kunßsammetn
üon
Jvtax 7. ftiedländev
| jas Sammeln ist insofern Spiel, wie es sich gegen-
sätzlich verhält zu pflichtmäßigem und unmittelbar
nützlichem Tun. Der Sammler erholt sich von der Last
seines Berufes, indem seine ernste Alltagsaktivität in
Liebhaberei umschlägt. Ein Pierpont Morgan setzte
dieselben Kräfte, nämlich Erwerbsinn und Entschlußkraft,
als spekulierender Kaufmann und als Kunstsammler ein,
hier und dort in ebendem gewaltigen amerikanischen
Ausmaß* und fand Entspannung von der auf wirtschaft-
lichen Erfolg gerichteten Anstrengung, wenn er für Bilder
und Bücher ausgab, was zu erwerben, ihm hartes Gebot
zu sein schien.
Der Reichtum bedarf, um sich zu offenbaren, so kost-
spieliger Dinge, wie sie von der Kunst geschaffen worden
sind. Nur Kunstwerken sind Außerordentlichkeit und
Seltenheit in dem Grad eigen, daß ungeheuere Preis-
steigerung möglich wird, und der Besitzer von 100 Milli-
onen sich etwas gestatten kann, was der Besitzer von
10 Millionen sich versagen muß. Der banale Luxus, wie
ausschweifend er sein mag, bleibt einer vergleichsweise
großen Zahl erreichbar. Wer darüber hinaus seine
Lebensführung den reichsten Mitteln anzupassen strebt,
kommt zum Sammeln, auch ohne daß Kunstliebe ihn
dorthin lenkt, zumal wenn seine Geistesart dem groben
Genuß abgeneigt ist. Er will doch etwas von seiner
Macht sehen und sichtbar machen.
Der Kunstbesitz ist so ziemlich die einzige anständige
und vom guten Geschmack erlaubte Art, Reichtum
zu präsentieren. Den Anschein plumper Protzigkeit ver-
jagend, verbreitet er einen Hauch ererbter Kultur. Die
Schöpfungen der großen Meister geben dem Besitzer von
ihrer Würde ab, zuerst nur scheinbar, schließlich aber
auch wirklich.
Der Sammler bringt begehrenswerte Dinge an sich
kraft seines Geldes oder kraft seines Verständnisses. Zu-
meist bleibt es unklar, welche von den beiden Kräften den
Ausschlag gegeben habe, ln Folge dessen vermag ein
reicher Mann sich einzureden und die Vorstellung bei
anderen zu wecken, daß geistige Potenz entscheidend
sei, während er die Macht des Geldes wirken läßt. Und
dies schmeichelt seiner Eitelkeit.
In die dankbar aufschauende Begeisterung, mit der das
Kunstwerk den Betrachter erfüllt, mischt sich dem Sammler
etwas von der herrschsüchtigen und eifervollen Verliebt-
heit, mit der wir umfassen, was uns gehört.
Von allen Besitztümern unterscheidet sich das Kunst-
werk durch die schillernde Unbestimmtheit seines
Wertes. Ein echter Rembrandt stellt ein Vermögen vor,
ein falscher ist wertlos. Und der echte sieht dem falschen
verzweifelt ähnlich. Nur wenige Augen nehmen den
Unterschied wahr. Das Bewußtsein, Werte sein zu
nennen, die nur Eingeweihten erkennbar sind, und die
Überzeugung, zu den Auserlesenen zu gehören, da doch
Niemand das Kunstwerk besser gewürdigt zu haben
scheint als der, welcher es bezahlt hat, beglückt den
Reichen, der sein Gold gern mit dem Mantel geistiger
Exklusivität bedeckt.
Man kauft nicht das Holz oder die Leinwand, sondern
das Lustgefühl, das ein Komplex von Formen und Farben
gewährt, oder den Ruhm eines Autors oder ein Kenner-
urteil. Manche Sammler suchen ängstlich und begierig
in den Mienen und Worten ihrer Besucher nach Be-
stätigung so luftiger und problematischer Werte, einige
verdoppeln sich die Freude durch die stolze Vorstellung,
daß nur der Eigentümer sich das Kunstwerk ganz zu
1
Herausgeber: Adolph DOHQtH
i. Septembemeft
Übec das Kunßsammetn
üon
Jvtax 7. ftiedländev
| jas Sammeln ist insofern Spiel, wie es sich gegen-
sätzlich verhält zu pflichtmäßigem und unmittelbar
nützlichem Tun. Der Sammler erholt sich von der Last
seines Berufes, indem seine ernste Alltagsaktivität in
Liebhaberei umschlägt. Ein Pierpont Morgan setzte
dieselben Kräfte, nämlich Erwerbsinn und Entschlußkraft,
als spekulierender Kaufmann und als Kunstsammler ein,
hier und dort in ebendem gewaltigen amerikanischen
Ausmaß* und fand Entspannung von der auf wirtschaft-
lichen Erfolg gerichteten Anstrengung, wenn er für Bilder
und Bücher ausgab, was zu erwerben, ihm hartes Gebot
zu sein schien.
Der Reichtum bedarf, um sich zu offenbaren, so kost-
spieliger Dinge, wie sie von der Kunst geschaffen worden
sind. Nur Kunstwerken sind Außerordentlichkeit und
Seltenheit in dem Grad eigen, daß ungeheuere Preis-
steigerung möglich wird, und der Besitzer von 100 Milli-
onen sich etwas gestatten kann, was der Besitzer von
10 Millionen sich versagen muß. Der banale Luxus, wie
ausschweifend er sein mag, bleibt einer vergleichsweise
großen Zahl erreichbar. Wer darüber hinaus seine
Lebensführung den reichsten Mitteln anzupassen strebt,
kommt zum Sammeln, auch ohne daß Kunstliebe ihn
dorthin lenkt, zumal wenn seine Geistesart dem groben
Genuß abgeneigt ist. Er will doch etwas von seiner
Macht sehen und sichtbar machen.
Der Kunstbesitz ist so ziemlich die einzige anständige
und vom guten Geschmack erlaubte Art, Reichtum
zu präsentieren. Den Anschein plumper Protzigkeit ver-
jagend, verbreitet er einen Hauch ererbter Kultur. Die
Schöpfungen der großen Meister geben dem Besitzer von
ihrer Würde ab, zuerst nur scheinbar, schließlich aber
auch wirklich.
Der Sammler bringt begehrenswerte Dinge an sich
kraft seines Geldes oder kraft seines Verständnisses. Zu-
meist bleibt es unklar, welche von den beiden Kräften den
Ausschlag gegeben habe, ln Folge dessen vermag ein
reicher Mann sich einzureden und die Vorstellung bei
anderen zu wecken, daß geistige Potenz entscheidend
sei, während er die Macht des Geldes wirken läßt. Und
dies schmeichelt seiner Eitelkeit.
In die dankbar aufschauende Begeisterung, mit der das
Kunstwerk den Betrachter erfüllt, mischt sich dem Sammler
etwas von der herrschsüchtigen und eifervollen Verliebt-
heit, mit der wir umfassen, was uns gehört.
Von allen Besitztümern unterscheidet sich das Kunst-
werk durch die schillernde Unbestimmtheit seines
Wertes. Ein echter Rembrandt stellt ein Vermögen vor,
ein falscher ist wertlos. Und der echte sieht dem falschen
verzweifelt ähnlich. Nur wenige Augen nehmen den
Unterschied wahr. Das Bewußtsein, Werte sein zu
nennen, die nur Eingeweihten erkennbar sind, und die
Überzeugung, zu den Auserlesenen zu gehören, da doch
Niemand das Kunstwerk besser gewürdigt zu haben
scheint als der, welcher es bezahlt hat, beglückt den
Reichen, der sein Gold gern mit dem Mantel geistiger
Exklusivität bedeckt.
Man kauft nicht das Holz oder die Leinwand, sondern
das Lustgefühl, das ein Komplex von Formen und Farben
gewährt, oder den Ruhm eines Autors oder ein Kenner-
urteil. Manche Sammler suchen ängstlich und begierig
in den Mienen und Worten ihrer Besucher nach Be-
stätigung so luftiger und problematischer Werte, einige
verdoppeln sich die Freude durch die stolze Vorstellung,
daß nur der Eigentümer sich das Kunstwerk ganz zu
1