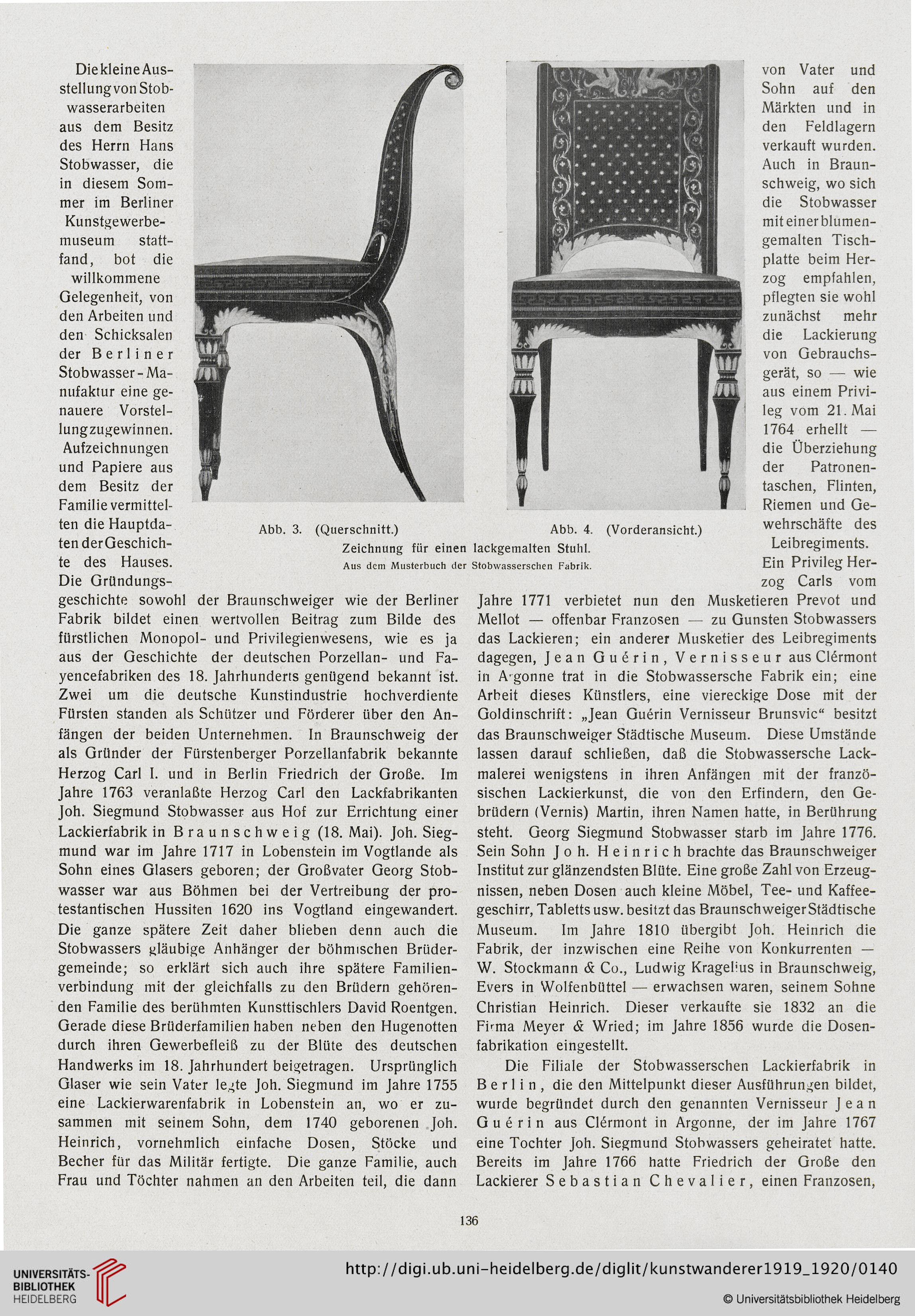DiekleineAus-
stellungvonStob-
wasserarbeiten
aus dem Besitz
des Herrn Hans
Stobwasser, die
in diesem Som-
mer im Berliner
Kunstgewerbe-
museum statt-
fand, bot die
willkommene
Gelegenheit, von
den Arbeiten und
den Schicksalen
der Berliner
Stobwasser-Ma-
nufaktur eine ge-
nauere Vorstel-
lungzugewinnen.
Aufzeichnungen
und Papiere aus
dem Besitz der
Familie vermittel-
ten die Hauptda-
ten derGeschich-
te des Hauses.
Die Gründungs-
geschichte sowohl der Braunschweiger wie der Berliner
Fabrik bildet einen wertvollen Beitrag zum Bilde des
fürstlichen Monopol- und Privilegienwesens, wie es ja
aus der Geschichte der deutschen Porzellan- und Fa-
yencefabriken des 18. Jahrhunderts genügend bekannt ist.
Zwei um die deutsche Kunstindustrie hochverdiente
Fürsten standen als Schützer und Förderer über den An-
fängen der beiden Unternehmen. In Braunschweig der
als Gründer der Fürstenberger Porzellanfabrik bekannte
Herzog Carl 1. und in Berlin Friedrich der Große. Im
Jahre 1763 veranlaßte Herzog Carl den Lackfabrikanten
Joh. Siegmund Stobwasser aus Hof zur Errichtung einer
Lackierfabrik in Braunschweig (18. Mai). Joh. Sieg-
mund war im Jahre 1717 in Lobenstein im Vogtlande als
Sohn eines Glasers geboren; der Großvater Georg Stob-
wasser war aus Böhmen bei der Vertreibung der pro-
testantischen Hussiten 1620 ins Vogtland eingewandert.
Die ganze spätere Zeit daher blieben denn auch die
Stobwassers gläubige Anhänger der böhmischen Brüder-
gemeinde; so erklärt sich auch ihre spätere Familien-
verbindung mit der gleichfalls zu den Brüdern gehören-
den Familie des berühmten Kunsttischlers David Roentgen.
Gerade diese Brüderfamilien haben neben den Hugenotten
durch ihren Gewerbefleiß zu der Blüte des deutschen
Handwerks im 18. Jahrhundert beigetragen. Ursprünglich
Glaser wie sein Vater legte Joh. Siegmund im Jahre 1755
eine Lackierwarenfabrik in Lobenstein an, wo er zu-
sammen mit seinem Sohn, dem 1740 geborenen Joh.
Heinrich, vornehmlich einfache Dosen, Stöcke und
Becher für das Militär fertigte. Die ganze Familie, auch
Frau und Töchter nahmen an den Arbeiten teil, die dann
von Vater und
Sohn auf den
Märkten und in
den Feldlagern
verkauft wurden.
Auch in Braun-
schweig, wo sich
die Stobwasser
mit einer blumen-
gemalten Tisch-
platte beim Her-
zog empfahlen,
pflegten sie wohl
zunächst mehr
die Lackierung
von Gebrauchs-
gerät, so — wie
aus einem Privi-
leg vom 21. Mai
1764 erhellt —
die Überziehung
der Patronen-
taschen, Flinten,
Riemen und Ge-
wehrschäfte des
Leibregiments.
Ein Privileg Her-
zog Carls vom
Jahre 1771 verbietet nun den Musketieren Prevot und
Mellot — offenbar Franzosen — zu Gunsten Stobwassers
das Lackieren; ein anderer Musketier des Leibregiments
dagegen, Jean G u 6 r i n , Vernisseur aus C16rmont
in A'gönne trat in die Stobwassersche Fabrik ein; eine
Arbeit dieses Künstlers, eine viereckige Dose mit der
Goldinschrift: „Jean Guerin Vernisseur Brunsvic“ besitzt
das Braunschweiger Städtische Museum. Diese Umstände
lassen darauf schließen, daß die Stobwassersche Lack-
malerei wenigstens in ihren Anfängen mit der franzö-
sischen Lackierkunst, die von den Erfindern, den Ge-
brüdern (Vernis) Martin, ihren Namen hatte, in Berührung
steht. Georg Siegmund Stobwasser starb im Jahre 1776.
Sein Sohn Joh. Heinrich brachte das Braunschweiger
Institut zur glänzendsten Blüte. Eine große Zahl von Erzeug-
nissen, neben Dosen auch kleine Möbel, Tee- und Kaffee-
geschirr, Tabletts usw. besitzt das Braunschweiger Städtische
Museum. Im Jahre 1810 übergibt Joh. Heinrich die
Fabrik, der inzwischen eine Reihe von Konkurrenten —
W. Stockmann & Co., Ludwig Kragehus in Braunschweig,
Evers in Wolfenbuttel — erwachsen waren, seinem Sohne
Christian Heinrich. Dieser verkaufte sie 1832 an die
Fi^rna Meyer & Wried; im Jahre 1856 wurde die Dosen-
fabrikation eingestellt.
Die Filiale der Stobwasserschen Lackierfabrik in
Berlin, die den Mittelpunkt dieser Ausführungen bildet,
wurde begründet durch den genannten Vernisseur Jean
Guerin aus Cl£rmont in Argonne, der im Jahre 1767
eine Tochter Joh. Siegmund Stobwassers geheiratet hatte.
Bereits im Jahre 1766 hatte Friedrich der Große den
Lackierer Sebastian Chevalier, einen Franzosen,
Abb. 3. (Querschnitt.)
Abb. 4.
Zeichnung für einen lackgemalten Stuhl.
Aus dem Musterbuch der Stobwasserschen Fabrik.
136
stellungvonStob-
wasserarbeiten
aus dem Besitz
des Herrn Hans
Stobwasser, die
in diesem Som-
mer im Berliner
Kunstgewerbe-
museum statt-
fand, bot die
willkommene
Gelegenheit, von
den Arbeiten und
den Schicksalen
der Berliner
Stobwasser-Ma-
nufaktur eine ge-
nauere Vorstel-
lungzugewinnen.
Aufzeichnungen
und Papiere aus
dem Besitz der
Familie vermittel-
ten die Hauptda-
ten derGeschich-
te des Hauses.
Die Gründungs-
geschichte sowohl der Braunschweiger wie der Berliner
Fabrik bildet einen wertvollen Beitrag zum Bilde des
fürstlichen Monopol- und Privilegienwesens, wie es ja
aus der Geschichte der deutschen Porzellan- und Fa-
yencefabriken des 18. Jahrhunderts genügend bekannt ist.
Zwei um die deutsche Kunstindustrie hochverdiente
Fürsten standen als Schützer und Förderer über den An-
fängen der beiden Unternehmen. In Braunschweig der
als Gründer der Fürstenberger Porzellanfabrik bekannte
Herzog Carl 1. und in Berlin Friedrich der Große. Im
Jahre 1763 veranlaßte Herzog Carl den Lackfabrikanten
Joh. Siegmund Stobwasser aus Hof zur Errichtung einer
Lackierfabrik in Braunschweig (18. Mai). Joh. Sieg-
mund war im Jahre 1717 in Lobenstein im Vogtlande als
Sohn eines Glasers geboren; der Großvater Georg Stob-
wasser war aus Böhmen bei der Vertreibung der pro-
testantischen Hussiten 1620 ins Vogtland eingewandert.
Die ganze spätere Zeit daher blieben denn auch die
Stobwassers gläubige Anhänger der böhmischen Brüder-
gemeinde; so erklärt sich auch ihre spätere Familien-
verbindung mit der gleichfalls zu den Brüdern gehören-
den Familie des berühmten Kunsttischlers David Roentgen.
Gerade diese Brüderfamilien haben neben den Hugenotten
durch ihren Gewerbefleiß zu der Blüte des deutschen
Handwerks im 18. Jahrhundert beigetragen. Ursprünglich
Glaser wie sein Vater legte Joh. Siegmund im Jahre 1755
eine Lackierwarenfabrik in Lobenstein an, wo er zu-
sammen mit seinem Sohn, dem 1740 geborenen Joh.
Heinrich, vornehmlich einfache Dosen, Stöcke und
Becher für das Militär fertigte. Die ganze Familie, auch
Frau und Töchter nahmen an den Arbeiten teil, die dann
von Vater und
Sohn auf den
Märkten und in
den Feldlagern
verkauft wurden.
Auch in Braun-
schweig, wo sich
die Stobwasser
mit einer blumen-
gemalten Tisch-
platte beim Her-
zog empfahlen,
pflegten sie wohl
zunächst mehr
die Lackierung
von Gebrauchs-
gerät, so — wie
aus einem Privi-
leg vom 21. Mai
1764 erhellt —
die Überziehung
der Patronen-
taschen, Flinten,
Riemen und Ge-
wehrschäfte des
Leibregiments.
Ein Privileg Her-
zog Carls vom
Jahre 1771 verbietet nun den Musketieren Prevot und
Mellot — offenbar Franzosen — zu Gunsten Stobwassers
das Lackieren; ein anderer Musketier des Leibregiments
dagegen, Jean G u 6 r i n , Vernisseur aus C16rmont
in A'gönne trat in die Stobwassersche Fabrik ein; eine
Arbeit dieses Künstlers, eine viereckige Dose mit der
Goldinschrift: „Jean Guerin Vernisseur Brunsvic“ besitzt
das Braunschweiger Städtische Museum. Diese Umstände
lassen darauf schließen, daß die Stobwassersche Lack-
malerei wenigstens in ihren Anfängen mit der franzö-
sischen Lackierkunst, die von den Erfindern, den Ge-
brüdern (Vernis) Martin, ihren Namen hatte, in Berührung
steht. Georg Siegmund Stobwasser starb im Jahre 1776.
Sein Sohn Joh. Heinrich brachte das Braunschweiger
Institut zur glänzendsten Blüte. Eine große Zahl von Erzeug-
nissen, neben Dosen auch kleine Möbel, Tee- und Kaffee-
geschirr, Tabletts usw. besitzt das Braunschweiger Städtische
Museum. Im Jahre 1810 übergibt Joh. Heinrich die
Fabrik, der inzwischen eine Reihe von Konkurrenten —
W. Stockmann & Co., Ludwig Kragehus in Braunschweig,
Evers in Wolfenbuttel — erwachsen waren, seinem Sohne
Christian Heinrich. Dieser verkaufte sie 1832 an die
Fi^rna Meyer & Wried; im Jahre 1856 wurde die Dosen-
fabrikation eingestellt.
Die Filiale der Stobwasserschen Lackierfabrik in
Berlin, die den Mittelpunkt dieser Ausführungen bildet,
wurde begründet durch den genannten Vernisseur Jean
Guerin aus Cl£rmont in Argonne, der im Jahre 1767
eine Tochter Joh. Siegmund Stobwassers geheiratet hatte.
Bereits im Jahre 1766 hatte Friedrich der Große den
Lackierer Sebastian Chevalier, einen Franzosen,
Abb. 3. (Querschnitt.)
Abb. 4.
Zeichnung für einen lackgemalten Stuhl.
Aus dem Musterbuch der Stobwasserschen Fabrik.
136