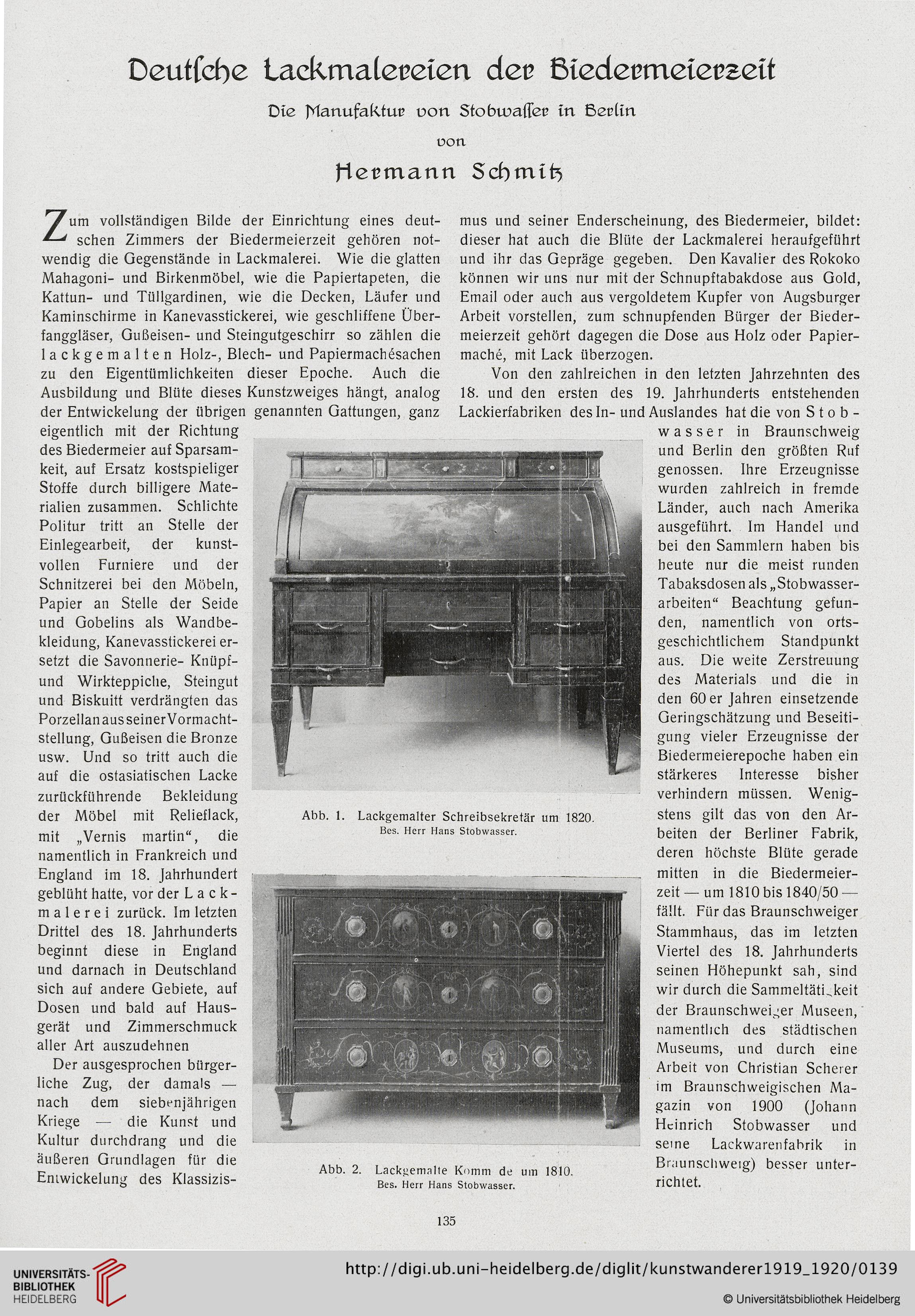Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 1.1919/20
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0139
DOI Heft:
1. Dezemberheft
DOI Artikel:Schmitz, Hermann: Deutsche Lackmalereien der Biedermeierzeit, [1]: die Manufaktur von Stobwasser in Berlin
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0139
Deutfebe tackmalcccien der BiedecmeiecEeit
Die Manufaktur uon Stobtuaflet? in Berlin
oon
ficcmann Scf)trufc)
Zum vollständigen Bilde der Einrichtung eines deut-
schen Zimmers der Biedermeierzeit gehören not-
wendig die Gegenstände in Lackmalerei. Wie die glatten
Mahagoni- und Birkenmöbel, wie die Papiertapeten, die
Kattun- und Tüllgardinen, wie die Decken, Läufer und
Kaminschirme in Kanevasstickerei, wie geschliffene Über-
fanggläser, Gußeisen- und Steingutgeschirr so zählen die
lackgemalten Holz-, Blech- und Papiermach6sachen
zu den Eigentümlichkeiten dieser Epoche. Auch die
Ausbildung und Blüte dieses Kunstzweiges hängt, analog
der Entwickelung der übrigen genannten Gattungen, ganz
eigentlich mit der Richtung
des Biedermeier auf Sparsam-
keit, auf Ersatz kostspieliger
Stoffe durch billigere Mate-
rialien zusammen. Schlichte
Politur tritt an Stelle der
Einlegearbeit, der kunst-
vollen Furniere und der
Schnitzerei bei den Möbeln,
Papier an Stelle der Seide
und Gobelins als Wandbe-
kleidung, Kanevasstickerei er-
setzt die Savonnerie- Knüpf-
und Wirkteppiche, Steingut
und Biskuitt verdrängten das
Porzellanaus seiner Vormacht-
stellung, Gußeisen die Bronze
usw. Und so tritt auch die
auf die ostasiatischen Lacke
zurückführende Bekleidung
der Möbel mit Relieflack,
mit „Vernis martin“, die
namentlich in Frankreich und
England im 18. Jahrhundert
geblüht hatte, vor der Lack-
malerei zurück. Im letzten
Drittel des 18. Jahrhunderts
beginnt diese in England
und darnach in Deutschland
sich auf andere Gebiete, auf
Dosen und bald auf Haus-
gerät und Zimmerschmuck
aller Art auszudehnen
Der ausgesprochen bürger-
liche Zug, der damals —
nach dem siebenjährigen
Kriege — die Kunst und
Kultur durchdrang und die
äußeren Grundlagen für die
Entwickelung des Klassizis-
mus und seiner Enderscheinung, des Biedermeier, bildet:
dieser hat auch die Blüte der Lackmalerei heraufgeführt
und ihr das Gepräge gegeben. Den Kavalier des Rokoko
können wir uns nur mit der Schnupftabakdose aus Gold,
Email oder auch aus vergoldetem Kupfer von Augsburger
Arbeit vorstellen, zum schnupfenden Bürger der Bieder-
meierzeit gehört dagegen die Dose aus Holz oder Papier-
mache, mit Lack überzogen.
Von den zahlreichen in den letzten Jahrzehnten des
18. und den ersten des 19. Jahrhunderts entstehenden
Lackierfabriken des ln- und Auslandes hat die von Stob-
wasser in Braunschweig
und Berlin den größten Ruf
genossen. Ihre Erzeugnisse
wurden zahlreich in fremde
Länder, auch nach Amerika
ausgeführt. Im Handel und
bei den Sammlern haben bis
heute nur die meist runden
Tabaksdosen als „Stobwasser-
arbeiten“ Beachtung gefun-
den, namentlich von orts-
geschichtlichem Standpunkt
aus. Die weite Zerstreuung
des Materials und die in
den 60 er Jahren einsetzende
Geringschätzung und Beseiti-
gung vieler Erzeugnisse der
Biedermeierepoche haben ein
stärkeres Interesse bisher
verhindern müssen. Wenig-
stens gilt das von den Ar-
beiten der Berliner Fabrik,
deren höchste Blüte gerade
mitten in die Biedermeier-
zeit — um 1810 bis 1840/50 —
fällt. Für das Braunschweiger
Stammhaus, das im letzten
Viertel des 18. Jahrhunderts
seinen Höhepunkt sah, sind
wir durch die Sammeltätigkeit
der Braunschweiger Museen,
namentlich des städtischen
Museums, und durch eine
Arbeit von Christian Scherer
im Braunschweigischen Ma-
gazin von 1900 (Johann
Heinrich Stobwasser und
seine Lackwarenfahrik in
Braunschweig) besser unter-
richtet.
Abb. 1. Lackgemalter Schreibsekretär um 1820.
Bes. Herr Hans Stobwasser.
Abb. 2. Lackgemnlte Komm de um 1810.
Bes. Herr Hans Stobwasser.
135
Die Manufaktur uon Stobtuaflet? in Berlin
oon
ficcmann Scf)trufc)
Zum vollständigen Bilde der Einrichtung eines deut-
schen Zimmers der Biedermeierzeit gehören not-
wendig die Gegenstände in Lackmalerei. Wie die glatten
Mahagoni- und Birkenmöbel, wie die Papiertapeten, die
Kattun- und Tüllgardinen, wie die Decken, Läufer und
Kaminschirme in Kanevasstickerei, wie geschliffene Über-
fanggläser, Gußeisen- und Steingutgeschirr so zählen die
lackgemalten Holz-, Blech- und Papiermach6sachen
zu den Eigentümlichkeiten dieser Epoche. Auch die
Ausbildung und Blüte dieses Kunstzweiges hängt, analog
der Entwickelung der übrigen genannten Gattungen, ganz
eigentlich mit der Richtung
des Biedermeier auf Sparsam-
keit, auf Ersatz kostspieliger
Stoffe durch billigere Mate-
rialien zusammen. Schlichte
Politur tritt an Stelle der
Einlegearbeit, der kunst-
vollen Furniere und der
Schnitzerei bei den Möbeln,
Papier an Stelle der Seide
und Gobelins als Wandbe-
kleidung, Kanevasstickerei er-
setzt die Savonnerie- Knüpf-
und Wirkteppiche, Steingut
und Biskuitt verdrängten das
Porzellanaus seiner Vormacht-
stellung, Gußeisen die Bronze
usw. Und so tritt auch die
auf die ostasiatischen Lacke
zurückführende Bekleidung
der Möbel mit Relieflack,
mit „Vernis martin“, die
namentlich in Frankreich und
England im 18. Jahrhundert
geblüht hatte, vor der Lack-
malerei zurück. Im letzten
Drittel des 18. Jahrhunderts
beginnt diese in England
und darnach in Deutschland
sich auf andere Gebiete, auf
Dosen und bald auf Haus-
gerät und Zimmerschmuck
aller Art auszudehnen
Der ausgesprochen bürger-
liche Zug, der damals —
nach dem siebenjährigen
Kriege — die Kunst und
Kultur durchdrang und die
äußeren Grundlagen für die
Entwickelung des Klassizis-
mus und seiner Enderscheinung, des Biedermeier, bildet:
dieser hat auch die Blüte der Lackmalerei heraufgeführt
und ihr das Gepräge gegeben. Den Kavalier des Rokoko
können wir uns nur mit der Schnupftabakdose aus Gold,
Email oder auch aus vergoldetem Kupfer von Augsburger
Arbeit vorstellen, zum schnupfenden Bürger der Bieder-
meierzeit gehört dagegen die Dose aus Holz oder Papier-
mache, mit Lack überzogen.
Von den zahlreichen in den letzten Jahrzehnten des
18. und den ersten des 19. Jahrhunderts entstehenden
Lackierfabriken des ln- und Auslandes hat die von Stob-
wasser in Braunschweig
und Berlin den größten Ruf
genossen. Ihre Erzeugnisse
wurden zahlreich in fremde
Länder, auch nach Amerika
ausgeführt. Im Handel und
bei den Sammlern haben bis
heute nur die meist runden
Tabaksdosen als „Stobwasser-
arbeiten“ Beachtung gefun-
den, namentlich von orts-
geschichtlichem Standpunkt
aus. Die weite Zerstreuung
des Materials und die in
den 60 er Jahren einsetzende
Geringschätzung und Beseiti-
gung vieler Erzeugnisse der
Biedermeierepoche haben ein
stärkeres Interesse bisher
verhindern müssen. Wenig-
stens gilt das von den Ar-
beiten der Berliner Fabrik,
deren höchste Blüte gerade
mitten in die Biedermeier-
zeit — um 1810 bis 1840/50 —
fällt. Für das Braunschweiger
Stammhaus, das im letzten
Viertel des 18. Jahrhunderts
seinen Höhepunkt sah, sind
wir durch die Sammeltätigkeit
der Braunschweiger Museen,
namentlich des städtischen
Museums, und durch eine
Arbeit von Christian Scherer
im Braunschweigischen Ma-
gazin von 1900 (Johann
Heinrich Stobwasser und
seine Lackwarenfahrik in
Braunschweig) besser unter-
richtet.
Abb. 1. Lackgemalter Schreibsekretär um 1820.
Bes. Herr Hans Stobwasser.
Abb. 2. Lackgemnlte Komm de um 1810.
Bes. Herr Hans Stobwasser.
135