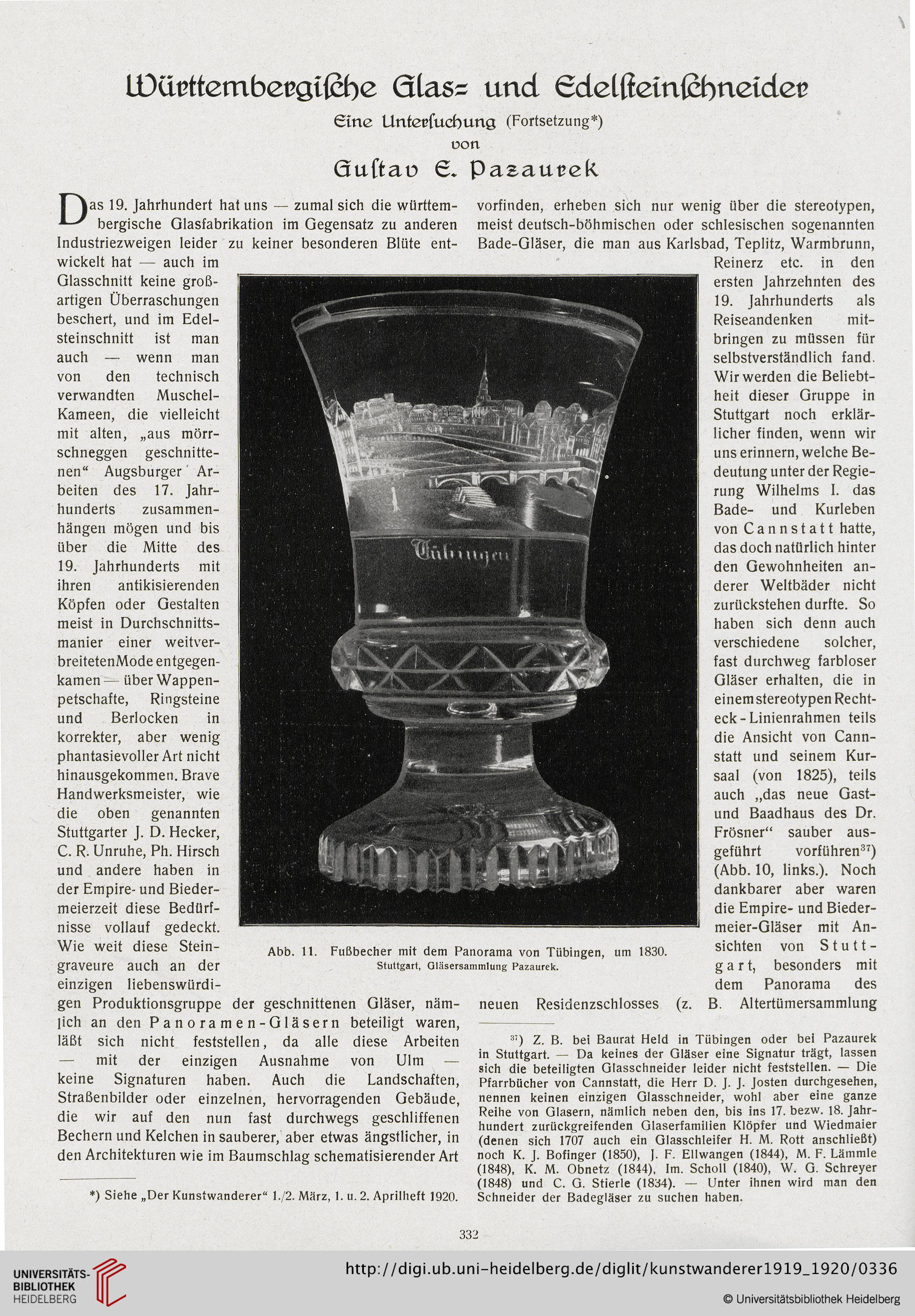Donath, Adolph [Editor]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 1.1919/20
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0336
DOI issue:
1. Maiheft
DOI article:Pazaurek, Gustav Edmund: Württembergische Glas- und Edelsteinschneider, [4]: eine Untersuchung
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0336
UXiettembecgißbe Glas= und 6delftemtcbnetd.ee
Sine Untet?fucbung (Fortsetzung*)
oon
öuftaü 6. Pasaut?ek
\as 19. Jahrhundert hat uns — zumal sich die württem-
bergische Glasfabrikation im Gegensatz zu anderen
Industriezweigen leider zu keiner besonderen Blüte ent-
wickelt hat — auch im
Glasschnitt keine groß-
artigen Überraschungen
beschert, und im Edel-
steinschnitt ist man
auch — wenn man
von den technisch
verwandten Muschel-
Kameen, die vielleicht
mit alten, „aus mörr-
schneggen geschnitte-
nen“ Augsburger' Ar-
beiten des 17. Jahr-
hunderts Zusammen-
hängen mögen und bis
über die Mitte des
19. Jahrhunderts mit
ihren antikisierenden
Köpfen oder Gestalten
meist in Durchschnitts-
manier einer weitver-
breitetenMode entgegen-
kamen— über Wappen-
petschafte, Ringsteine
und Berlocken in
korrekter, aber wenig
phantasievoller Art nicht
hinausgekommen. Brave
Handwerksmeister, wie
die oben genannten
Stuttgarter J. D. Hecker,
C. R. Unruhe, Ph. Hirsch
und andere haben in
der Empire- und Bieder-
meierzeit diese Bedürf-
nisse vollauf gedeckt.
Wie weit diese Stein-
graveure auch an der
einzigen liebenswürdi-
gen Produktionsgruppe der geschnittenen Gläser, näm-
lich an den Panoramen-Gläsern beteiligt waren,
läßt sich nicht feststellen, da alle diese Arbeiten
— mit der einzigen Ausnahme von Ulm —
keine Signaturen haben. Auch die Landschaften,
Straßenbilder oder einzelnen, hervorragenden Gebäude,
die wir auf den nun fast durchwegs geschliffenen
Bechern und Kelchen in sauberer, aber etwas ängstlicher, in
den Architekturen wie im Baumschlag schematisierender Art
*) Siehe „Der Kunstwanderer“ 1./2. März, 1. u. 2. Aprilheft 1920.
vorfinden, erheben sich nur wenig über die stereotypen,
meist deutsch-böhmischen oder schlesischen sogenannten
Bade-Gläser, die man aus Karlsbad, Teplitz, Warmbrunn,
Reinerz etc. in den
ersten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts als
Reiseandenken mit-
bringen zu müssen für
selbstverständlich fand.
Wir werden die Beliebt-
heit dieser Gruppe in
Stuttgart noch erklär-
licher finden, wenn wir
uns erinnern, welche Be-
deutung unter der Regie-
rung Wilhelms I. das
Bade- und Kurleben
von Cannstatt hatte,
das doch natürlich hinter
den Gewohnheiten an-
derer Weltbäder nicht
zurückstehen durfte. So
haben sich denn auch
verschiedene solcher,
fast durchweg farbloser
Gläser erhalten, die in
einem stereotypen Recht-
eck-Linienrahmen teils
die Ansicht von Cann-
statt und seinem Kur-
saal (von 1825), teils
auch „das neue Gast-
und Baadhaus des Dr.
Frösner“ sauber aus-
geführt vorführen37)
(Abb. 10, links.). Noch
dankbarer aber waren
die Empire- und Bieder-
meier-Gläser mit An-
sichten von Stutt-
gart, besonders mit
dem Panorama des
neuen Residenzschlosses (z. B. Altertümersammlung
3’) Z. B. bei Baurat Held in Tübingen oder bei Pazaurek
in Stuttgart. — Da keines der Gläser eine Signatur trägt, lassen
sich die beteiligten Glasschneider leider nicht feststellen. — Die
Pfarrbücher von Cannstatt, die Herr D. J. J. Josten durchgesehen,
nennen keinen einzigen Glasschneider, wohl aber eine ganze
Reihe von Glasern, nämlich neben den, bis ins 17. bezw. 18. Jahr-
hundert zurückgreifenden Glaserfamilien Klopfer und Wiedmaier
(denen sich 1707 auch ein Glasschleifer H. M. Rott anschließt)
noch K. J. Bofinger (1850), J. F. Ellwangen (1844), M. F. Lämmle
(1848), K. M. Obnetz (1844), Im. Scholl (1840), W. G. Schreyer
(1848) und C. G. Stierle (1884). — Unter ihnen wird man den
Schneider der Badegläser zu suchen haben.
332
Sine Untet?fucbung (Fortsetzung*)
oon
öuftaü 6. Pasaut?ek
\as 19. Jahrhundert hat uns — zumal sich die württem-
bergische Glasfabrikation im Gegensatz zu anderen
Industriezweigen leider zu keiner besonderen Blüte ent-
wickelt hat — auch im
Glasschnitt keine groß-
artigen Überraschungen
beschert, und im Edel-
steinschnitt ist man
auch — wenn man
von den technisch
verwandten Muschel-
Kameen, die vielleicht
mit alten, „aus mörr-
schneggen geschnitte-
nen“ Augsburger' Ar-
beiten des 17. Jahr-
hunderts Zusammen-
hängen mögen und bis
über die Mitte des
19. Jahrhunderts mit
ihren antikisierenden
Köpfen oder Gestalten
meist in Durchschnitts-
manier einer weitver-
breitetenMode entgegen-
kamen— über Wappen-
petschafte, Ringsteine
und Berlocken in
korrekter, aber wenig
phantasievoller Art nicht
hinausgekommen. Brave
Handwerksmeister, wie
die oben genannten
Stuttgarter J. D. Hecker,
C. R. Unruhe, Ph. Hirsch
und andere haben in
der Empire- und Bieder-
meierzeit diese Bedürf-
nisse vollauf gedeckt.
Wie weit diese Stein-
graveure auch an der
einzigen liebenswürdi-
gen Produktionsgruppe der geschnittenen Gläser, näm-
lich an den Panoramen-Gläsern beteiligt waren,
läßt sich nicht feststellen, da alle diese Arbeiten
— mit der einzigen Ausnahme von Ulm —
keine Signaturen haben. Auch die Landschaften,
Straßenbilder oder einzelnen, hervorragenden Gebäude,
die wir auf den nun fast durchwegs geschliffenen
Bechern und Kelchen in sauberer, aber etwas ängstlicher, in
den Architekturen wie im Baumschlag schematisierender Art
*) Siehe „Der Kunstwanderer“ 1./2. März, 1. u. 2. Aprilheft 1920.
vorfinden, erheben sich nur wenig über die stereotypen,
meist deutsch-böhmischen oder schlesischen sogenannten
Bade-Gläser, die man aus Karlsbad, Teplitz, Warmbrunn,
Reinerz etc. in den
ersten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts als
Reiseandenken mit-
bringen zu müssen für
selbstverständlich fand.
Wir werden die Beliebt-
heit dieser Gruppe in
Stuttgart noch erklär-
licher finden, wenn wir
uns erinnern, welche Be-
deutung unter der Regie-
rung Wilhelms I. das
Bade- und Kurleben
von Cannstatt hatte,
das doch natürlich hinter
den Gewohnheiten an-
derer Weltbäder nicht
zurückstehen durfte. So
haben sich denn auch
verschiedene solcher,
fast durchweg farbloser
Gläser erhalten, die in
einem stereotypen Recht-
eck-Linienrahmen teils
die Ansicht von Cann-
statt und seinem Kur-
saal (von 1825), teils
auch „das neue Gast-
und Baadhaus des Dr.
Frösner“ sauber aus-
geführt vorführen37)
(Abb. 10, links.). Noch
dankbarer aber waren
die Empire- und Bieder-
meier-Gläser mit An-
sichten von Stutt-
gart, besonders mit
dem Panorama des
neuen Residenzschlosses (z. B. Altertümersammlung
3’) Z. B. bei Baurat Held in Tübingen oder bei Pazaurek
in Stuttgart. — Da keines der Gläser eine Signatur trägt, lassen
sich die beteiligten Glasschneider leider nicht feststellen. — Die
Pfarrbücher von Cannstatt, die Herr D. J. J. Josten durchgesehen,
nennen keinen einzigen Glasschneider, wohl aber eine ganze
Reihe von Glasern, nämlich neben den, bis ins 17. bezw. 18. Jahr-
hundert zurückgreifenden Glaserfamilien Klopfer und Wiedmaier
(denen sich 1707 auch ein Glasschleifer H. M. Rott anschließt)
noch K. J. Bofinger (1850), J. F. Ellwangen (1844), M. F. Lämmle
(1848), K. M. Obnetz (1844), Im. Scholl (1840), W. G. Schreyer
(1848) und C. G. Stierle (1884). — Unter ihnen wird man den
Schneider der Badegläser zu suchen haben.
332