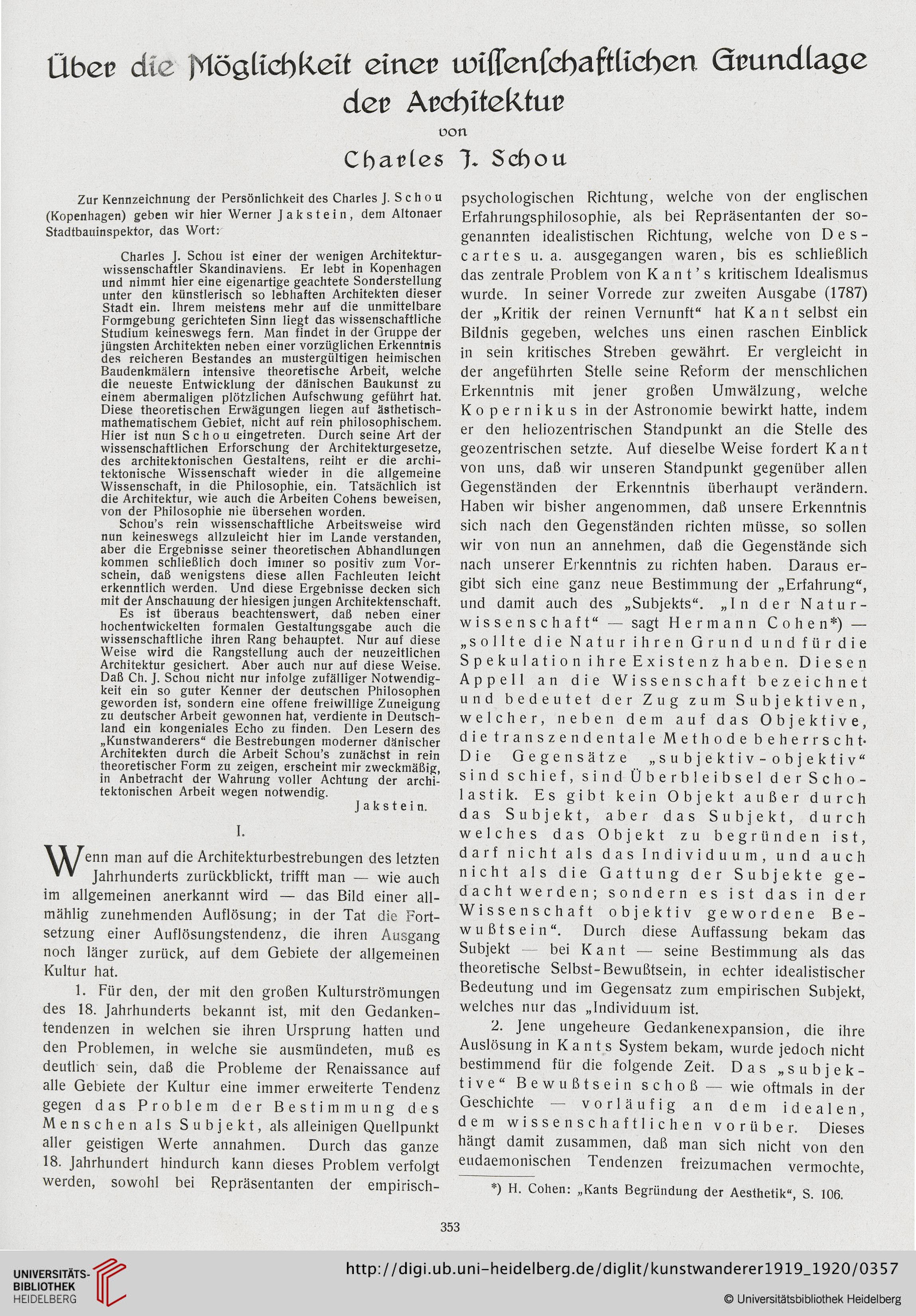Übet die jvlögltcbkeit einet lüiflenfcbaftticben Qeundlage
dev Avdbitektnv
von
Charles
Zur Kennzeichnung der Persönlichkeit des Charles J. S c h o u
(Kopenhagen) geben wir hier Werner Jak st ein, dem Altonaer
Stadtbauinspektor, das Wort:
Charles J. Schou ist einer der wenigen Architektur-
wissenschaftler Skandinaviens. Er lebt in Kopenhagen
und nimmt hier eine eigenartige geachtete Sonderstellung
unter den künstlerisch so lebhaften Architekten dieser
Stadt ein. Ihrem meistens mehr auf die unmittelbare
Formgebung gerichteten Sinn liegt das wissenschaftliche
Studium keineswegs fern. Man findet in der Gruppe der
jüngsten Architekten neben einer vorzüglichen Erkenntnis
des reicheren Bestandes an mustergültigen heimischen
Baudenkmälern intensive theoretische Arbeit, welche
die neueste Entwicklung der dänischen Baukunst zu
einem abermaligen plötzlichen Aufschwung geführt hat.
Diese theoretischen Erwägungen liegen auf ästhetisch-
mathematischem Gebiet, nicht auf rein philosophischem.
Hier ist nun Schou eingetreten. Durch seine Art der
wissenschaftlichen Erforschung der Architekturgesetze,
des architektonischen Gestaltens, reiht er die archi-
tektonische Wissenschaft wieder in die allgemeine
Wissenschaft, in die Philosophie, ein. Tatsächlich ist
die Architektur, wie auch die Arbeiten Cohens beweisen,
von der Philosophie nie übersehen worden.
Schou’s rein wissenschaftliche Arbeitsweise wird
nun keineswegs allzuleicht hier im Lande verstanden,
aber die Ergebnisse seiner theoretischen Abhandlungen
kommen schließlich doch immer so positiv zum Vor-
schein, daß wenigstens diese allen Fachleuten leicht
erkenntlich werden. Und diese Ergebnisse decken sich
mit der Anschauung der hiesigen jungen Architektenschaft.
Es ist überaus beachtenswert, daß neben einer
hochentwickelten formalen Gestaltungsgabe auch die
wissenschaftliche ihren Rang behauptet. Nur auf diese
Weise wird die Rangstellung auch der neuzeitlichen
Architektur gesichert. Aber auch nur auf diese Weise.
Daß Ch. J. Schou nicht nur infolge zufälliger Notwendig-
keit ein so guter Kenner der deutschen Philosophen
geworden ist, sondern eine offene freiwillige Zuneigung
zu deutscher Arbeit gewonnen hat, verdiente in Deutsch-
land ein kongeniales Echo zu finden. Den Lesern des
„Kunstwanderers“ die Bestrebungen moderner dänischer
Architekten durch die Arbeit Schou’s zunächst in rein
theoretischer Form zu zeigen, erscheint mir zweckmäßig,
in Anbetracht der Wahrung voller Achtung der archi-
tektonischen Arbeit wegen notwendig.
J a k s t e i n.
I.
\\/enn man au^ ^'e Architekturbestrebungen des letzten
* ’ Jahrhunderts zurückblickt, trifft man — wie auch
im allgemeinen anerkannt wird — das Bild einer all-
mählig zunehmenden Auflösung; in der Tat die Fort-
setzung einer Auflösungstendenz, die ihren Ausgang
noch länger zurück, auf dem Gebiete der allgemeinen
Kultur hat.
1. Für den, der mit den großen Kulturströmungen
des 18. Jahrhunderts bekannt ist, mit den Gedanken-
tendenzen in welchen sie ihren Ursprung hatten und
den Problemen, in welche sie ausmündeten, muß es
deutlich sein, daß die Probleme der Renaissance auf
alle Gebiete der Kultur eine immer erweiterte Tendenz
gegen das Problem der Bestimmung des
Menschen als Subjekt, als alleinigen Quellpunkt
aller geistigen Werte annahmen. Durch das ganze
18. Jahrhundert hindurch kann dieses Problem verfolgt
werden, sowohl bei Repräsentanten der empirisch-
7- Schou
psychologischen Richtung, welche von der englischen
Erfahrungsphilosophie, als bei Repräsentanten der so-
genannten idealistischen Richtung, welche von Des-
cartes u. a. ausgegangen waren, bis es schließlich
das zentrale Problem von Kant’s kritischem Idealismus
wurde. In seiner Vorrede zur zweiten Ausgabe (1787)
der „Kritik der reinen Vernunft“ hat Kant selbst ein
Bildnis gegeben, welches uns einen raschen Einblick
in sein kritisches Streben gewährt. Er vergleicht in
der angeführten Stelle seine Reform der menschlichen
Erkenntnis mit jener großen Umwälzung, welche
Kopernikus in der Astronomie bewirkt hatte, indem
er den heliozentrischen Standpunkt an die Stelle des
geozentrischen setzte. Auf dieselbe Weise fordert Kant
von uns, daß wir unseren Standpunkt gegenüber allen
Gegenständen der Erkenntnis überhaupt verändern.
Haben wir bisher angenommen, daß unsere Erkenntnis
sich nach den Gegenständen richten müsse, so sollen
wir von nun an annehmen, daß die Gegenstände sich
nach unserer Erkenntnis zu richten haben. Daraus er-
gibt sich eine ganz neue Bestimmung der „Erfahrung“,
und damit auch des „Subjekts“. „In der Natur-
wissenschaft“ — sagt Hermann Cohen*) —
„sollte die Natur ihren Grund und für die
Spekulation ihre Existenz haben. Diesen
Appell an die Wissenschaft bezeichnet
und bedeutet der Zug zum Subjektiven,
welcher, neben dem auf das Objektive,
die transzendentale Methode beherrscht-
Die Gegensätze „subjektiv-objektiv“
sind schief, sind Überbleibsel der Scho-
lastik. Es gibt kein Objekt außer durch
das Subjekt, aber das Subjekt, durch
welches das Objekt zu begründen ist,
darf nicht als das Individuum, und auch
nicht als die Gattung der Subjekte ge-
dachtwerden; sondern es ist das in der
Wissenschaft objektiv gewordene Be-
wußtsein“. Durch diese Auffassung bekam das
Subjekt — bei Kant — seine Bestimmung als das
theoretische Selbst-Bewußtsein, in echter idealistischer
Bedeutung und im Gegensatz zum empirischen Subjekt,
welches nur das „Individuum ist.
2. Jene ungeheure Gedankenexpansion, die ihre
Auslösung in Kants System bekam, wurde jedoch nicht
bestimmend für die folgende Zeit. Das „subjek-
tive“ Bewußtsein schoß — wie oftmals in der
Geschichte — vorläufig an dem idealen,
dem wissenschaftlichen vorüber. Dieses
hängt damit zusammen, daß man sich nicht von den
eudaemonischen Tendenzen freizumachen vermochte,
*) H. Cohen: „Kants Begründung der Aesthetik“, S. 106.
353
dev Avdbitektnv
von
Charles
Zur Kennzeichnung der Persönlichkeit des Charles J. S c h o u
(Kopenhagen) geben wir hier Werner Jak st ein, dem Altonaer
Stadtbauinspektor, das Wort:
Charles J. Schou ist einer der wenigen Architektur-
wissenschaftler Skandinaviens. Er lebt in Kopenhagen
und nimmt hier eine eigenartige geachtete Sonderstellung
unter den künstlerisch so lebhaften Architekten dieser
Stadt ein. Ihrem meistens mehr auf die unmittelbare
Formgebung gerichteten Sinn liegt das wissenschaftliche
Studium keineswegs fern. Man findet in der Gruppe der
jüngsten Architekten neben einer vorzüglichen Erkenntnis
des reicheren Bestandes an mustergültigen heimischen
Baudenkmälern intensive theoretische Arbeit, welche
die neueste Entwicklung der dänischen Baukunst zu
einem abermaligen plötzlichen Aufschwung geführt hat.
Diese theoretischen Erwägungen liegen auf ästhetisch-
mathematischem Gebiet, nicht auf rein philosophischem.
Hier ist nun Schou eingetreten. Durch seine Art der
wissenschaftlichen Erforschung der Architekturgesetze,
des architektonischen Gestaltens, reiht er die archi-
tektonische Wissenschaft wieder in die allgemeine
Wissenschaft, in die Philosophie, ein. Tatsächlich ist
die Architektur, wie auch die Arbeiten Cohens beweisen,
von der Philosophie nie übersehen worden.
Schou’s rein wissenschaftliche Arbeitsweise wird
nun keineswegs allzuleicht hier im Lande verstanden,
aber die Ergebnisse seiner theoretischen Abhandlungen
kommen schließlich doch immer so positiv zum Vor-
schein, daß wenigstens diese allen Fachleuten leicht
erkenntlich werden. Und diese Ergebnisse decken sich
mit der Anschauung der hiesigen jungen Architektenschaft.
Es ist überaus beachtenswert, daß neben einer
hochentwickelten formalen Gestaltungsgabe auch die
wissenschaftliche ihren Rang behauptet. Nur auf diese
Weise wird die Rangstellung auch der neuzeitlichen
Architektur gesichert. Aber auch nur auf diese Weise.
Daß Ch. J. Schou nicht nur infolge zufälliger Notwendig-
keit ein so guter Kenner der deutschen Philosophen
geworden ist, sondern eine offene freiwillige Zuneigung
zu deutscher Arbeit gewonnen hat, verdiente in Deutsch-
land ein kongeniales Echo zu finden. Den Lesern des
„Kunstwanderers“ die Bestrebungen moderner dänischer
Architekten durch die Arbeit Schou’s zunächst in rein
theoretischer Form zu zeigen, erscheint mir zweckmäßig,
in Anbetracht der Wahrung voller Achtung der archi-
tektonischen Arbeit wegen notwendig.
J a k s t e i n.
I.
\\/enn man au^ ^'e Architekturbestrebungen des letzten
* ’ Jahrhunderts zurückblickt, trifft man — wie auch
im allgemeinen anerkannt wird — das Bild einer all-
mählig zunehmenden Auflösung; in der Tat die Fort-
setzung einer Auflösungstendenz, die ihren Ausgang
noch länger zurück, auf dem Gebiete der allgemeinen
Kultur hat.
1. Für den, der mit den großen Kulturströmungen
des 18. Jahrhunderts bekannt ist, mit den Gedanken-
tendenzen in welchen sie ihren Ursprung hatten und
den Problemen, in welche sie ausmündeten, muß es
deutlich sein, daß die Probleme der Renaissance auf
alle Gebiete der Kultur eine immer erweiterte Tendenz
gegen das Problem der Bestimmung des
Menschen als Subjekt, als alleinigen Quellpunkt
aller geistigen Werte annahmen. Durch das ganze
18. Jahrhundert hindurch kann dieses Problem verfolgt
werden, sowohl bei Repräsentanten der empirisch-
7- Schou
psychologischen Richtung, welche von der englischen
Erfahrungsphilosophie, als bei Repräsentanten der so-
genannten idealistischen Richtung, welche von Des-
cartes u. a. ausgegangen waren, bis es schließlich
das zentrale Problem von Kant’s kritischem Idealismus
wurde. In seiner Vorrede zur zweiten Ausgabe (1787)
der „Kritik der reinen Vernunft“ hat Kant selbst ein
Bildnis gegeben, welches uns einen raschen Einblick
in sein kritisches Streben gewährt. Er vergleicht in
der angeführten Stelle seine Reform der menschlichen
Erkenntnis mit jener großen Umwälzung, welche
Kopernikus in der Astronomie bewirkt hatte, indem
er den heliozentrischen Standpunkt an die Stelle des
geozentrischen setzte. Auf dieselbe Weise fordert Kant
von uns, daß wir unseren Standpunkt gegenüber allen
Gegenständen der Erkenntnis überhaupt verändern.
Haben wir bisher angenommen, daß unsere Erkenntnis
sich nach den Gegenständen richten müsse, so sollen
wir von nun an annehmen, daß die Gegenstände sich
nach unserer Erkenntnis zu richten haben. Daraus er-
gibt sich eine ganz neue Bestimmung der „Erfahrung“,
und damit auch des „Subjekts“. „In der Natur-
wissenschaft“ — sagt Hermann Cohen*) —
„sollte die Natur ihren Grund und für die
Spekulation ihre Existenz haben. Diesen
Appell an die Wissenschaft bezeichnet
und bedeutet der Zug zum Subjektiven,
welcher, neben dem auf das Objektive,
die transzendentale Methode beherrscht-
Die Gegensätze „subjektiv-objektiv“
sind schief, sind Überbleibsel der Scho-
lastik. Es gibt kein Objekt außer durch
das Subjekt, aber das Subjekt, durch
welches das Objekt zu begründen ist,
darf nicht als das Individuum, und auch
nicht als die Gattung der Subjekte ge-
dachtwerden; sondern es ist das in der
Wissenschaft objektiv gewordene Be-
wußtsein“. Durch diese Auffassung bekam das
Subjekt — bei Kant — seine Bestimmung als das
theoretische Selbst-Bewußtsein, in echter idealistischer
Bedeutung und im Gegensatz zum empirischen Subjekt,
welches nur das „Individuum ist.
2. Jene ungeheure Gedankenexpansion, die ihre
Auslösung in Kants System bekam, wurde jedoch nicht
bestimmend für die folgende Zeit. Das „subjek-
tive“ Bewußtsein schoß — wie oftmals in der
Geschichte — vorläufig an dem idealen,
dem wissenschaftlichen vorüber. Dieses
hängt damit zusammen, daß man sich nicht von den
eudaemonischen Tendenzen freizumachen vermochte,
*) H. Cohen: „Kants Begründung der Aesthetik“, S. 106.
353