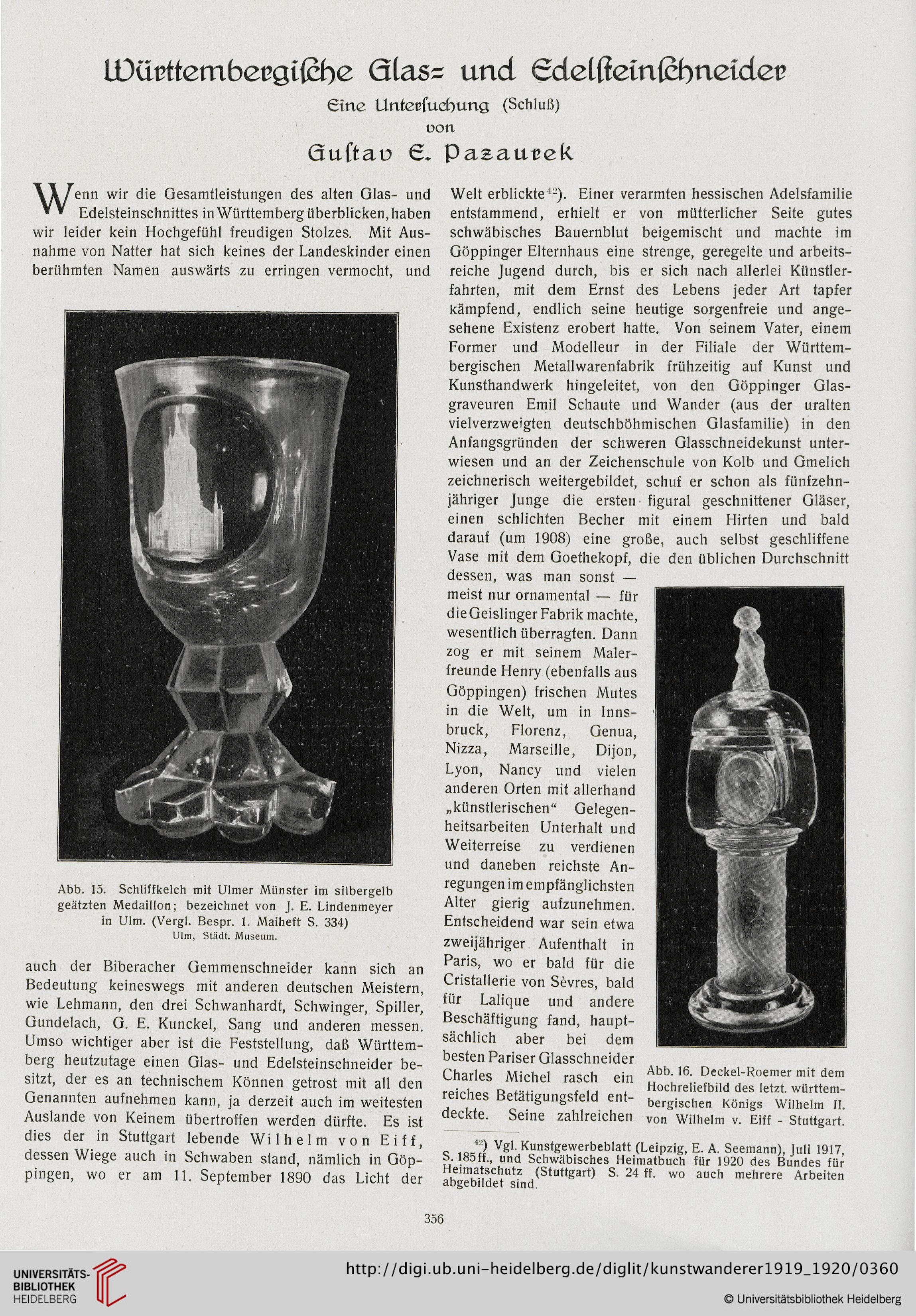Donath, Adolph [Editor]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 1.1919/20
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0360
DOI issue:
2. Maiheft
DOI article:Pazaurek, Gustav Edmund: Württembergische Glas- und Edelsteinschneider, [5]: eine Untersuchung
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0360
LDüüttembet?gt(cbe Qla.sc und Sdelßetntcbneidet?
€ine Untecfucbung (Schluß)
oon
Quftao 6. Pasauüek.
Wenn wir die Gesamtleistungen des alten Glas- und
Edelsteinschnittes in Württemberg Überblicken, haben
wir leider kein Hochgefühl freudigen Stolzes. Mit Aus-
nahme von Natter hat sich keines der Landeskinder einen
berühmten Namen auswärts zu erringen vermocht, und
Abb. 15. Schliffkelch mit Ulmer Münster im silbergelb
geätzten Medaillon; bezeichnet von J. E. Lindenmeyer
in Ulm. (Vergl. Bespr. 1. Maiheft S. 334)
Ulm, Stadt. Museum.
auch der Biberacher Gemmenschneider kann sich an
Bedeutung keineswegs mit anderen deutschen Meistern,
wie Lehmann, den drei Schwanhardt, Schwinger, Spiller,
Gundelach, G. E. Kunckel, Sang und anderen messen.
Umso wichtiger aber ist die Feststellung, daß Württem-
berg heutzutage einen Glas- und Edelsteinschneider be-
sitzt, der es an technischem Können getrost mit all den
Genannten aufnehmen kann, ja derzeit auch im weitesten
Auslande von Keinem übertroffen werden dürfte. Es ist
dies der in Stuttgart lebende Wilhelm von Eiff,
dessen Wiege auch in Schwaben stand, nämlich in Göp-
pingen, wo er am 11. September 1890 das Licht der
Welt erblickte4-). Einer verarmten hessischen Adelsfamilie
entstammend, erhielt er von mütterlicher Seite gutes
schwäbisches Bauernblut beigemischt und machte im
Göppinger Elternhaus eine strenge, geregelte und arbeits-
reiche Jugend durch, bis er sich nach allerlei Künstler-
fahrten, mit dem Ernst des Lebens jeder Art tapfer
kämpfend, endlich seine heutige sorgenfreie und ange-
sehene Existenz erobert hatte. Von seinem Vater, einem
Former und Modelleur in der Filiale der Württem-
bergischen Metallwarenfabrik frühzeitig auf Kunst und
Kunsthandwerk hingeleitet, von den Göppinger Glas-
graveuren Emil Schaute und Wander (aus der uralten
vielverzweigten deutschböhmischen Glasfamilie) in den
Anfangsgründen der schweren Glasschneidekunst unter-
wiesen und an der Zeichenschule von Kolb und Gmelich
zeichnerisch weitergebildet, schuf er schon als fünfzehn-
jähriger Junge die ersten figural geschnittener Gläser,
einen schlichten Becher mit einem Hirten und bald
darauf (um 1908) eine große, auch selbst geschliffene
Vase mit dem Goethekopf, die den üblichen Durchschnitt
dessen, was man sonst —
meist nur ornamental — für
dieGeislinger Fabrik machte,
wesentlich überragten. Dann
zog er mit seinem Maler-
freunde Henry (ebenfalls aus
Göppingen) frischen Mutes
in die Welt, um in Inns-
bruck, Florenz, Genua,
Nizza, Marseille, Dijon,
Lyon, Nancy und vielen
anderen Orten mit allerhand
„künstlerischen“ Gelegen-
heitsarbeiten Unterhalt und
Weiterreise zu verdienen
und daneben reichste An-
regungen im empfänglichsten
Alter gierig aufzunehmen.
Entscheidend war sein etwa
zweijähriger Aufenthalt in
Paris, wo er bald für die
Cristallerie von S£vres, bald
für Lalique und andere
Beschäftigung fand, haupt-
sächlich aber bei dem
besten Pariser Glasschneider
Charles Michel rasch ein Abb >6 Deckel-Roemer mit dem
. . ~ J##1. . , , , Hochreliefbild des letzt, wurttem-
reiches Betätigungsfeld ent- bergischen Königs Wilhelm ll.
deckte. Seine zahlreichen von Wilhelm v. Eiff - Stuttgart.
42) Vgl. Kunstgewerbeblatt (Leipzig, E. A. Seemann), Juli 1917,
S. 185ff., und Schwäbisches Heimatbuch für 1920 des Bundes für
Heimatschutz (Stuttgart) S. 24 ff. wo auch mehrere Arbeiten
abgebildet sind.
356
€ine Untecfucbung (Schluß)
oon
Quftao 6. Pasauüek.
Wenn wir die Gesamtleistungen des alten Glas- und
Edelsteinschnittes in Württemberg Überblicken, haben
wir leider kein Hochgefühl freudigen Stolzes. Mit Aus-
nahme von Natter hat sich keines der Landeskinder einen
berühmten Namen auswärts zu erringen vermocht, und
Abb. 15. Schliffkelch mit Ulmer Münster im silbergelb
geätzten Medaillon; bezeichnet von J. E. Lindenmeyer
in Ulm. (Vergl. Bespr. 1. Maiheft S. 334)
Ulm, Stadt. Museum.
auch der Biberacher Gemmenschneider kann sich an
Bedeutung keineswegs mit anderen deutschen Meistern,
wie Lehmann, den drei Schwanhardt, Schwinger, Spiller,
Gundelach, G. E. Kunckel, Sang und anderen messen.
Umso wichtiger aber ist die Feststellung, daß Württem-
berg heutzutage einen Glas- und Edelsteinschneider be-
sitzt, der es an technischem Können getrost mit all den
Genannten aufnehmen kann, ja derzeit auch im weitesten
Auslande von Keinem übertroffen werden dürfte. Es ist
dies der in Stuttgart lebende Wilhelm von Eiff,
dessen Wiege auch in Schwaben stand, nämlich in Göp-
pingen, wo er am 11. September 1890 das Licht der
Welt erblickte4-). Einer verarmten hessischen Adelsfamilie
entstammend, erhielt er von mütterlicher Seite gutes
schwäbisches Bauernblut beigemischt und machte im
Göppinger Elternhaus eine strenge, geregelte und arbeits-
reiche Jugend durch, bis er sich nach allerlei Künstler-
fahrten, mit dem Ernst des Lebens jeder Art tapfer
kämpfend, endlich seine heutige sorgenfreie und ange-
sehene Existenz erobert hatte. Von seinem Vater, einem
Former und Modelleur in der Filiale der Württem-
bergischen Metallwarenfabrik frühzeitig auf Kunst und
Kunsthandwerk hingeleitet, von den Göppinger Glas-
graveuren Emil Schaute und Wander (aus der uralten
vielverzweigten deutschböhmischen Glasfamilie) in den
Anfangsgründen der schweren Glasschneidekunst unter-
wiesen und an der Zeichenschule von Kolb und Gmelich
zeichnerisch weitergebildet, schuf er schon als fünfzehn-
jähriger Junge die ersten figural geschnittener Gläser,
einen schlichten Becher mit einem Hirten und bald
darauf (um 1908) eine große, auch selbst geschliffene
Vase mit dem Goethekopf, die den üblichen Durchschnitt
dessen, was man sonst —
meist nur ornamental — für
dieGeislinger Fabrik machte,
wesentlich überragten. Dann
zog er mit seinem Maler-
freunde Henry (ebenfalls aus
Göppingen) frischen Mutes
in die Welt, um in Inns-
bruck, Florenz, Genua,
Nizza, Marseille, Dijon,
Lyon, Nancy und vielen
anderen Orten mit allerhand
„künstlerischen“ Gelegen-
heitsarbeiten Unterhalt und
Weiterreise zu verdienen
und daneben reichste An-
regungen im empfänglichsten
Alter gierig aufzunehmen.
Entscheidend war sein etwa
zweijähriger Aufenthalt in
Paris, wo er bald für die
Cristallerie von S£vres, bald
für Lalique und andere
Beschäftigung fand, haupt-
sächlich aber bei dem
besten Pariser Glasschneider
Charles Michel rasch ein Abb >6 Deckel-Roemer mit dem
. . ~ J##1. . , , , Hochreliefbild des letzt, wurttem-
reiches Betätigungsfeld ent- bergischen Königs Wilhelm ll.
deckte. Seine zahlreichen von Wilhelm v. Eiff - Stuttgart.
42) Vgl. Kunstgewerbeblatt (Leipzig, E. A. Seemann), Juli 1917,
S. 185ff., und Schwäbisches Heimatbuch für 1920 des Bundes für
Heimatschutz (Stuttgart) S. 24 ff. wo auch mehrere Arbeiten
abgebildet sind.
356