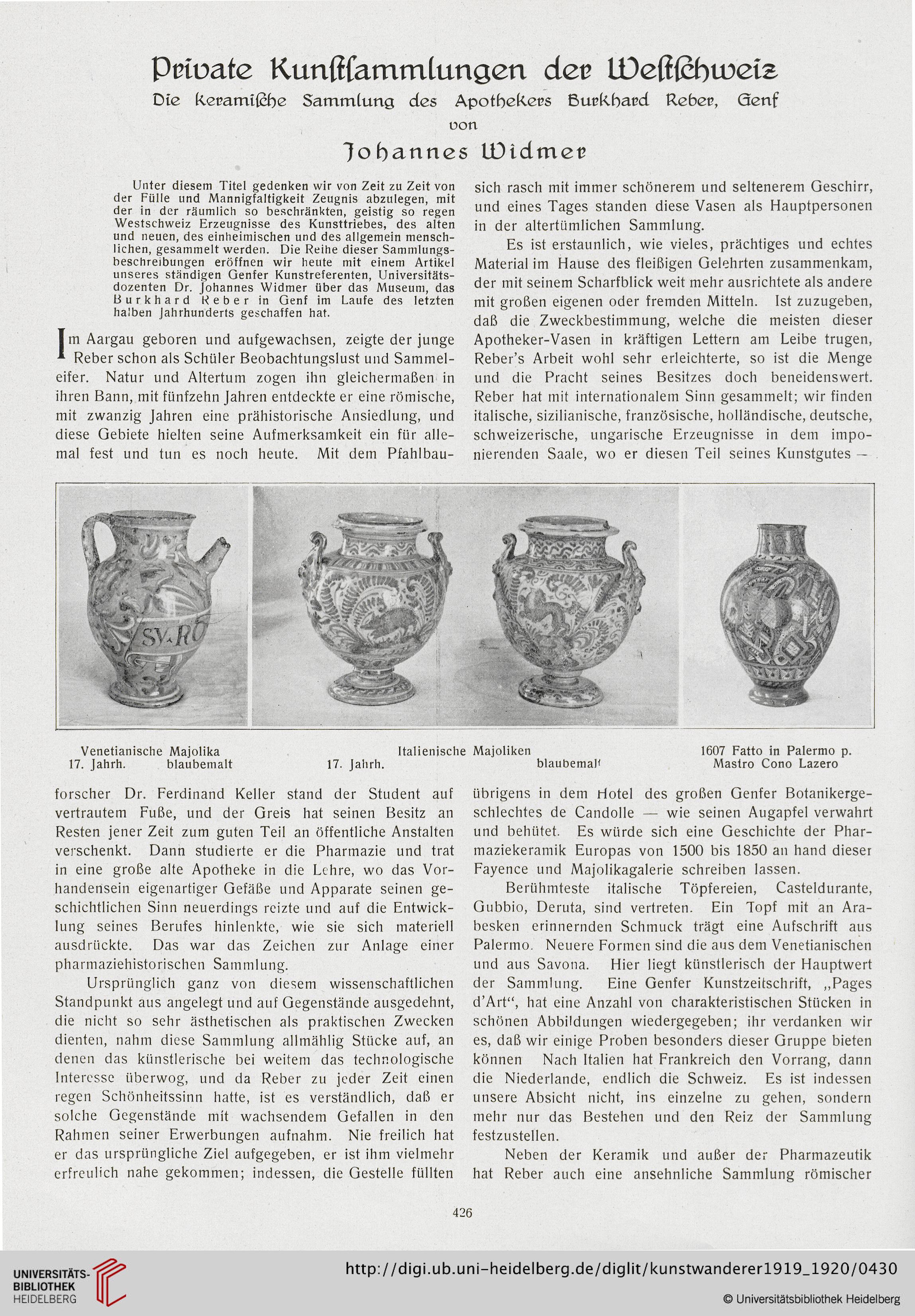Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 1.1919/20
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0430
DOI Heft:
1./2. Juliheft
DOI Artikel:Widmer, Johannes: Private Kunstsammlungen der Westschweiz: die keramische Sammlung des Apothekers Burkhard Reber, Genf
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0430
Ptnoate Kunfffammlutigen dev U3eßßbiüctE
Die kecamißbe Sammlung des Apotbeket?s But?kbat?d Rebet?, Genf
oon
lobannes lÜidmet?
Unter diesem Titel gedenken wir von Zeit zu Zeit von
der Fülle und Mannigfaltigkeit Zeugnis abzulegen, mit
der in der räumlich so beschränkten, geistig so regen
Westschweiz Erzeugnisse des Kunsttriebes, des alten
und neuen, des einheimischen und des allgemein mensch-
lichen, gesammelt werden. Die Reihe dieser Sammlungs-
beschreibungen eröffnen wir heute mit einem Artikel
unseres ständigen Genfer Kunstreferenten, Universitäts-
dozenten Dr. Johannes Widmer über das Museum, das
Burkhard Reber in Genf im Laufe des letzten
halben Jahrhunderts geschaffen hat.
I in Aargau geboren und aufgewachsen, zeigte der junge
* Reber schon als Schüler Beobachtungslust und Sammel-
eifer. Natur und Altertum zogen ihn gleichermaßen in
ihren Bann, mit fünfzehn Jahren entdeckte er eine römische,
mit zwanzig Jahren eine prähistorische Ansiedlung, und
diese Gebiete hielten seine Aufmerksamkeit ein für alle-
mal fest und tun es noch heute. Mit dem Pfahlbau-
sich rasch mit immer schönerem und seltenerem Geschirr,
und eines Tages standen diese Vasen als Hauptpersonen
in der altertümlichen Sammlung.
Es ist erstaunlich, wie vieles, prächtiges und echtes
Material im Hause des fleißigen Gelehrten zusammenkam,
der mit seinem Scharfblick weit mehr ausrichtete als andere
mit großen eigenen oder fremden Mitteln. Ist zuzugeben,
daß die Zweckbestimmung, welche die meisten dieser
Apotheker-Vasen in kräftigen Lettern am Leibe trugen,
Reber’s Arbeit wohl sehr erleichterte, so ist die Menge
und die Pracht seines Besitzes doch beneidenswert.
Reber hat mit internationalem Sinn gesammelt; wir finden
italische, sizilianische, französische, holländische, deutsche,
schweizerische, ungarische Erzeugnisse in dem impo-
nierenden Saale, wo er diesen Teil seines Kunstgutes —
Venetianische Majolika
17. Jahrh. blaubemalt
forscher Dr. Ferdinand Keller stand der Student auf
vertrautem Fuße, und der Greis hat seinen Besitz an
Resten jener Zeit zum guten Teil an öffentliche Anstalten
verschenkt. Dann studierte er die Pharmazie und trat
in eine große alte Apotheke in die Lehre, wo das Vor-
handensein eigenartiger Gefäße und Apparate seinen ge-
schichtlichen Sinn neuerdings reizte und auf die Entwick-
lung seines Berufes hinlenkte, wie sie sich materiell
ausdrückte. Das war das Zeichen zur Anlage einer
pharmaziehistorischen Sammlung.
Ursprünglich ganz von diesem wissenschaftlichen
Standpunkt aus angelegt und auf Gegenstände ausgedehnt,
die nicht so sehr ästhetischen als praktischen Zwecken
dienten, nahm diese Sammlung allmählig Stücke auf, an
denen das künstlerische bei weitem das technologische
Interesse iiberwog, und da Reber zu jeder Zeit einen
regen Schönheitssinn hatte, ist es verständlich, daß er
solche Gegenstände mit wachsendem Gefallen in den
Rahmen seiner Erwerbungen aufnahm. Nie freilich hat
er das ursprüngliche Ziel aufgegeben, er ist ihm vielmehr
erfreulich nahe gekommen; indessen, die Gestelle füllten
1607 Fatto in Palermo p.
Mastro Cono Lazero
übrigens in dem Hotel des großen Genfer Botanikerge-
schlechtes de Candolle — wie seinen Augapfel verwahrt
und behütet. Es würde sich eine Geschichte der Phar-
maziekeramik Europas von 1500 bis 1850 an hand dieser
Fayence und Majolikagalerie schreiben lassen.
Berühmteste italische Töpfereien, Casteldurante,
Gubbio, Deruta, sind vertreten. Ein Topf mit an Ara-
besken erinnernden Schmuck trägt eine Aufschrift aus
Palermo. Neuere Formen sind die aus dem Venetianischen
und aus Savona. Hier liegt künstlerisch der Hauptwert
der Sammlung. Eine Genfer Kunstzeitschrift, „Pages
d’Art“, hat eine Anzahl von charakteristischen Stücken in
schönen Abbildungen wiedergegeben; ihr verdanken wir
es, daß wir einige Proben besonders dieser Gruppe bieten
können Nach Italien hat Frankreich den Vorrang, dann
die Niederlande, endlich die Schweiz. Es ist indessen
unsere Absicht nicht, ins einzelne zu gehen, sondern
mehr nur das Bestehen und den Reiz der Sammlung
festzustellen.
Neben der Keramik und außer der Pharmazeutik
hat Reber auch eine ansehnliche Sammlung römischer
17. Jahrh.
Italienische Majoliken
blaubemah
426
Die kecamißbe Sammlung des Apotbeket?s But?kbat?d Rebet?, Genf
oon
lobannes lÜidmet?
Unter diesem Titel gedenken wir von Zeit zu Zeit von
der Fülle und Mannigfaltigkeit Zeugnis abzulegen, mit
der in der räumlich so beschränkten, geistig so regen
Westschweiz Erzeugnisse des Kunsttriebes, des alten
und neuen, des einheimischen und des allgemein mensch-
lichen, gesammelt werden. Die Reihe dieser Sammlungs-
beschreibungen eröffnen wir heute mit einem Artikel
unseres ständigen Genfer Kunstreferenten, Universitäts-
dozenten Dr. Johannes Widmer über das Museum, das
Burkhard Reber in Genf im Laufe des letzten
halben Jahrhunderts geschaffen hat.
I in Aargau geboren und aufgewachsen, zeigte der junge
* Reber schon als Schüler Beobachtungslust und Sammel-
eifer. Natur und Altertum zogen ihn gleichermaßen in
ihren Bann, mit fünfzehn Jahren entdeckte er eine römische,
mit zwanzig Jahren eine prähistorische Ansiedlung, und
diese Gebiete hielten seine Aufmerksamkeit ein für alle-
mal fest und tun es noch heute. Mit dem Pfahlbau-
sich rasch mit immer schönerem und seltenerem Geschirr,
und eines Tages standen diese Vasen als Hauptpersonen
in der altertümlichen Sammlung.
Es ist erstaunlich, wie vieles, prächtiges und echtes
Material im Hause des fleißigen Gelehrten zusammenkam,
der mit seinem Scharfblick weit mehr ausrichtete als andere
mit großen eigenen oder fremden Mitteln. Ist zuzugeben,
daß die Zweckbestimmung, welche die meisten dieser
Apotheker-Vasen in kräftigen Lettern am Leibe trugen,
Reber’s Arbeit wohl sehr erleichterte, so ist die Menge
und die Pracht seines Besitzes doch beneidenswert.
Reber hat mit internationalem Sinn gesammelt; wir finden
italische, sizilianische, französische, holländische, deutsche,
schweizerische, ungarische Erzeugnisse in dem impo-
nierenden Saale, wo er diesen Teil seines Kunstgutes —
Venetianische Majolika
17. Jahrh. blaubemalt
forscher Dr. Ferdinand Keller stand der Student auf
vertrautem Fuße, und der Greis hat seinen Besitz an
Resten jener Zeit zum guten Teil an öffentliche Anstalten
verschenkt. Dann studierte er die Pharmazie und trat
in eine große alte Apotheke in die Lehre, wo das Vor-
handensein eigenartiger Gefäße und Apparate seinen ge-
schichtlichen Sinn neuerdings reizte und auf die Entwick-
lung seines Berufes hinlenkte, wie sie sich materiell
ausdrückte. Das war das Zeichen zur Anlage einer
pharmaziehistorischen Sammlung.
Ursprünglich ganz von diesem wissenschaftlichen
Standpunkt aus angelegt und auf Gegenstände ausgedehnt,
die nicht so sehr ästhetischen als praktischen Zwecken
dienten, nahm diese Sammlung allmählig Stücke auf, an
denen das künstlerische bei weitem das technologische
Interesse iiberwog, und da Reber zu jeder Zeit einen
regen Schönheitssinn hatte, ist es verständlich, daß er
solche Gegenstände mit wachsendem Gefallen in den
Rahmen seiner Erwerbungen aufnahm. Nie freilich hat
er das ursprüngliche Ziel aufgegeben, er ist ihm vielmehr
erfreulich nahe gekommen; indessen, die Gestelle füllten
1607 Fatto in Palermo p.
Mastro Cono Lazero
übrigens in dem Hotel des großen Genfer Botanikerge-
schlechtes de Candolle — wie seinen Augapfel verwahrt
und behütet. Es würde sich eine Geschichte der Phar-
maziekeramik Europas von 1500 bis 1850 an hand dieser
Fayence und Majolikagalerie schreiben lassen.
Berühmteste italische Töpfereien, Casteldurante,
Gubbio, Deruta, sind vertreten. Ein Topf mit an Ara-
besken erinnernden Schmuck trägt eine Aufschrift aus
Palermo. Neuere Formen sind die aus dem Venetianischen
und aus Savona. Hier liegt künstlerisch der Hauptwert
der Sammlung. Eine Genfer Kunstzeitschrift, „Pages
d’Art“, hat eine Anzahl von charakteristischen Stücken in
schönen Abbildungen wiedergegeben; ihr verdanken wir
es, daß wir einige Proben besonders dieser Gruppe bieten
können Nach Italien hat Frankreich den Vorrang, dann
die Niederlande, endlich die Schweiz. Es ist indessen
unsere Absicht nicht, ins einzelne zu gehen, sondern
mehr nur das Bestehen und den Reiz der Sammlung
festzustellen.
Neben der Keramik und außer der Pharmazeutik
hat Reber auch eine ansehnliche Sammlung römischer
17. Jahrh.
Italienische Majoliken
blaubemah
426