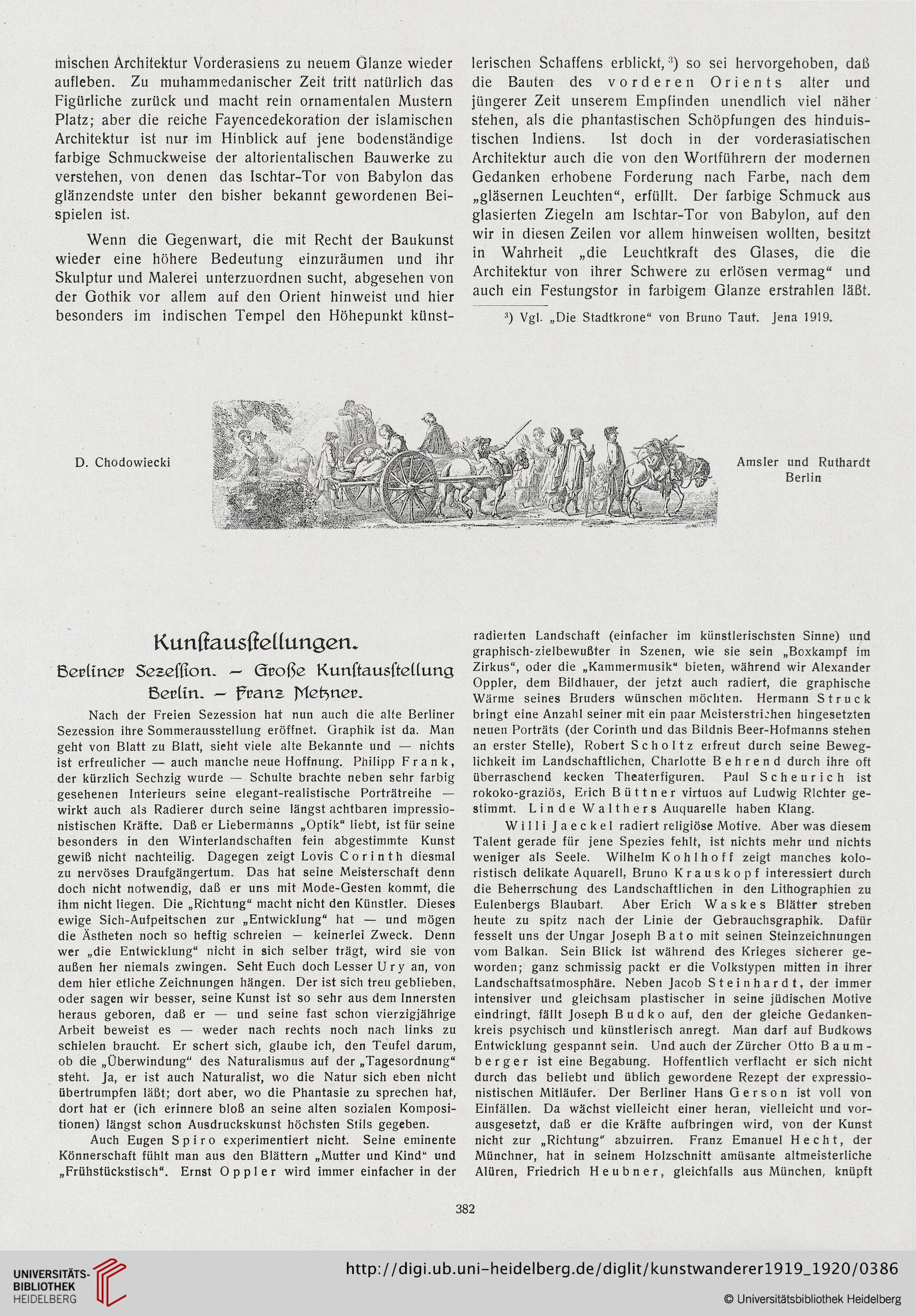mischen Architektur Vorderasiens zu neuem Glanze wieder
aufleben. Zu muhammedanischer Zeit tritt natürlich das
Figürliche zurück und macht rein ornamentalen Mustern
Platz; aber die reiche Fayencedekoration der islamischen
Architektur ist nur im Hinblick auf jene bodenständige
farbige Schmuckweise der altorientalischen Bauwerke zu
verstehen, von denen das Ischtar-Tor von Babylon das
glänzendste unter den bisher bekannt gewordenen Bei-
spielen ist.
Wenn die Gegenwart, die mit Recht der Baukunst
wieder eine höhere Bedeutung einzuräumen und ihr
Skulptur und Malerei unterzuordnen sucht, abgesehen von
der Gothik vor allem auf den Orient hinweist und hier
besonders im indischen Tempel den Höhepunkt künst-
lerischen Schaffens erblickt, '1) so sei hervorgehoben, daß
die Bauten des vorderen Orients alter und
jüngerer Zeit unserem Empfinden unendlich viel näher
stehen, als die phantastischen Schöpfungen des hinduis-
tischen Indiens. Ist doch in der vorderasiatischen
Architektur auch die von den Wortführern der modernen
Gedanken erhobene Forderung nach Farbe, nach dem
„gläsernen Leuchten“, erfüllt. Der farbige Schmuck aus
glasierten Ziegeln am Ischtar-Tor von Babylon, auf den
wir in diesen Zeilen vor allem hinweisen wollten, besitzt
in Wahrheit „die Leuchtkraft des Glases, die die
Architektur von ihrer Schwere zu erlösen vermag“ und
auch ein Festungstor in farbigem Glanze erstrahlen läßt.
:!) Vgl. „Die Stadtkrone“ von Bruno Taut. Jena 1919.
Kunftausßellu n^eru
BccUnet? Sesefltoru — Große Kunftausftetlung
Berlin. — frans JMet^ner.
Nach der Freien Sezession hat nun auch die alte Berliner
Sezession ihre Sommerausstellung eröffnet. Graphik ist da. Man
geht von Blatt zu Blatt, sieht viele alte Bekannte und — nichts
ist erfreulicher — auch manche neue Hoffnung. Philipp Frank,
der kürzlich Sechzig wurde — Schulte brachte neben sehr farbig
gesehenen Interieurs seine elegant-realistische Porträtreihe —
wirkt auch als Radierer durch seine längst achtbaren impressio-
nistischen Kräfte. Daß er Liebermanns „Optik“ liebt, ist für seine
besonders in den Winterlandschaften fein abgestimmte Kunst
gewiß nicht nachteilig. Dagegen zeigt Lovis C o r i n t h diesmal
zu nervöses Draufgängertum. Das hat seine Meisterschaft denn
doch nicht notwendig, daß er uns mit Mode-Gesten kommt, die
ihm nicht liegen. Die „Richtung“ macht nicht den Künstler. Dieses
ewige Sich-Aufpeitschen zur „Entwicklung“ hat — und mögen
die Ästheten noch so heftig schreien — keinerlei Zweck. Denn
wer „die Entwicklung“ nicht in sich selber trägt, wird sie von
außen her niemals zwingen. Seht Euch doch Lesser Ury an, von
dem hier etliche Zeichnungen hängen. Der ist sich treu geblieben,
oder sagen wir besser, seine Kunst ist so sehr aus dem Innersten
heraus geboren, daß er — und seine fast schon vierzigjährige
Arbeit beweist es — weder nach rechts noch nach links zu
schielen braucht. Er schert sich, glaube ich, den Teufel darum,
ob die „Überwindung“ des Naturalismus auf der „Tagesordnung“
steht. Ja, er ist auch Naturalist, wo die Natur sich eben nicht
übertrumpfen läßt; dort aber, wo die Phantasie zu sprechen hat,
dort hat er (ich erinnere bloß an seine alten sozialen Komposi-
tionen) längst schon Ausdruckskunst höchsten Stils gegeben.
Auch Eugen Spiro experimentiert nicht. Seine eminente
Könnerschaft fühlt man aus den Blättern „Mutter und Kind“ und
„Frühstückstisch“. Ernst O p p 1 e r wird immer einfacher in der
radierten Landschaft (einfacher im künstlerischsten Sinne) und
graphisch-zielbewußter in Szenen, wie sie sein „Boxkampf im
Zirkus“, oder die „Kammermusik“ bieten, während wir Alexander
Oppler, dem Bildhauer, der jetzt auch radiert, die graphische
Wärme seines Bruders wünschen möchten. Hermann Struck
bringt eine Anzahl seiner mit ein paar Meisterstrichen hingesetzten
neuen Porträts (der Corinth und das Bildnis Beer-Hofmanns stehen
an erster Stelle), Robert Scholtz erfreut durch seine Beweg-
lichkeit im Landschaftlichen, Charlotte B ehrend durch ihre oft
überraschend kecken Theaterfiguren. Paul Scheurich ist
rokoko-graziös, Erich Büttner virtuos auf Ludwig Richter ge-
stimmt. Linde W a 11 h e r s Auquarelle haben Klang.
Willi Jaeckel radiert religiöse Motive. Aber was diesem
Talent gerade für jene Spezies fehlt, ist nichts mehr und nichts
weniger als Seele. Wilhelm Kohl ho ff zeigt manches kolo-
ristisch delikate Aquarell, Bruno Krauskopf interessiert durch
die Beherrschung des Landschaftlichen in den Lithographien zu
Eulenbergs Blaubart. Aber Erich Waskes Blätter streben
heute zu spitz nach der Linie der Gebrauchsgraphik. Dafür
fesselt uns der Ungar Joseph Bato mit seinen Steinzeichnungen
vom Balkan. Sein Blick ist während des Krieges sicherer ge-
worden; ganz schmissig packt er die Volkstypen mitten in ihrer
Landschaftsatmosphäre. Neben Jacob Steinhardt, der immer
intensiver und gleichsam plastischer in seine jüdischen Motive
eindringt, fällt Joseph Budko auf, den der gleiche Gedanken-
kreis psychisch und künstlerisch anregt. Man darf auf Budkows
Entwicklung gespannt sein. Und auch der Zürcher Otto Baum -
berger ist eine Begabung. Hoffentlich verflacht er sich nicht
durch das beliebt und üblich gewordene Rezept der expressio-
nistischen Mitläufer. Der Berliner Hans Gerson ist voll von
Einfällen. Da wächst vielleicht einer heran, vielleicht und vor-
ausgesetzt, daß er die Kräfte aufbringen wird, von der Kunst
nicht zur „Richtung" abzuirren. Franz Emanuel Hecht, der
Münchner, hat in seinem Holzschnitt amüsante altmeisterliche
Alüren, Friedrich Heubner, gleichfalls aus München, knüpft
382
aufleben. Zu muhammedanischer Zeit tritt natürlich das
Figürliche zurück und macht rein ornamentalen Mustern
Platz; aber die reiche Fayencedekoration der islamischen
Architektur ist nur im Hinblick auf jene bodenständige
farbige Schmuckweise der altorientalischen Bauwerke zu
verstehen, von denen das Ischtar-Tor von Babylon das
glänzendste unter den bisher bekannt gewordenen Bei-
spielen ist.
Wenn die Gegenwart, die mit Recht der Baukunst
wieder eine höhere Bedeutung einzuräumen und ihr
Skulptur und Malerei unterzuordnen sucht, abgesehen von
der Gothik vor allem auf den Orient hinweist und hier
besonders im indischen Tempel den Höhepunkt künst-
lerischen Schaffens erblickt, '1) so sei hervorgehoben, daß
die Bauten des vorderen Orients alter und
jüngerer Zeit unserem Empfinden unendlich viel näher
stehen, als die phantastischen Schöpfungen des hinduis-
tischen Indiens. Ist doch in der vorderasiatischen
Architektur auch die von den Wortführern der modernen
Gedanken erhobene Forderung nach Farbe, nach dem
„gläsernen Leuchten“, erfüllt. Der farbige Schmuck aus
glasierten Ziegeln am Ischtar-Tor von Babylon, auf den
wir in diesen Zeilen vor allem hinweisen wollten, besitzt
in Wahrheit „die Leuchtkraft des Glases, die die
Architektur von ihrer Schwere zu erlösen vermag“ und
auch ein Festungstor in farbigem Glanze erstrahlen läßt.
:!) Vgl. „Die Stadtkrone“ von Bruno Taut. Jena 1919.
Kunftausßellu n^eru
BccUnet? Sesefltoru — Große Kunftausftetlung
Berlin. — frans JMet^ner.
Nach der Freien Sezession hat nun auch die alte Berliner
Sezession ihre Sommerausstellung eröffnet. Graphik ist da. Man
geht von Blatt zu Blatt, sieht viele alte Bekannte und — nichts
ist erfreulicher — auch manche neue Hoffnung. Philipp Frank,
der kürzlich Sechzig wurde — Schulte brachte neben sehr farbig
gesehenen Interieurs seine elegant-realistische Porträtreihe —
wirkt auch als Radierer durch seine längst achtbaren impressio-
nistischen Kräfte. Daß er Liebermanns „Optik“ liebt, ist für seine
besonders in den Winterlandschaften fein abgestimmte Kunst
gewiß nicht nachteilig. Dagegen zeigt Lovis C o r i n t h diesmal
zu nervöses Draufgängertum. Das hat seine Meisterschaft denn
doch nicht notwendig, daß er uns mit Mode-Gesten kommt, die
ihm nicht liegen. Die „Richtung“ macht nicht den Künstler. Dieses
ewige Sich-Aufpeitschen zur „Entwicklung“ hat — und mögen
die Ästheten noch so heftig schreien — keinerlei Zweck. Denn
wer „die Entwicklung“ nicht in sich selber trägt, wird sie von
außen her niemals zwingen. Seht Euch doch Lesser Ury an, von
dem hier etliche Zeichnungen hängen. Der ist sich treu geblieben,
oder sagen wir besser, seine Kunst ist so sehr aus dem Innersten
heraus geboren, daß er — und seine fast schon vierzigjährige
Arbeit beweist es — weder nach rechts noch nach links zu
schielen braucht. Er schert sich, glaube ich, den Teufel darum,
ob die „Überwindung“ des Naturalismus auf der „Tagesordnung“
steht. Ja, er ist auch Naturalist, wo die Natur sich eben nicht
übertrumpfen läßt; dort aber, wo die Phantasie zu sprechen hat,
dort hat er (ich erinnere bloß an seine alten sozialen Komposi-
tionen) längst schon Ausdruckskunst höchsten Stils gegeben.
Auch Eugen Spiro experimentiert nicht. Seine eminente
Könnerschaft fühlt man aus den Blättern „Mutter und Kind“ und
„Frühstückstisch“. Ernst O p p 1 e r wird immer einfacher in der
radierten Landschaft (einfacher im künstlerischsten Sinne) und
graphisch-zielbewußter in Szenen, wie sie sein „Boxkampf im
Zirkus“, oder die „Kammermusik“ bieten, während wir Alexander
Oppler, dem Bildhauer, der jetzt auch radiert, die graphische
Wärme seines Bruders wünschen möchten. Hermann Struck
bringt eine Anzahl seiner mit ein paar Meisterstrichen hingesetzten
neuen Porträts (der Corinth und das Bildnis Beer-Hofmanns stehen
an erster Stelle), Robert Scholtz erfreut durch seine Beweg-
lichkeit im Landschaftlichen, Charlotte B ehrend durch ihre oft
überraschend kecken Theaterfiguren. Paul Scheurich ist
rokoko-graziös, Erich Büttner virtuos auf Ludwig Richter ge-
stimmt. Linde W a 11 h e r s Auquarelle haben Klang.
Willi Jaeckel radiert religiöse Motive. Aber was diesem
Talent gerade für jene Spezies fehlt, ist nichts mehr und nichts
weniger als Seele. Wilhelm Kohl ho ff zeigt manches kolo-
ristisch delikate Aquarell, Bruno Krauskopf interessiert durch
die Beherrschung des Landschaftlichen in den Lithographien zu
Eulenbergs Blaubart. Aber Erich Waskes Blätter streben
heute zu spitz nach der Linie der Gebrauchsgraphik. Dafür
fesselt uns der Ungar Joseph Bato mit seinen Steinzeichnungen
vom Balkan. Sein Blick ist während des Krieges sicherer ge-
worden; ganz schmissig packt er die Volkstypen mitten in ihrer
Landschaftsatmosphäre. Neben Jacob Steinhardt, der immer
intensiver und gleichsam plastischer in seine jüdischen Motive
eindringt, fällt Joseph Budko auf, den der gleiche Gedanken-
kreis psychisch und künstlerisch anregt. Man darf auf Budkows
Entwicklung gespannt sein. Und auch der Zürcher Otto Baum -
berger ist eine Begabung. Hoffentlich verflacht er sich nicht
durch das beliebt und üblich gewordene Rezept der expressio-
nistischen Mitläufer. Der Berliner Hans Gerson ist voll von
Einfällen. Da wächst vielleicht einer heran, vielleicht und vor-
ausgesetzt, daß er die Kräfte aufbringen wird, von der Kunst
nicht zur „Richtung" abzuirren. Franz Emanuel Hecht, der
Münchner, hat in seinem Holzschnitt amüsante altmeisterliche
Alüren, Friedrich Heubner, gleichfalls aus München, knüpft
382