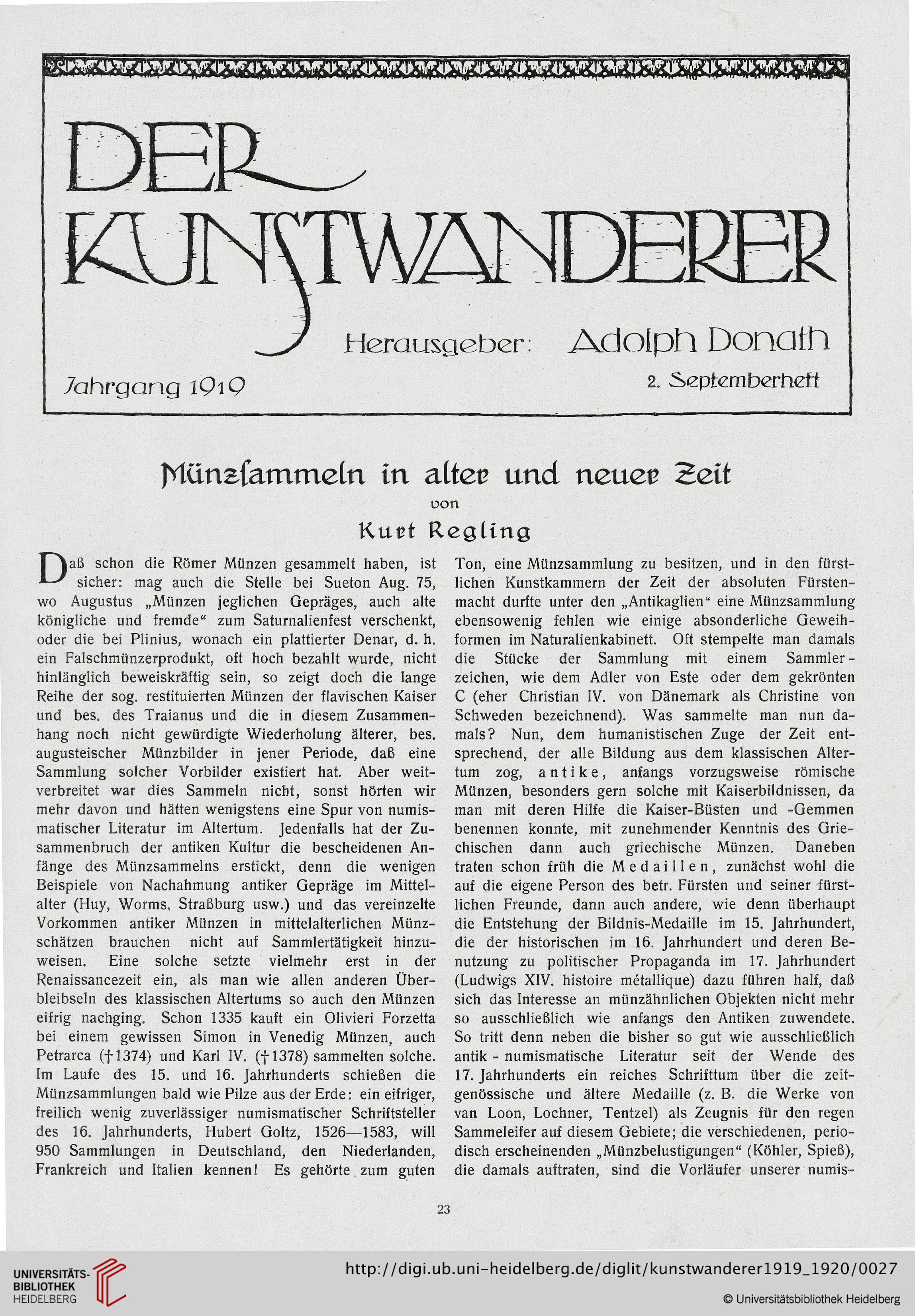Herausgeber: /vdolpfl DOHQtfl
7ahrgang 1Q1Q 2- ^eptemberlreft
MClriEfammetn in alter und neuer 2ett
oon
Kuüt Regltng
U\aß schon die Römer Münzen gesammelt haben, ist
sicher: mag auch die Stelle bei Sueton Aug. 75,
wo Augustus „Münzen jeglichen Gepräges, auch alte
königliche und fremde“ zum Saturnalienfest verschenkt,
oder die bei Plinius, wonach ein plattierter Denar, d. h.
ein Falschmünzerprodukt, oft hoch bezahlt wurde, nicht
hinlänglich beweiskräftig sein, so zeigt doch die lange
Reihe der sog. restituierten Münzen der flavischen Kaiser
und bes. des Traianus und die in diesem Zusammen-
hang noch nicht gewürdigte Wiederholung älterer, bes.
augusteischer Münzbilder in jener Periode, daß eine
Sammlung solcher Vorbilder existiert hat. Aber weit-
verbreitet war dies Sammeln nicht, sonst hörten wir
mehr davon und hätten wenigstens eine Spur von numis-
matischer Literatur im Altertum. Jedenfalls hat der Zu-
sammenbruch der antiken Kultur die bescheidenen An-
fänge des Münzsammelns erstickt, denn die wenigen
Beispiele von Nachahmung antiker Gepräge im Mittel-
alter (Huy, Worms, Straßburg usw.) und das vereinzelte
Vorkommen antiker Münzen in mittelalterlichen Münz-
schätzen brauchen nicht auf Sammlertätigkeit hinzu-
weisen. Eine solche setzte vielmehr erst in der
Renaissancezeit ein, als man wie allen anderen Über-
bleibseln des klassischen Altertums so auch den Münzen
eifrig nachging. Schon 1335 kauft ein Olivieri Forzetta
bei einem gewissen Simon in Venedig Münzen, auch
Petrarca (fl374) und Karl IV. (f 1378) sammelten solche.
Im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts schießen die
Münzsammlungen bald wie Pilze aus der Erde: ein eifriger,
freilich wenig zuverlässiger numismatischer Schriftsteller
des 16. Jahrhunderts, Hubert Goltz, 1526—1583, will
950 Sammlungen in Deutschland, den Niederlanden,
Frankreich und Italien kennen! Es gehörte zum guten
Ton, eine Münzsammlung zu besitzen, und in den fürst-
lichen Kunstkammern der Zeit der absoluten Fürsten-
macht durfte unter den „Antikaglien“ eine Münzsammlung
ebensowenig fehlen wie einige absonderliche Geweih-
formen im Naturalienkabinett. Oft stempelte man damals
die Stücke der Sammlung mit einem Sammler-
Zeichen, wie dem Adler von Este oder dem gekrönten
C (eher Christian IV. von Dänemark als Christine von
Schweden bezeichnend). Was sammelte man nun da-
mals? Nun, dem humanistischen Zuge der Zeit ent-
sprechend, der alle Bildung aus dem klassischen Alter-
tum zog, antike, anfangs vorzugsweise römische
Münzen, besonders gern solche mit Kaiserbildnissen, da
man mit deren Hilfe die Kaiser-Büsten und -Gemmen
benennen konnte, mit zunehmender Kenntnis des Grie-
chischen dann auch griechische Münzen. Daneben
traten schon früh die Medaillen, zunächst wohl die
auf die eigene Person des betr. Fürsten und seiner fürst-
lichen Freunde, dann auch andere, wie denn überhaupt
die Entstehung der Bildnis-Medaille im 15. Jahrhundert,
die der historischen im 16. Jahrhundert und deren Be-
nutzung zu politischer Propaganda im 17. Jahrhundert
(Ludwigs XIV. histoire metallique) dazu führen half, daß
sich das Interesse an münzähnlichen Objekten nicht mehr
so ausschließlich wie anfangs den Antiken zuwendete.
So tritt denn neben die bisher so gut wie ausschließlich
antik - numismatische Literatur seit der Wende des
17. Jahrhunderts ein reiches Schrifttum über die zeit-
genössische und ältere Medaille (z. B. die Werke von
van Loon, Lochner, Tentzel) als Zeugnis für den regen
Sammeleifer auf diesem Gebiete; die verschiedenen, perio-
disch erscheinenden „Münzbelustigungen“ (Köhler, Spieß),
die damals auftraten, sind die Vorläufer unserer numis-
23
7ahrgang 1Q1Q 2- ^eptemberlreft
MClriEfammetn in alter und neuer 2ett
oon
Kuüt Regltng
U\aß schon die Römer Münzen gesammelt haben, ist
sicher: mag auch die Stelle bei Sueton Aug. 75,
wo Augustus „Münzen jeglichen Gepräges, auch alte
königliche und fremde“ zum Saturnalienfest verschenkt,
oder die bei Plinius, wonach ein plattierter Denar, d. h.
ein Falschmünzerprodukt, oft hoch bezahlt wurde, nicht
hinlänglich beweiskräftig sein, so zeigt doch die lange
Reihe der sog. restituierten Münzen der flavischen Kaiser
und bes. des Traianus und die in diesem Zusammen-
hang noch nicht gewürdigte Wiederholung älterer, bes.
augusteischer Münzbilder in jener Periode, daß eine
Sammlung solcher Vorbilder existiert hat. Aber weit-
verbreitet war dies Sammeln nicht, sonst hörten wir
mehr davon und hätten wenigstens eine Spur von numis-
matischer Literatur im Altertum. Jedenfalls hat der Zu-
sammenbruch der antiken Kultur die bescheidenen An-
fänge des Münzsammelns erstickt, denn die wenigen
Beispiele von Nachahmung antiker Gepräge im Mittel-
alter (Huy, Worms, Straßburg usw.) und das vereinzelte
Vorkommen antiker Münzen in mittelalterlichen Münz-
schätzen brauchen nicht auf Sammlertätigkeit hinzu-
weisen. Eine solche setzte vielmehr erst in der
Renaissancezeit ein, als man wie allen anderen Über-
bleibseln des klassischen Altertums so auch den Münzen
eifrig nachging. Schon 1335 kauft ein Olivieri Forzetta
bei einem gewissen Simon in Venedig Münzen, auch
Petrarca (fl374) und Karl IV. (f 1378) sammelten solche.
Im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts schießen die
Münzsammlungen bald wie Pilze aus der Erde: ein eifriger,
freilich wenig zuverlässiger numismatischer Schriftsteller
des 16. Jahrhunderts, Hubert Goltz, 1526—1583, will
950 Sammlungen in Deutschland, den Niederlanden,
Frankreich und Italien kennen! Es gehörte zum guten
Ton, eine Münzsammlung zu besitzen, und in den fürst-
lichen Kunstkammern der Zeit der absoluten Fürsten-
macht durfte unter den „Antikaglien“ eine Münzsammlung
ebensowenig fehlen wie einige absonderliche Geweih-
formen im Naturalienkabinett. Oft stempelte man damals
die Stücke der Sammlung mit einem Sammler-
Zeichen, wie dem Adler von Este oder dem gekrönten
C (eher Christian IV. von Dänemark als Christine von
Schweden bezeichnend). Was sammelte man nun da-
mals? Nun, dem humanistischen Zuge der Zeit ent-
sprechend, der alle Bildung aus dem klassischen Alter-
tum zog, antike, anfangs vorzugsweise römische
Münzen, besonders gern solche mit Kaiserbildnissen, da
man mit deren Hilfe die Kaiser-Büsten und -Gemmen
benennen konnte, mit zunehmender Kenntnis des Grie-
chischen dann auch griechische Münzen. Daneben
traten schon früh die Medaillen, zunächst wohl die
auf die eigene Person des betr. Fürsten und seiner fürst-
lichen Freunde, dann auch andere, wie denn überhaupt
die Entstehung der Bildnis-Medaille im 15. Jahrhundert,
die der historischen im 16. Jahrhundert und deren Be-
nutzung zu politischer Propaganda im 17. Jahrhundert
(Ludwigs XIV. histoire metallique) dazu führen half, daß
sich das Interesse an münzähnlichen Objekten nicht mehr
so ausschließlich wie anfangs den Antiken zuwendete.
So tritt denn neben die bisher so gut wie ausschließlich
antik - numismatische Literatur seit der Wende des
17. Jahrhunderts ein reiches Schrifttum über die zeit-
genössische und ältere Medaille (z. B. die Werke von
van Loon, Lochner, Tentzel) als Zeugnis für den regen
Sammeleifer auf diesem Gebiete; die verschiedenen, perio-
disch erscheinenden „Münzbelustigungen“ (Köhler, Spieß),
die damals auftraten, sind die Vorläufer unserer numis-
23