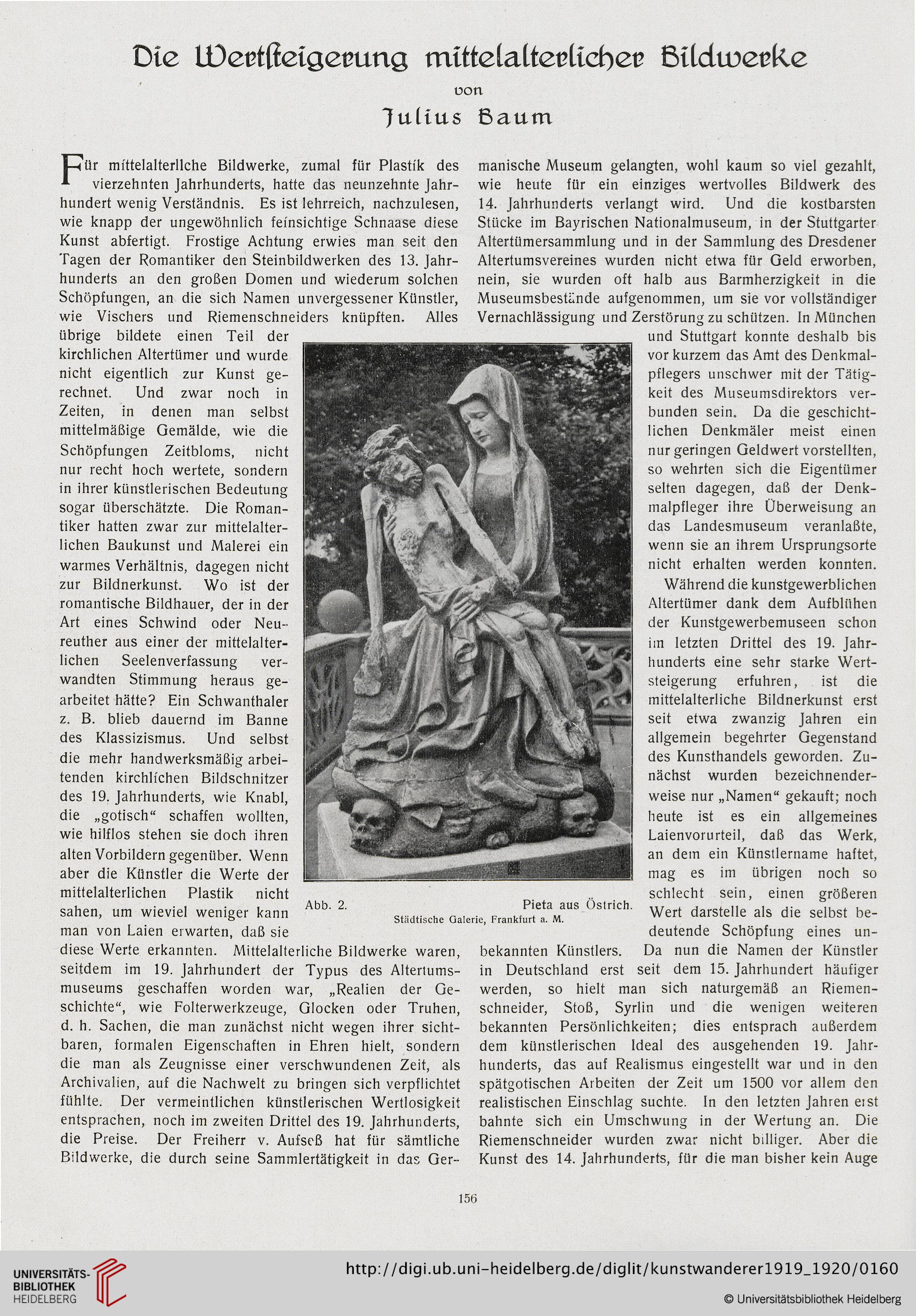Donath, Adolph [Editor]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 1.1919/20
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0160
DOI issue:
2. Dezemberheft
DOI article:Baum, Julius: Die Wertsteigerung mittelalterlicher Bildwerke
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0160
Die lDeütffeigemna mittelaltevlicbev BUdtüet>ke
oon
luUus Baum
plir mittelalterliche Bildwerke, zumal für Plastik des
vierzehnten Jahrhunderts, hatte das neunzehnte Jahr-
hundert wenig Verständnis. Es ist lehrreich, nachzulesen,
wie knapp der ungewöhnlich feinsichtige Schnaase diese
Kunst abfertigt. Frostige Achtung erwies man seit den
Tagen der Romantiker den Steinbildwerken des 13. Jahr-
hunderts an den großen Domen und wiederum solchen
Schöpfungen, an die sich Namen unvergessener Künstler,
wie Vischers und Riemenschneiders knüpften. Alles
übrige bildete einen Teil der
kirchlichen Altertümer und wurde
nicht eigentlich zur Kunst ge-
rechnet. Und zwar noch in
Zeiten, in denen man selbst
mittelmäßige Gemälde, wie die
Schöpfungen Zeitbloms, nicht
nur recht hoch wertete, sondern
in ihrer künstlerischen Bedeutung
sogar überschätzte. Die Roman-
tiker hatten zwar zur mittelalter-
lichen Baukunst und Malerei ein
warmes Verhältnis, dagegen nicht
zur Bildnerkunst. Wo ist der
romantische Bildhauer, der in der
Art eines Schwind oder Neu-
reuther aus einer der mittelalter-
lichen Seelenverfassung ver-
wandten Stimmung heraus ge-
arbeitet hätte? Ein Schwanthaler
z. B. blieb dauernd im Banne
des Klassizismus. Und selbst
die mehr handwerksmäßig arbei-
tenden kirchlichen Bildschnitzer
des 19. Jahrhunderts, wie Knabl,
die „gotisch“ schaffen wollten,
wie hilflos stehen sie doch ihren
alten Vorbildern gegenüber. Wenn
aber die Künstler die Werte der
mittelalterlichen Plastik nicht
sahen, um wieviel weniger kann
man von Laien erwarten, daß sie
diese Werte erkannten. Mittelalterliche Bildwerke waren,
seitdem im 19. Jahrhundert der Typus des Altertums-
museums geschaffen worden war, „Realien der Ge-
schichte“, wie Folterwerkzeuge, Glocken oder Truhen,
d. h. Sachen, die man zunächst nicht wegen ihrer sicht-
baren, formalen Eigenschaften in Ehren hielt, sondern
die man als Zeugnisse einer verschwundenen Zeit, als
Archivalien, auf die Nachwelt zu bringen sich verpflichtet
fühlte. Der vermeintlichen künstlerischen Wertlosigkeit
entsprachen, noch im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts,
die Preise. Der Freiherr v. Aufseß hat für sämtliche
Bildwerke, die durch seine Sammlertätigkeit in das Ger-
manische Museum gelangten, wohl kaum so viel gezahlt,
wie heute für ein einziges wertvolles Bildwerk des
14. Jahrhunderts verlangt wird. Und die kostbarsten
Stücke im Bayrischen Nationalmuseum, in der Stuttgarter
Altertümersammlung und in der Sammlung des Dresdener
Altertumsvereines wurden nicht etwa für Geld erworben,
nein, sie wurden oft halb aus Barmherzigkeit in die
Museumsbestände aufgenommen, um sie vor vollständiger
Vernachlässigung und Zerstörung zu schützen, ln München
und Stuttgart konnte deshalb bis
vor kurzem das Amt des Denkmal-
pflegers unschwer mit der Tätig-
keit des Museumsdirektors ver-
bunden sein. Da die geschicht-
lichen Denkmäler meist einen
nur geringen Geldwert vorstellten,
so wehrten sich die Eigentümer
selten dagegen, daß der Denk-
malpfleger ihre Überweisung an
das Landesmuseum veranlaßte,
wenn sie an ihrem Ursprungsorte
nicht erhalten werden konnten.
Während die kunstgewerblichen
Altertümer dank dem Aufblühen
der Kunstgewerbemuseen schon
im letzten Drittel des 19. Jahr-
hunderts eine sehr starke Wert-
steigerung erfuhren, ist die
mittelalterliche Bildnerkunst erst
seit etwa zwanzig Jahren ein
allgemein begehrter Gegenstand
des Kunsthandels geworden. Zu-
nächst wurden bezeichnender-
weise nur „Namen“ gekauft; noch
heute ist es ein allgemeines
Laienvorurteil, daß das Werk,
an dem ein Künstlername haftet,
mag es im übrigen noch so
schlecht sein, einen größeren
Wert darstelle als die selbst be-
deutende Schöpfung eines un-
bekannten Künstlers. Da nun die Namen der Künstler
in Deutschland erst seit dem 15. Jahrhundert häufiger
werden, so hielt man sich naturgemäß an Riemen-
schneider, Stoß, Syrlin und die wenigen weiteren
bekannten Persönlichkeiten; dies entsprach außerdem
dem künstlerischen Ideal des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts, das auf Realismus eingestellt war und in den
spätgotischen Arbeiten der Zeit um 1500 vor allem den
realistischen Einschlag suchte. In den letzten Jahren eist
bahnte sich ein Umschwung in der Wertung an. Die
Riemenschneider wurden zwar nicht billiger. Aber die
Kunst des 14. Jahrhunderts, für die man bisher kein Auge
Abb. 2. Pieta aus Ostrich.
Städtische Galerie, Frankfurt a. M.
156
oon
luUus Baum
plir mittelalterliche Bildwerke, zumal für Plastik des
vierzehnten Jahrhunderts, hatte das neunzehnte Jahr-
hundert wenig Verständnis. Es ist lehrreich, nachzulesen,
wie knapp der ungewöhnlich feinsichtige Schnaase diese
Kunst abfertigt. Frostige Achtung erwies man seit den
Tagen der Romantiker den Steinbildwerken des 13. Jahr-
hunderts an den großen Domen und wiederum solchen
Schöpfungen, an die sich Namen unvergessener Künstler,
wie Vischers und Riemenschneiders knüpften. Alles
übrige bildete einen Teil der
kirchlichen Altertümer und wurde
nicht eigentlich zur Kunst ge-
rechnet. Und zwar noch in
Zeiten, in denen man selbst
mittelmäßige Gemälde, wie die
Schöpfungen Zeitbloms, nicht
nur recht hoch wertete, sondern
in ihrer künstlerischen Bedeutung
sogar überschätzte. Die Roman-
tiker hatten zwar zur mittelalter-
lichen Baukunst und Malerei ein
warmes Verhältnis, dagegen nicht
zur Bildnerkunst. Wo ist der
romantische Bildhauer, der in der
Art eines Schwind oder Neu-
reuther aus einer der mittelalter-
lichen Seelenverfassung ver-
wandten Stimmung heraus ge-
arbeitet hätte? Ein Schwanthaler
z. B. blieb dauernd im Banne
des Klassizismus. Und selbst
die mehr handwerksmäßig arbei-
tenden kirchlichen Bildschnitzer
des 19. Jahrhunderts, wie Knabl,
die „gotisch“ schaffen wollten,
wie hilflos stehen sie doch ihren
alten Vorbildern gegenüber. Wenn
aber die Künstler die Werte der
mittelalterlichen Plastik nicht
sahen, um wieviel weniger kann
man von Laien erwarten, daß sie
diese Werte erkannten. Mittelalterliche Bildwerke waren,
seitdem im 19. Jahrhundert der Typus des Altertums-
museums geschaffen worden war, „Realien der Ge-
schichte“, wie Folterwerkzeuge, Glocken oder Truhen,
d. h. Sachen, die man zunächst nicht wegen ihrer sicht-
baren, formalen Eigenschaften in Ehren hielt, sondern
die man als Zeugnisse einer verschwundenen Zeit, als
Archivalien, auf die Nachwelt zu bringen sich verpflichtet
fühlte. Der vermeintlichen künstlerischen Wertlosigkeit
entsprachen, noch im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts,
die Preise. Der Freiherr v. Aufseß hat für sämtliche
Bildwerke, die durch seine Sammlertätigkeit in das Ger-
manische Museum gelangten, wohl kaum so viel gezahlt,
wie heute für ein einziges wertvolles Bildwerk des
14. Jahrhunderts verlangt wird. Und die kostbarsten
Stücke im Bayrischen Nationalmuseum, in der Stuttgarter
Altertümersammlung und in der Sammlung des Dresdener
Altertumsvereines wurden nicht etwa für Geld erworben,
nein, sie wurden oft halb aus Barmherzigkeit in die
Museumsbestände aufgenommen, um sie vor vollständiger
Vernachlässigung und Zerstörung zu schützen, ln München
und Stuttgart konnte deshalb bis
vor kurzem das Amt des Denkmal-
pflegers unschwer mit der Tätig-
keit des Museumsdirektors ver-
bunden sein. Da die geschicht-
lichen Denkmäler meist einen
nur geringen Geldwert vorstellten,
so wehrten sich die Eigentümer
selten dagegen, daß der Denk-
malpfleger ihre Überweisung an
das Landesmuseum veranlaßte,
wenn sie an ihrem Ursprungsorte
nicht erhalten werden konnten.
Während die kunstgewerblichen
Altertümer dank dem Aufblühen
der Kunstgewerbemuseen schon
im letzten Drittel des 19. Jahr-
hunderts eine sehr starke Wert-
steigerung erfuhren, ist die
mittelalterliche Bildnerkunst erst
seit etwa zwanzig Jahren ein
allgemein begehrter Gegenstand
des Kunsthandels geworden. Zu-
nächst wurden bezeichnender-
weise nur „Namen“ gekauft; noch
heute ist es ein allgemeines
Laienvorurteil, daß das Werk,
an dem ein Künstlername haftet,
mag es im übrigen noch so
schlecht sein, einen größeren
Wert darstelle als die selbst be-
deutende Schöpfung eines un-
bekannten Künstlers. Da nun die Namen der Künstler
in Deutschland erst seit dem 15. Jahrhundert häufiger
werden, so hielt man sich naturgemäß an Riemen-
schneider, Stoß, Syrlin und die wenigen weiteren
bekannten Persönlichkeiten; dies entsprach außerdem
dem künstlerischen Ideal des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts, das auf Realismus eingestellt war und in den
spätgotischen Arbeiten der Zeit um 1500 vor allem den
realistischen Einschlag suchte. In den letzten Jahren eist
bahnte sich ein Umschwung in der Wertung an. Die
Riemenschneider wurden zwar nicht billiger. Aber die
Kunst des 14. Jahrhunderts, für die man bisher kein Auge
Abb. 2. Pieta aus Ostrich.
Städtische Galerie, Frankfurt a. M.
156