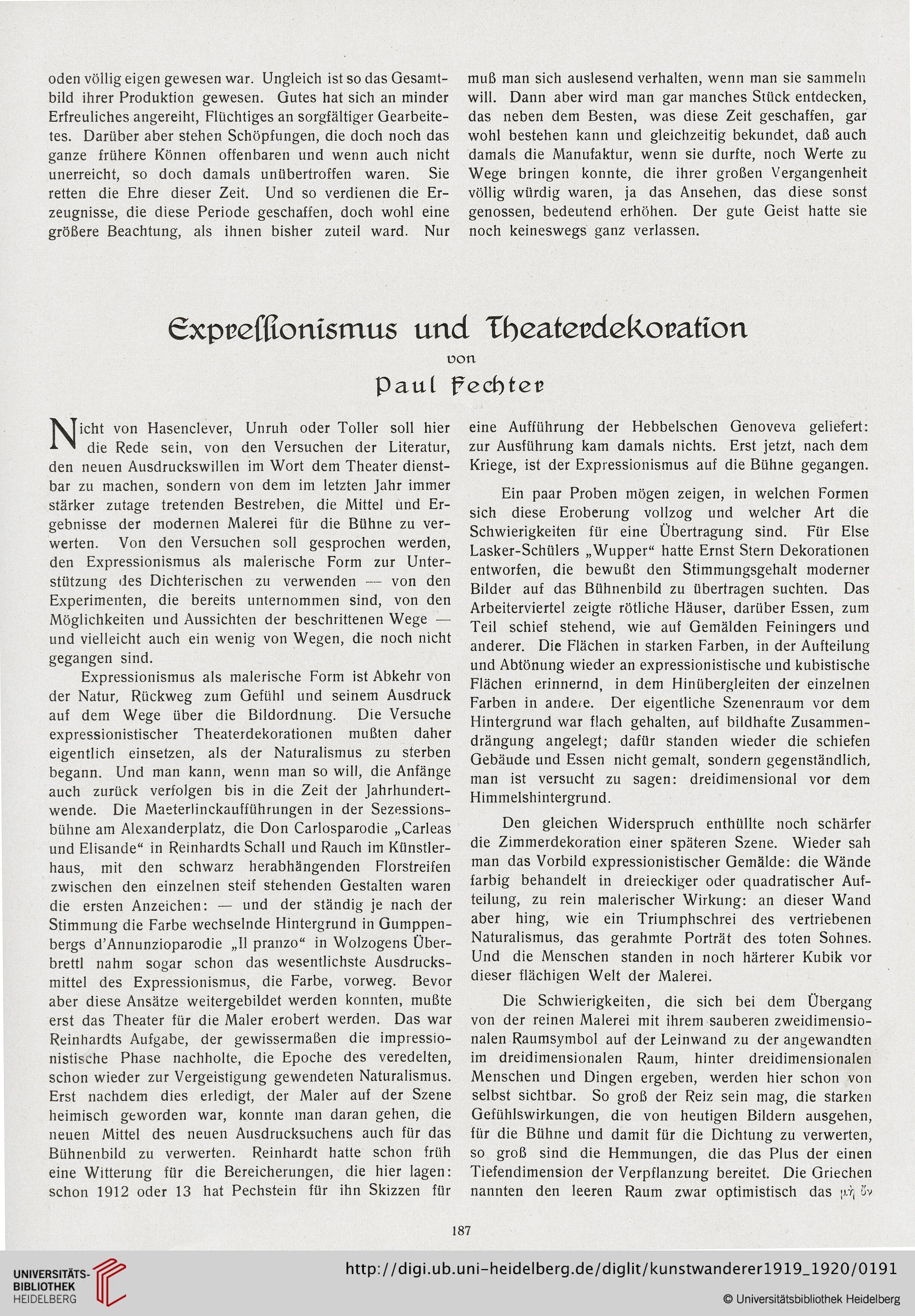öden völlig eigen gewesen war. Ungleich ist so das Gesamt-
bild ihrer Produktion gewesen. Gutes hat sich an minder
Erfreuliches angereiht, Flüchtiges an sorgfältiger Gearbeite-
tes. Darüber aber stehen Schöpfungen, die doch noch das
ganze frühere Können offenbaren und wenn auch nicht
unerreicht, so doch damals unübertroffen waren. Sie
retten die Ehre dieser Zeit. Und so verdienen die Er-
zeugnisse, die diese Periode geschaffen, doch wohl eine
größere Beachtung, als ihnen bisher zuteil ward. Nur
muß man sich auslesend verhalten, wenn man sie sammeln
will. Dann aber wird man gar manches Stück entdecken,
das neben dem Besten, was diese Zeit geschaffen, gar
wohl bestehen kann und gleichzeitig bekundet, daß auch
damals die Manufaktur, wenn sie durfte, noch Werte zu
Wege bringen konnte, die ihrer großen Vergangenheit
völlig würdig waren, ja das Ansehen, das diese sonst
genossen, bedeutend erhöhen. Der gute Geist hatte sie
noch keineswegs ganz verlassen.
Sxpt’efßonismus und Tbeaterdekoeatton
üon
Paul fecbtev
Nicht von Hasenclever, Unruh oder Toller soll hier
die Rede sein, von den Versuchen der Literatur,
den neuen Ausdruckswillen im Wort dem Theater dienst-
bar zu machen, sondern von dem im letzten Jahr immer
stärker zutage tretenden Bestreben, die Mittel und Er-
gebnisse der modernen Malerei für die Bühne zu ver-
werten. Von den Versuchen soll gesprochen werden,
den Expressionismus als malerische Form zur Unter-
stützung des Dichterischen zu verwenden — von den
Experimenten, die bereits unternommen sind, von den
Möglichkeiten und Aussichten der beschrittenen Wege —
und vielleicht auch ein wenig von Wegen, die noch nicht
gegangen sind.
Expressionismus als malerische Form ist Abkehr von
der Natur, Rückweg zum Gefühl und seinem Ausdruck
auf dem Wege über die Bildordnung. Die Versuche
expressionistischer Theaterdekorationen mußten daher
eigentlich einsetzen, als der Naturalismus zu sterben
begann. Und man kann, wenn man so will, die Anfänge
auch zurück verfolgen bis in die Zeit der Jahrhundert-
wende. Die Maeterlinckaufführungen in der Sezessions-
bühne am Alexanderplatz, die Don Carlosparodie „Carleas
und Elisande“ in Reinhardts Schall und Rauch im Künstler-
haus, mit den schwarz herabhängenden Florstreifen
zwischen den einzelnen steif stehenden Gestalten waren
die ersten Anzeichen: — und der ständig je nach der
Stimmung die Farbe wechselnde Hintergrund in Gumppen-
bergs d’Annunzioparodie „II pranzo“ in Wolzogens Über-
brettl nahm sogar schon das wesentlichste Ausdrucks-
mittel des Expressionismus, die Farbe, vorweg. Bevor
aber diese Ansätze weitergebildet werden konnten, mußte
erst das Theater für die Maler erobert werden. Das war
Reinhardts Aufgabe, der gewissermaßen die impressio-
nistische Phase nachholte, die Epoche des veredelten,
schon wieder zur Vergeistigung gewendeten Naturalismus.
Erst nachdem dies erledigt, der Maler auf der Szene
heimisch geworden war, konnte man daran gehen, die
neuen Mittel des neuen Ausdrucksuchens auch für das
Bühnenbild zu verwerten. Reinhardt hatte schon früh
eine Witterung für die Bereicherungen, die hier lagen:
schon 1912 oder 13 hat Pechstein für ihn Skizzen für
eine Aufführung der Hebbelschen Genoveva geliefert:
zur Ausführung kam damals nichts. Erst jetzt, nach dem
Kriege, ist der Expressionismus auf die Bühne gegangen.
Ein paar Proben mögen zeigen, in welchen Formen
sich diese Eroberung vollzog und welcher Art die
Schwierigkeiten für eine Übertragung sind. Für Else
Lasker-Schülers „Wupper“ hatte Ernst Stern Dekorationen
entworfen, die bewußt den Stimmungsgehalt moderner
Bilder auf das Bühnenbild zu übertragen suchten. Das
Arbeiterviertel zeigte rötliche Häuser, darüber Essen, zum
Teil schief stehend, wie auf Gemälden Feiningers und
anderer. Die Flächen in starken Farben, in der Aufteilung
und Abtönung wieder an expressionistische und kubistische
Flächen erinnernd, in dem Hinübergleiten der einzelnen
Farben in andere. Der eigentliche Szenenraum vor dem
Hintergrund war flach gehalten, auf bildhafte Zusammen-
drängung angelegt; dafür standen wieder die schiefen
Gebäude und Essen nicht gemalt, sondern gegenständlich,
man ist versucht zu sagen: dreidimensional vor dem
Himmelshintergrund.
Den gleichen Widerspruch enthüllte noch schärfer
die Zimmerdekoration einer späteren Szene. Wieder sah
man das Vorbild expressionistischer Gemälde: die Wände
farbig behandelt in dreieckiger oder quadratischer Auf-
teilung, zu rein malerischer Wirkung: an dieser Wand
aber hing, wie ein Triumphschrei des vertriebenen
Naturalismus, das gerahmte Porträt des toten Sohnes.
Und die Menschen standen in noch härterer Kubik vor
dieser flächigen Welt der Malerei.
Die Schwierigkeiten, die sich bei dem Übergang
von der reinen Malerei mit ihrem sauberen zweidimensio-
nalen Raumsymbol auf der Leinwand zu der angewandten
im dreidimensionalen Raum, hinter dreidimensionalen
Menschen und Dingen ergeben, werden hier schon von
selbst sichtbar. So groß der Reiz sein mag, die starken
Gefühlswirkungen, die von heutigen Bildern ausgehen,
für die Bühne und damit für die Dichtung zu verwerten,
so groß sind die Hemmungen, die das Plus der einen
Tiefendimension der Verpflanzung bereitet. Die Griechen
nannten den leeren Raum zwar optimistisch das ;j.t( uv
187
bild ihrer Produktion gewesen. Gutes hat sich an minder
Erfreuliches angereiht, Flüchtiges an sorgfältiger Gearbeite-
tes. Darüber aber stehen Schöpfungen, die doch noch das
ganze frühere Können offenbaren und wenn auch nicht
unerreicht, so doch damals unübertroffen waren. Sie
retten die Ehre dieser Zeit. Und so verdienen die Er-
zeugnisse, die diese Periode geschaffen, doch wohl eine
größere Beachtung, als ihnen bisher zuteil ward. Nur
muß man sich auslesend verhalten, wenn man sie sammeln
will. Dann aber wird man gar manches Stück entdecken,
das neben dem Besten, was diese Zeit geschaffen, gar
wohl bestehen kann und gleichzeitig bekundet, daß auch
damals die Manufaktur, wenn sie durfte, noch Werte zu
Wege bringen konnte, die ihrer großen Vergangenheit
völlig würdig waren, ja das Ansehen, das diese sonst
genossen, bedeutend erhöhen. Der gute Geist hatte sie
noch keineswegs ganz verlassen.
Sxpt’efßonismus und Tbeaterdekoeatton
üon
Paul fecbtev
Nicht von Hasenclever, Unruh oder Toller soll hier
die Rede sein, von den Versuchen der Literatur,
den neuen Ausdruckswillen im Wort dem Theater dienst-
bar zu machen, sondern von dem im letzten Jahr immer
stärker zutage tretenden Bestreben, die Mittel und Er-
gebnisse der modernen Malerei für die Bühne zu ver-
werten. Von den Versuchen soll gesprochen werden,
den Expressionismus als malerische Form zur Unter-
stützung des Dichterischen zu verwenden — von den
Experimenten, die bereits unternommen sind, von den
Möglichkeiten und Aussichten der beschrittenen Wege —
und vielleicht auch ein wenig von Wegen, die noch nicht
gegangen sind.
Expressionismus als malerische Form ist Abkehr von
der Natur, Rückweg zum Gefühl und seinem Ausdruck
auf dem Wege über die Bildordnung. Die Versuche
expressionistischer Theaterdekorationen mußten daher
eigentlich einsetzen, als der Naturalismus zu sterben
begann. Und man kann, wenn man so will, die Anfänge
auch zurück verfolgen bis in die Zeit der Jahrhundert-
wende. Die Maeterlinckaufführungen in der Sezessions-
bühne am Alexanderplatz, die Don Carlosparodie „Carleas
und Elisande“ in Reinhardts Schall und Rauch im Künstler-
haus, mit den schwarz herabhängenden Florstreifen
zwischen den einzelnen steif stehenden Gestalten waren
die ersten Anzeichen: — und der ständig je nach der
Stimmung die Farbe wechselnde Hintergrund in Gumppen-
bergs d’Annunzioparodie „II pranzo“ in Wolzogens Über-
brettl nahm sogar schon das wesentlichste Ausdrucks-
mittel des Expressionismus, die Farbe, vorweg. Bevor
aber diese Ansätze weitergebildet werden konnten, mußte
erst das Theater für die Maler erobert werden. Das war
Reinhardts Aufgabe, der gewissermaßen die impressio-
nistische Phase nachholte, die Epoche des veredelten,
schon wieder zur Vergeistigung gewendeten Naturalismus.
Erst nachdem dies erledigt, der Maler auf der Szene
heimisch geworden war, konnte man daran gehen, die
neuen Mittel des neuen Ausdrucksuchens auch für das
Bühnenbild zu verwerten. Reinhardt hatte schon früh
eine Witterung für die Bereicherungen, die hier lagen:
schon 1912 oder 13 hat Pechstein für ihn Skizzen für
eine Aufführung der Hebbelschen Genoveva geliefert:
zur Ausführung kam damals nichts. Erst jetzt, nach dem
Kriege, ist der Expressionismus auf die Bühne gegangen.
Ein paar Proben mögen zeigen, in welchen Formen
sich diese Eroberung vollzog und welcher Art die
Schwierigkeiten für eine Übertragung sind. Für Else
Lasker-Schülers „Wupper“ hatte Ernst Stern Dekorationen
entworfen, die bewußt den Stimmungsgehalt moderner
Bilder auf das Bühnenbild zu übertragen suchten. Das
Arbeiterviertel zeigte rötliche Häuser, darüber Essen, zum
Teil schief stehend, wie auf Gemälden Feiningers und
anderer. Die Flächen in starken Farben, in der Aufteilung
und Abtönung wieder an expressionistische und kubistische
Flächen erinnernd, in dem Hinübergleiten der einzelnen
Farben in andere. Der eigentliche Szenenraum vor dem
Hintergrund war flach gehalten, auf bildhafte Zusammen-
drängung angelegt; dafür standen wieder die schiefen
Gebäude und Essen nicht gemalt, sondern gegenständlich,
man ist versucht zu sagen: dreidimensional vor dem
Himmelshintergrund.
Den gleichen Widerspruch enthüllte noch schärfer
die Zimmerdekoration einer späteren Szene. Wieder sah
man das Vorbild expressionistischer Gemälde: die Wände
farbig behandelt in dreieckiger oder quadratischer Auf-
teilung, zu rein malerischer Wirkung: an dieser Wand
aber hing, wie ein Triumphschrei des vertriebenen
Naturalismus, das gerahmte Porträt des toten Sohnes.
Und die Menschen standen in noch härterer Kubik vor
dieser flächigen Welt der Malerei.
Die Schwierigkeiten, die sich bei dem Übergang
von der reinen Malerei mit ihrem sauberen zweidimensio-
nalen Raumsymbol auf der Leinwand zu der angewandten
im dreidimensionalen Raum, hinter dreidimensionalen
Menschen und Dingen ergeben, werden hier schon von
selbst sichtbar. So groß der Reiz sein mag, die starken
Gefühlswirkungen, die von heutigen Bildern ausgehen,
für die Bühne und damit für die Dichtung zu verwerten,
so groß sind die Hemmungen, die das Plus der einen
Tiefendimension der Verpflanzung bereitet. Die Griechen
nannten den leeren Raum zwar optimistisch das ;j.t( uv
187