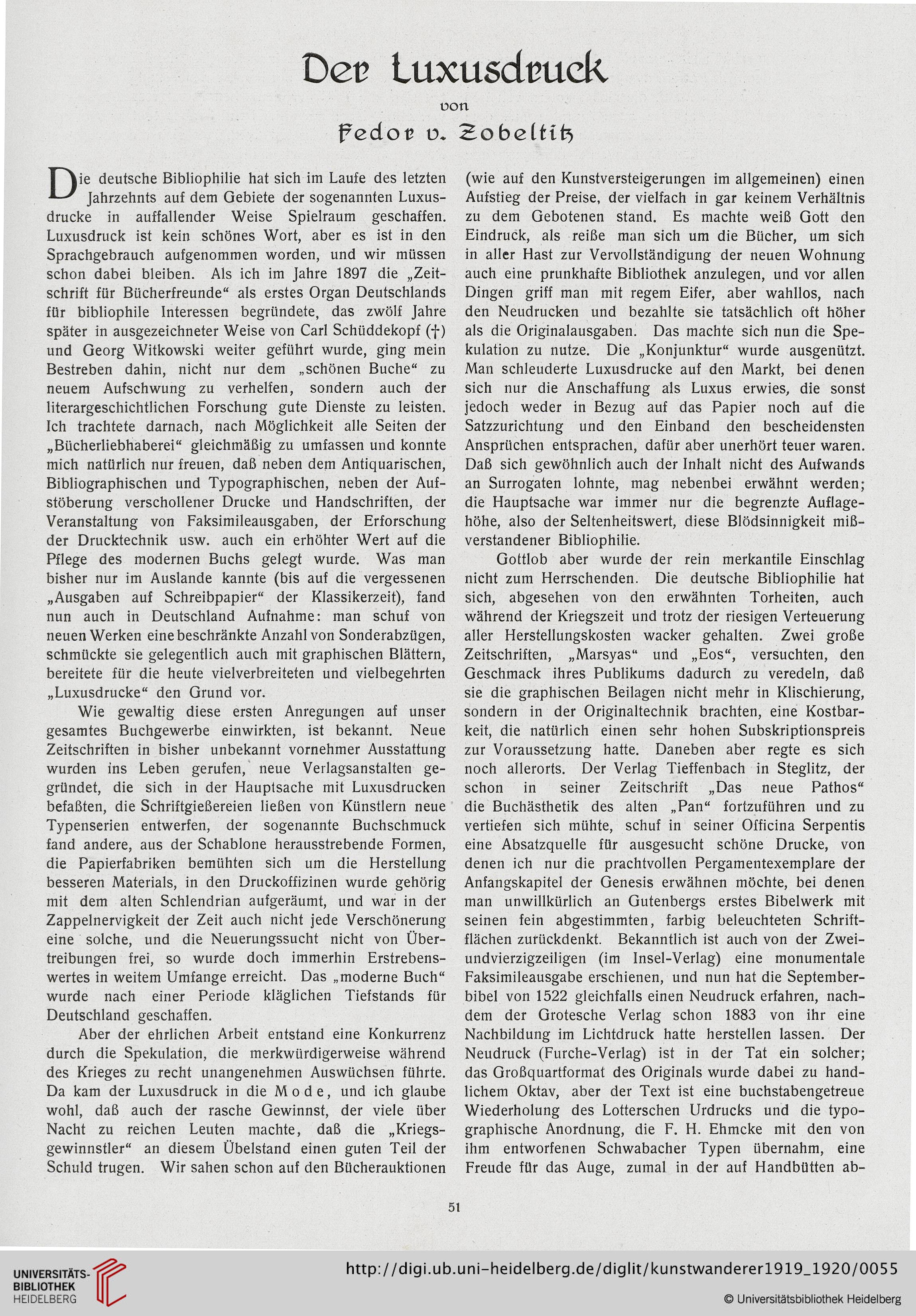Dee luxusdcuek
oon
pedov ü. Eobettip
Die deutsche Bibliophilie hat sich im Laufe des letzten
Jahrzehnts auf dem Gebiete der sogenannten Luxus-
drucke in auffallender Weise Spielraum geschaffen.
Luxusdruck ist kein schönes Wort, aber es ist in den
Sprachgebrauch aufgenommen worden, und wir müssen
schon dabei bleiben. Als ich im Jahre 1897 die „Zeit-
schrift für Bücherfreunde“ als erstes Organ Deutschlands
für bibliophile Interessen begründete, das zwölf Jahre
später in ausgezeichneter Weise von Carl Schüddekopf (f)
und Georg Witkowski weiter geführt wurde, ging mein
Bestreben dahin, nicht nur dem „schönen Buche“ zu
neuem Aufschwung zu verhelfen, sondern auch der
literargeschichtlichen Forschung gute Dienste zu leisten.
Ich trachtete darnach, nach Möglichkeit alle Seiten der
„Bücherliebhaberei“ gleichmäßig zu umfassen und konnte
mich natürlich nur freuen, daß neben dem Antiquarischen,
Bibliographischen und Typographischen, neben der Auf-
stöberung verschollener Drucke und Handschriften, der
Veranstaltung von Faksimileausgaben, der Erforschung
der Drucktechnik usw. auch ein erhöhter Wert auf die
Pflege des modernen Buchs gelegt wurde. Was man
bisher nur im Auslande kannte (bis auf die vergessenen
„Ausgaben auf Schreibpapier“ der Klassikerzeit), fand
nun auch in Deutschland Aufnahme: man schuf von
neuen Werken eine beschränkte Anzahl von Sonderabzügen,
schmückte sie gelegentlich auch mit graphischen Blättern,
bereitete für die heute vielverbreiteten und vielbegehrten
„Luxusdrucke“ den Grund vor.
Wie gewaltig diese ersten Anregungen auf unser
gesamtes Buchgewerbe einwirkten, ist bekannt. Neue
Zeitschriften in bisher unbekannt vornehmer Ausstattung
wurden ins Leben gerufen, neue Verlagsanstalten ge-
gründet, die sich in der Hauptsache mit Luxusdrucken
befaßten, die Schriftgießereien ließen von Künstlern neue
Typenserien entwerfen, der sogenannte Buchschmuck
fand andere, aus der Schablone herausstrebende Formen,
die Papierfabriken bemühten sich um die Herstellung
besseren Materials, in den Druckoffizinen wurde gehörig
mit dem alten Schlendrian aufgeräumt, und war in der
Zappelnervigkeit der Zeit auch nicht jede Verschönerung
eine solche, und die Neuerungssucht nicht von Über-
treibungen frei, so wurde doch immerhin Erstrebens-
wertes in weitem Umfange erreicht. Das „moderne Buch“
wurde nach einer Periode kläglichen Tiefstands für
Deutschland geschaffen.
Aber der ehrlichen Arbeit entstand eine Konkurrenz
durch die Spekulation, die merkwürdigerweise während
des Krieges zu recht unangenehmen Auswüchsen führte.
Da kam der Luxusdruck in die Mode, und ich glaube
wohl, daß auch der rasche Gewinnst, der viele über
Nacht zu reichen Leuten machte, daß die „Kriegs-
gewinnstier“ an diesem Übelstand einen guten Teil der
Schuld trugen. Wir sahen schon auf den Bücherauktionen
(wie auf den Kunstversteigerungen im allgemeinen) einen
Aufstieg der Preise, der vielfach in gar keinem Verhältnis
zu dem Gebotenen stand. Es machte weiß Gott den
Eindruck, als reiße man sich um die Bücher, um sich
in aller Hast zur Vervollständigung der neuen Wohnung
auch eine prunkhafte Bibliothek anzulegen, und vor allen
Dingen griff man mit regem Eifer, aber wahllos, nach
den Neudrucken und bezahlte sie tatsächlich oft höher
als die Originalausgaben. Das machte sich nun die Spe-
kulation zu nutze. Die „Konjunktur“ wurde ausgenützt.
Man schleuderte Luxusdrucke auf den Markt, bei denen
sich nur die Anschaffung als Luxus erwies, die sonst
jedoch weder in Bezug auf das Papier noch auf die
Satzzurichtung und den Einband den bescheidensten
Ansprüchen entsprachen, dafür aber unerhört teuer waren.
Daß sich gewöhnlich auch der Inhalt nicht des Aufwands
an Surrogaten lohnte, mag nebenbei erwähnt werden;
die Hauptsache war immer nur die begrenzte Auflage-
höhe, also der Seltenheitswert, diese Blödsinnigkeit miß-
verstandener Bibliophilie.
Gottlob aber wurde der rein merkantile Einschlag
nicht zum Herrschenden. Die deutsche Bibliophilie hat
sich, abgesehen von den erwähnten Torheiten, auch
während der Kriegszeit und trotz der riesigen Verteuerung
aller Herstellungskosten wacker gehalten. Zwei große
Zeitschriften, „Marsyas“ und „Eos“, versuchten, den
Geschmack ihres Publikums dadurch zu veredeln, daß
sie die graphischen Beilagen nicht mehr in Klischierung,
sondern in der Originaltechnik brachten, eine Kostbar-
keit, die natürlich einen sehr hohen Subskriptionspreis
zur Voraussetzung hatte. Daneben aber regte es sich
noch allerorts. Der Verlag Tieffenbach in Steglitz, der
schon in seiner Zeitschrift „Das neue Pathos“
die Buchästhetik des alten „Pan“ fortzuführen und zu
vertiefen sich mühte, schuf in seiner Officina Serpentis
eine Absatzquelle für ausgesucht schöne Drucke, von
denen ich nur die prachtvollen Pergamentexemplare der
Anfangskapitel der Genesis erwähnen möchte, bei denen
man unwillkürlich an Gutenbergs erstes Bibelwerk mit
seinen fein abgestimmten, farbig beleuchteten Schrift-
flächen zurückdenkt. Bekanntlich ist auch von der Zwei-
undvierzigzeiligen (im Insel-Verlag) eine monumentale
Faksimileausgabe erschienen, und nun hat die September-
bibel von 1522 gleichfalls einen Neudruck erfahren, nach-
dem der Grotesche Verlag schon 1883 von ihr eine
Nachbildung im Lichtdruck hatte hersteilen lassen. Der
Neudruck (Furche-Verlag) ist in der Tat ein solcher;
das Großquartformat des Originals wurde dabei zu hand-
lichem Oktav, aber der Text ist eine buchstabengetreue
Wiederholung des Lotterschen Urdrucks und die typo-
graphische Anordnung, die F. H. Ehmcke mit den von
ihm entworfenen Schwabacher Typen übernahm, eine
Freude für das Auge, zumal in der auf Handbütten ab-
51
oon
pedov ü. Eobettip
Die deutsche Bibliophilie hat sich im Laufe des letzten
Jahrzehnts auf dem Gebiete der sogenannten Luxus-
drucke in auffallender Weise Spielraum geschaffen.
Luxusdruck ist kein schönes Wort, aber es ist in den
Sprachgebrauch aufgenommen worden, und wir müssen
schon dabei bleiben. Als ich im Jahre 1897 die „Zeit-
schrift für Bücherfreunde“ als erstes Organ Deutschlands
für bibliophile Interessen begründete, das zwölf Jahre
später in ausgezeichneter Weise von Carl Schüddekopf (f)
und Georg Witkowski weiter geführt wurde, ging mein
Bestreben dahin, nicht nur dem „schönen Buche“ zu
neuem Aufschwung zu verhelfen, sondern auch der
literargeschichtlichen Forschung gute Dienste zu leisten.
Ich trachtete darnach, nach Möglichkeit alle Seiten der
„Bücherliebhaberei“ gleichmäßig zu umfassen und konnte
mich natürlich nur freuen, daß neben dem Antiquarischen,
Bibliographischen und Typographischen, neben der Auf-
stöberung verschollener Drucke und Handschriften, der
Veranstaltung von Faksimileausgaben, der Erforschung
der Drucktechnik usw. auch ein erhöhter Wert auf die
Pflege des modernen Buchs gelegt wurde. Was man
bisher nur im Auslande kannte (bis auf die vergessenen
„Ausgaben auf Schreibpapier“ der Klassikerzeit), fand
nun auch in Deutschland Aufnahme: man schuf von
neuen Werken eine beschränkte Anzahl von Sonderabzügen,
schmückte sie gelegentlich auch mit graphischen Blättern,
bereitete für die heute vielverbreiteten und vielbegehrten
„Luxusdrucke“ den Grund vor.
Wie gewaltig diese ersten Anregungen auf unser
gesamtes Buchgewerbe einwirkten, ist bekannt. Neue
Zeitschriften in bisher unbekannt vornehmer Ausstattung
wurden ins Leben gerufen, neue Verlagsanstalten ge-
gründet, die sich in der Hauptsache mit Luxusdrucken
befaßten, die Schriftgießereien ließen von Künstlern neue
Typenserien entwerfen, der sogenannte Buchschmuck
fand andere, aus der Schablone herausstrebende Formen,
die Papierfabriken bemühten sich um die Herstellung
besseren Materials, in den Druckoffizinen wurde gehörig
mit dem alten Schlendrian aufgeräumt, und war in der
Zappelnervigkeit der Zeit auch nicht jede Verschönerung
eine solche, und die Neuerungssucht nicht von Über-
treibungen frei, so wurde doch immerhin Erstrebens-
wertes in weitem Umfange erreicht. Das „moderne Buch“
wurde nach einer Periode kläglichen Tiefstands für
Deutschland geschaffen.
Aber der ehrlichen Arbeit entstand eine Konkurrenz
durch die Spekulation, die merkwürdigerweise während
des Krieges zu recht unangenehmen Auswüchsen führte.
Da kam der Luxusdruck in die Mode, und ich glaube
wohl, daß auch der rasche Gewinnst, der viele über
Nacht zu reichen Leuten machte, daß die „Kriegs-
gewinnstier“ an diesem Übelstand einen guten Teil der
Schuld trugen. Wir sahen schon auf den Bücherauktionen
(wie auf den Kunstversteigerungen im allgemeinen) einen
Aufstieg der Preise, der vielfach in gar keinem Verhältnis
zu dem Gebotenen stand. Es machte weiß Gott den
Eindruck, als reiße man sich um die Bücher, um sich
in aller Hast zur Vervollständigung der neuen Wohnung
auch eine prunkhafte Bibliothek anzulegen, und vor allen
Dingen griff man mit regem Eifer, aber wahllos, nach
den Neudrucken und bezahlte sie tatsächlich oft höher
als die Originalausgaben. Das machte sich nun die Spe-
kulation zu nutze. Die „Konjunktur“ wurde ausgenützt.
Man schleuderte Luxusdrucke auf den Markt, bei denen
sich nur die Anschaffung als Luxus erwies, die sonst
jedoch weder in Bezug auf das Papier noch auf die
Satzzurichtung und den Einband den bescheidensten
Ansprüchen entsprachen, dafür aber unerhört teuer waren.
Daß sich gewöhnlich auch der Inhalt nicht des Aufwands
an Surrogaten lohnte, mag nebenbei erwähnt werden;
die Hauptsache war immer nur die begrenzte Auflage-
höhe, also der Seltenheitswert, diese Blödsinnigkeit miß-
verstandener Bibliophilie.
Gottlob aber wurde der rein merkantile Einschlag
nicht zum Herrschenden. Die deutsche Bibliophilie hat
sich, abgesehen von den erwähnten Torheiten, auch
während der Kriegszeit und trotz der riesigen Verteuerung
aller Herstellungskosten wacker gehalten. Zwei große
Zeitschriften, „Marsyas“ und „Eos“, versuchten, den
Geschmack ihres Publikums dadurch zu veredeln, daß
sie die graphischen Beilagen nicht mehr in Klischierung,
sondern in der Originaltechnik brachten, eine Kostbar-
keit, die natürlich einen sehr hohen Subskriptionspreis
zur Voraussetzung hatte. Daneben aber regte es sich
noch allerorts. Der Verlag Tieffenbach in Steglitz, der
schon in seiner Zeitschrift „Das neue Pathos“
die Buchästhetik des alten „Pan“ fortzuführen und zu
vertiefen sich mühte, schuf in seiner Officina Serpentis
eine Absatzquelle für ausgesucht schöne Drucke, von
denen ich nur die prachtvollen Pergamentexemplare der
Anfangskapitel der Genesis erwähnen möchte, bei denen
man unwillkürlich an Gutenbergs erstes Bibelwerk mit
seinen fein abgestimmten, farbig beleuchteten Schrift-
flächen zurückdenkt. Bekanntlich ist auch von der Zwei-
undvierzigzeiligen (im Insel-Verlag) eine monumentale
Faksimileausgabe erschienen, und nun hat die September-
bibel von 1522 gleichfalls einen Neudruck erfahren, nach-
dem der Grotesche Verlag schon 1883 von ihr eine
Nachbildung im Lichtdruck hatte hersteilen lassen. Der
Neudruck (Furche-Verlag) ist in der Tat ein solcher;
das Großquartformat des Originals wurde dabei zu hand-
lichem Oktav, aber der Text ist eine buchstabengetreue
Wiederholung des Lotterschen Urdrucks und die typo-
graphische Anordnung, die F. H. Ehmcke mit den von
ihm entworfenen Schwabacher Typen übernahm, eine
Freude für das Auge, zumal in der auf Handbütten ab-
51