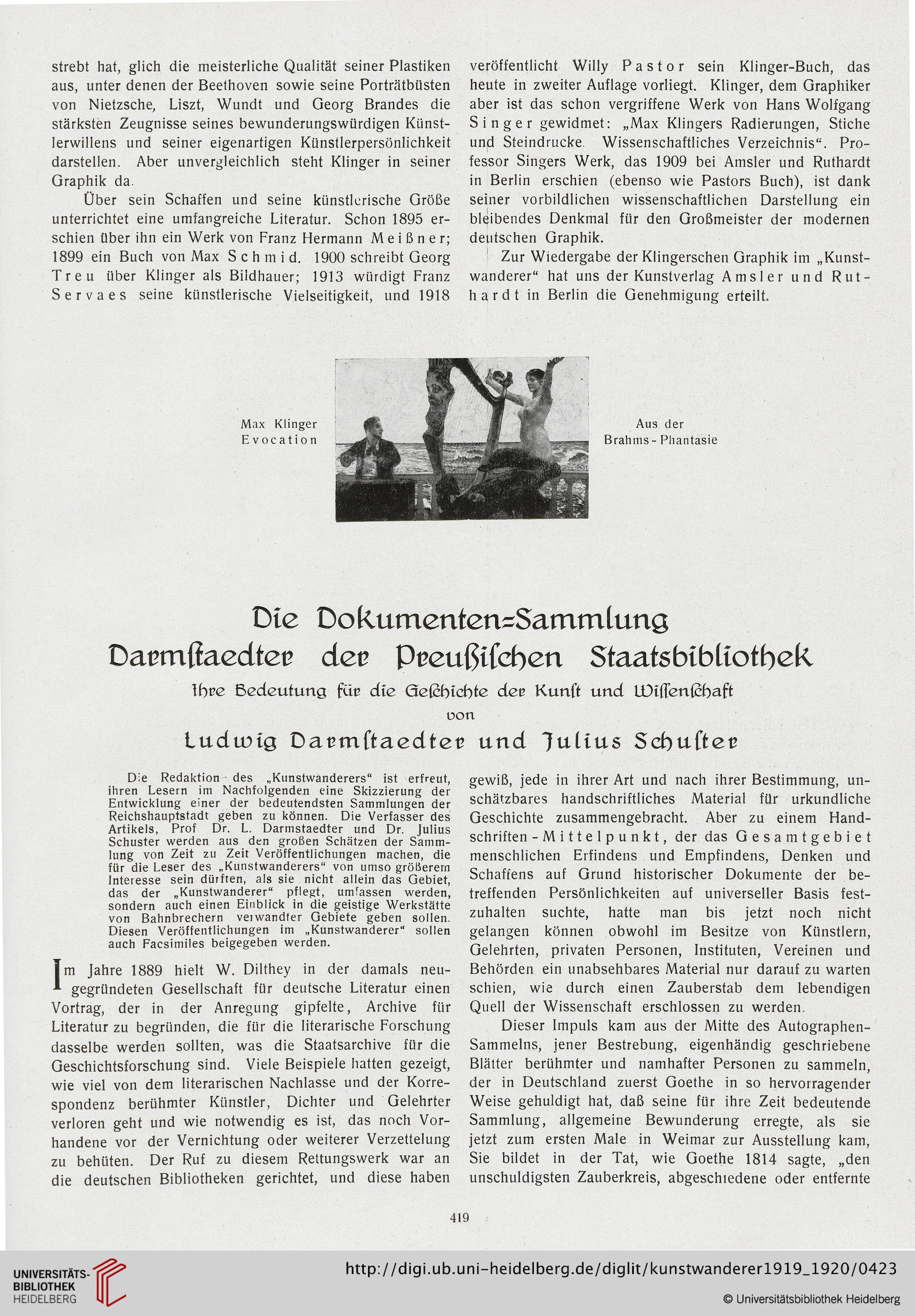Donath, Adolph [Editor]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 1.1919/20
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0423
DOI issue:
1./2. Juliheft
DOI article:Meder, Carl: Erinnerungen an Max Klinger
DOI article:Darmstaedter, Ludwig; Schuster, Julius: Die Dokumenten-Sammlung Darmstaedter der Preußischen Staatsbibliothek: Ihre Bedeutung für die Geschichte der Kunst und Wissenschaft
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0423
strebt hat, glich die meisterliche Qualität seiner Plastiken
aus, unter denen der Beethoven sowie seine Porträtbüsten
von Nietzsche, Liszt, Wundt und Georg Brandes die
stärksten Zeugnisse seines bewunderungswürdigen Künst-
lerwillens und seiner eigenartigen Künstlerpersönlichkeit
darstellen. Aber unvergleichlich steht Klinger in seiner
Graphik da.
Über sein Schaffen und seine künstlerische Größe
unterrichtet eine umfangreiche Literatur. Schon 1895 er-
schien über ihn ein Werk von Franz Hermann Meißner;
1899 ein Buch von Max S c h m i d. 1900 schreibt Georg
Treu über Klinger als Bildhauer; 1913 würdigt Franz
Servaes seine künstlerische Vielseitigkeit, und 1918
veröffentlicht Willy Pastor sein Klinger-Buch, das
heute in zweiter Auflage vorliegt. Klinger, dem Graphiker
aber ist das schon vergriffene Werk von Hans Wolfgang
S i n g e r gewidmet: „Max Klingers Radierungen, Stiche
und Steindrucke Wissenschaftliches Verzeichnis“. Pro-
fessor Singers Werk, das 1909 bei Amsler und Ruthardt
in Berlin erschien (ebenso wie Pastors Buch), ist dank
seiner vorbildlichen wissenschaftlichen Darstellung ein
bleibendes Denkmal für den Großmeister der modernen
deutschen Graphik.
Zur Wiedergabe der Klingerschen Graphik im „Kunst-
wanderer“ hat uns der Kunstverlag Amsler und Rut-
hardt in Berlin die Genehmigung erteilt.
Max Klinger
E vocation
Aus der
Brahms - Phantasie
Die Dokumentensammlung
Daernffaedtev dev peeußifcben Staatsbibliothek
Ibve Bedeutung fett? die Qetcfucbte det? Kunft und LÜiifenjcbaft
oon
ludung Datmxftaedtec und luUus Schuftet?
Die Redaktion des „Kunstwänderers“ ist erfreut,
ihren Lesern im Nachfolgenden eine Skizzierung der
Entwicklung einer der bedeutendsten Sammlungen der
Reichshauptstadt geben zu können. Die Verfasser des
Artikels, Prof Dr. L. Darmstaedter und Dr. Julius
Schuster werden aus den großen Schätzen der Samm-
lung von Zeit zu Zeit Veröffentlichungen machen, die
für die Leser des „Kunstwanderers“ von umso größerem
Interesse sein dürften, als sie nicht allein das Gebiet,
das der „Kunstwanderer“ pflegt, umfassen werden,
sondern auch einen Einblick in die geistige Werkstätte
von Bahnbrechern verwandter Gebiete geben sollen.
Diesen Veröffentlichungen im „Kunstwanderer“ sollen
auch Facsimiles beigegeben werden.
Im Jahre 1889 hielt W. Dilthey in der damals neu-
gegründeten Gesellschaft für deutsche Literatur einen
Vortrag, der in der Anregung gipfelte, Archive für
Literatur zu begründen, die für die literarische Forschung
dasselbe werden sollten, was die Staatsarchive für die
Geschichtsforschung sind. Viele Beispiele hatten gezeigt,
wie viel von dem literarischen Nachlasse und der Korre-
spondenz berühmter Künstler, Dichter und Gelehrter
verloren geht und wie notwendig es ist, das noch Vor-
handene vor der Vernichtung oder weiterer Verzettelung
zu behüten. Der Ruf zu diesem Rettungswerk war an
die deutschen Bibliotheken gerichtet, und diese haben
gewiß, jede in ihrer Art und nach ihrer Bestimmung, un-
schätzbares handschriftliches Material für urkundliche
Geschichte zusammengebracht. Aber zu einem Hand-
schriften -Mittelpunkt, der das Gesamtgebiet
menschlichen Erfindens und Empfindens, Denken und
Schaffens auf Grund historischer Dokumente der be-
treffenden Persönlichkeiten auf universeller Basis fest-
zuhalten suchte, hatte man bis jetzt noch nicht
gelangen können obwohl im Besitze von Künstlern,
Gelehrten, privaten Personen, Instituten, Vereinen und
Behörden ein unabsehbares Material nur darauf zu warten
schien, wie durch einen Zauberstab dem lebendigen
Quell der Wissenschaft erschlossen zu werden.
Dieser Impuls kam aus der Mitte des Autographen-
Sammelns, jener Bestrebung, eigenhändig geschriebene
Blätter berühmter und namhafter Personen zu sammeln,
der in Deutschland zuerst Goethe in so hervorragender
Weise gehuldigt hat, daß seine für ihre Zeit bedeutende
Sammlung, allgemeine Bewunderung erregte, als sie
jetzt zum ersten Male in Weimar zur Ausstellung kam,
Sie bildet in der Tat, wie Goethe 1814 sagte, „den
unschuldigsten Zauberkreis, abgeschiedene oder entfernte
419
aus, unter denen der Beethoven sowie seine Porträtbüsten
von Nietzsche, Liszt, Wundt und Georg Brandes die
stärksten Zeugnisse seines bewunderungswürdigen Künst-
lerwillens und seiner eigenartigen Künstlerpersönlichkeit
darstellen. Aber unvergleichlich steht Klinger in seiner
Graphik da.
Über sein Schaffen und seine künstlerische Größe
unterrichtet eine umfangreiche Literatur. Schon 1895 er-
schien über ihn ein Werk von Franz Hermann Meißner;
1899 ein Buch von Max S c h m i d. 1900 schreibt Georg
Treu über Klinger als Bildhauer; 1913 würdigt Franz
Servaes seine künstlerische Vielseitigkeit, und 1918
veröffentlicht Willy Pastor sein Klinger-Buch, das
heute in zweiter Auflage vorliegt. Klinger, dem Graphiker
aber ist das schon vergriffene Werk von Hans Wolfgang
S i n g e r gewidmet: „Max Klingers Radierungen, Stiche
und Steindrucke Wissenschaftliches Verzeichnis“. Pro-
fessor Singers Werk, das 1909 bei Amsler und Ruthardt
in Berlin erschien (ebenso wie Pastors Buch), ist dank
seiner vorbildlichen wissenschaftlichen Darstellung ein
bleibendes Denkmal für den Großmeister der modernen
deutschen Graphik.
Zur Wiedergabe der Klingerschen Graphik im „Kunst-
wanderer“ hat uns der Kunstverlag Amsler und Rut-
hardt in Berlin die Genehmigung erteilt.
Max Klinger
E vocation
Aus der
Brahms - Phantasie
Die Dokumentensammlung
Daernffaedtev dev peeußifcben Staatsbibliothek
Ibve Bedeutung fett? die Qetcfucbte det? Kunft und LÜiifenjcbaft
oon
ludung Datmxftaedtec und luUus Schuftet?
Die Redaktion des „Kunstwänderers“ ist erfreut,
ihren Lesern im Nachfolgenden eine Skizzierung der
Entwicklung einer der bedeutendsten Sammlungen der
Reichshauptstadt geben zu können. Die Verfasser des
Artikels, Prof Dr. L. Darmstaedter und Dr. Julius
Schuster werden aus den großen Schätzen der Samm-
lung von Zeit zu Zeit Veröffentlichungen machen, die
für die Leser des „Kunstwanderers“ von umso größerem
Interesse sein dürften, als sie nicht allein das Gebiet,
das der „Kunstwanderer“ pflegt, umfassen werden,
sondern auch einen Einblick in die geistige Werkstätte
von Bahnbrechern verwandter Gebiete geben sollen.
Diesen Veröffentlichungen im „Kunstwanderer“ sollen
auch Facsimiles beigegeben werden.
Im Jahre 1889 hielt W. Dilthey in der damals neu-
gegründeten Gesellschaft für deutsche Literatur einen
Vortrag, der in der Anregung gipfelte, Archive für
Literatur zu begründen, die für die literarische Forschung
dasselbe werden sollten, was die Staatsarchive für die
Geschichtsforschung sind. Viele Beispiele hatten gezeigt,
wie viel von dem literarischen Nachlasse und der Korre-
spondenz berühmter Künstler, Dichter und Gelehrter
verloren geht und wie notwendig es ist, das noch Vor-
handene vor der Vernichtung oder weiterer Verzettelung
zu behüten. Der Ruf zu diesem Rettungswerk war an
die deutschen Bibliotheken gerichtet, und diese haben
gewiß, jede in ihrer Art und nach ihrer Bestimmung, un-
schätzbares handschriftliches Material für urkundliche
Geschichte zusammengebracht. Aber zu einem Hand-
schriften -Mittelpunkt, der das Gesamtgebiet
menschlichen Erfindens und Empfindens, Denken und
Schaffens auf Grund historischer Dokumente der be-
treffenden Persönlichkeiten auf universeller Basis fest-
zuhalten suchte, hatte man bis jetzt noch nicht
gelangen können obwohl im Besitze von Künstlern,
Gelehrten, privaten Personen, Instituten, Vereinen und
Behörden ein unabsehbares Material nur darauf zu warten
schien, wie durch einen Zauberstab dem lebendigen
Quell der Wissenschaft erschlossen zu werden.
Dieser Impuls kam aus der Mitte des Autographen-
Sammelns, jener Bestrebung, eigenhändig geschriebene
Blätter berühmter und namhafter Personen zu sammeln,
der in Deutschland zuerst Goethe in so hervorragender
Weise gehuldigt hat, daß seine für ihre Zeit bedeutende
Sammlung, allgemeine Bewunderung erregte, als sie
jetzt zum ersten Male in Weimar zur Ausstellung kam,
Sie bildet in der Tat, wie Goethe 1814 sagte, „den
unschuldigsten Zauberkreis, abgeschiedene oder entfernte
419