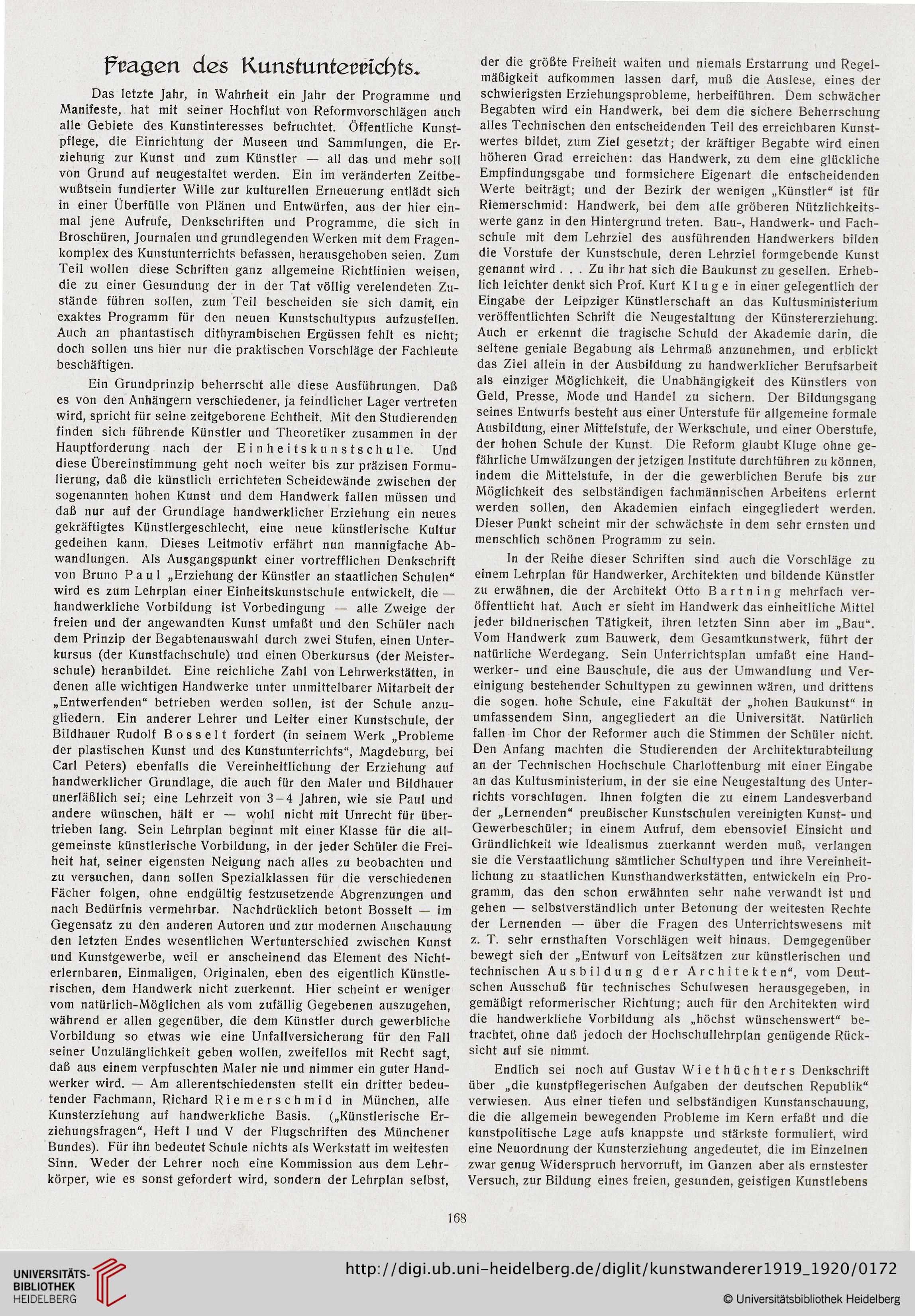fragen des Kunstuntemcbts.
Das letzte Jahr, in Wahrheit ein Jahr der Programme und
Manifeste, hat mit seiner Hochflut von Reformvorschlägen auch
alle Gebiete des Kunstinteresses befruchtet. Öffentliche Kunst-
pflege, die Einrichtung der Museen und Sammlungen, die Er-
ziehung zur Kunst und zum Künstler — all das und mehr soll
von Grund auf neugestaltet werden. Ein im veränderten Zeitbe-
wußtsein fundierter Wille zur kulturellen Erneuerung entlädt sich
in einer Überfülle von Plänen und Entwürfen, aus der hier ein-
mal jene Aufrufe, Denkschriften und Programme, die sich in
Broschüren, Journalen und grundlegenden Werken mit dem Fragen-
komplex des Kunstunterrichts befassen, herausgehoben seien. Zum
Teil wollen diese Schriften ganz allgemeine Richtlinien weisen,
die zu einer Gesundung der in der Tat völlig verelendeten Zu-
stände führen sollen, zum Teil bescheiden sie sich damit, ein
exaktes Programm für den neuen Kunstschultypus aufzustellen.
Auch an phantastisch dithyrambischen Ergüssen fehlt es nicht;
doch sollen uns hier nur die praktischen Vorschläge der Fachleute
beschäftigen.
Ein Grundprinzip beherrscht alle diese Ausführungen. Daß
es von den Anhängern verschiedener, ja feindlicher Lager vertreten
wird, spricht für seine zeitgeborene Echtheit. Mit den Studierenden
finden sich führende Künstler und Theoretiker zusammen in der
Hauptforderung nach der Einheitskunstschule. Und
diese Übereinstimmung geht noch weiter bis zur präzisen Formu-
lierung, daß die künstlich errichteten Scheidewände zwischen der
sogenannten hohen Kunst und dem Handwerk fallen müssen und
daß nur auf der Grundlage handwerklicher Erziehung ein neues
gekräftigtes Künstlergeschlecht, eine neue künstlerische Kultur
gedeihen kann. Dieses Leitmotiv erfährt nun mannigfache Ab-
wandlungen. Als Ausgangspunkt einer vortrefflichen Denkschrift
von Bruno Paul „Erziehung der Künstler an staatlichen Schulen“
wird es zum Lehrplan einer Einheitskunstschule entwickelt, die —
handwerkliche Vorbildung ist Vorbedingung — alle Zweige der
freien und der angewandten Kunst umfaßt und den Schüler nach
dem Prinzip der Begabtenauswahl durch zwei Stufen, einen Unter-
kursus (der Kunstfachschule) und einen Oberkursus (der Meister-
schule) heranbildet. Eine reichliche Zahl von Lehrwerkstätten, in
denen alle wichtigen Handwerke unter unmittelbarer Mitarbeit der
„Entwerfenden“ betrieben werden sollen, ist der Schule anzu-
gliedern. Ein anderer Lehrer und Leiter einer Kunstschule, der
Bildhauer Rudolf Bosselt fordert (in seinem Werk „Probleme
der plastischen Kunst und des Kunstunterrichts“, Magdeburg, bei
Carl Peters) ebenfalls die Vereinheitlichung der Erziehung auf
handwerklicher Grundlage, die auch für den Maler und Bildhauer
unerläßlich sei; eine Lehrzeit von 3-4 Jahren, wie sie Paul und
andere wünschen, hält er — wohl nicht mit Unrecht für über-
trieben lang. Sein Lehrplan beginnt mit einer Klasse für die all-
gemeinste künstlerische Vorbildung, in der jeder Schüler die Frei-
heit hat, seiner eigensten Neigung nach alles zu beobachten und
zu versuchen, dann sollen Spezialklassen für die verschiedenen
Fächer folgen, ohne endgültig festzusetzende Abgrenzungen und
nach Bedürfnis vermehrbar. Nachdrücklich betont Bosselt — im
Gegensatz zu den anderen Autoren und zur modernen Anschauung
den letzten Endes wesentlichen Wertunterschied zwischen Kunst
und Kunstgewerbe, weil er anscheinend das Element des Nicht-
erlernbaren, Einmaligen, Originalen, eben des eigentlich Künstle-
rischen, dem Handwerk nicht zuerkennt. Hier scheint er weniger
vom natürlich-Möglichen als vom zufällig Gegebenen auszugehen,
während er allen gegenüber, die dem Künstler durch gewerbliche
Vorbildung so etwas wie eine Unfallversicherung für den Fall
seiner Unzulänglichkeit geben wollen, zweifellos mit Recht sagt,
daß aus einem verpfuschten Maler nie und nimmer ein guter Hand-
werker wird. — Am allerentschiedensten stellt ein dritter bedeu-
tender Fachmann, Richard Riemerschmid in München, alle
Kunsterziehung auf handwerkliche Basis. („Künstlerische Er-
ziehungsfragen“, Heft I und V der Flugschriften des Münchener
Bundes). Für ihn bedeutet Schule nichts als Werkstatt im weitesten
Sinn. Weder der Lehrer noch eine Kommission aus dem Lehr-
körper, wie es sonst gefordert wird, sondern der Lehrplan selbst,
der die größte Freiheit walten und niemals Erstarrung und Regel-
mäßigkeit aufkommen lassen darf, muß die Auslese, eines der
schwierigsten Erziehungsprobleme, herbeiführen. Dem schwächer
Begabten wird ein Handwerk, bei dem die sichere Beherrschung
alles Technischen den entscheidenden Teil des erreichbaren Kunst-
wertes bildet, zum Ziel gesetzt; der kräftiger Begabte wird einen
höheren Grad erreichen: das Handwerk, zu dem eine glückliche
Empfindungsgabe und formsichere Eigenart die entscheidenden
Werte beiträgt; und der Bezirk der wenigen „Künstler“ ist für
Riemerschmid: Handwerk, bei dem alle gröberen Nützlichkeits-
werte ganz in den Hintergrund treten. Bau-, Handwerk- und Fach-
schule mit dem Lehrziel des ausführenden Handwerkers bilden
die Vorstufe der Kunstschule, deren Lehrziel formgebende Kunst
genannt wird ... Zu ihr hat sich die Baukunst zu gesellen. Erheb-
lich leichter denkt sich Prof. Kurt Kluge in einer gelegentlich der
Eingabe der Leipziger Künstlerschaft an das Kultusministerium
veröffentlichten Schrift die Neugestaltung der Künstererziehung.
Auch er erkennt die tragische Schuld der Akademie darin, die
seltene geniale Begabung als Lehrmaß anzunehmen, und erblickt
das Ziel allein in der Ausbildung zu handwerklicher Berufsarbeit
als einziger Möglichkeit, die Unabhängigkeit des Künstlers von
Geld, Presse, Mode und Handel zu sichern. Der Bildungsgang
seines Entwurfs besteht aus einer Unterstufe für allgemeine formale
Ausbildung, einer Mittelstufe, der Werkschule, und einer Oberstufe,
der hohen Schule der Kunst. Die Reform glaubt Kluge ohne ge-
fährliche Umwälzungen der jetzigen Institute durchführen zu können,
indem die Mittelstufe, in der die gewerblichen Berufe bis zur
Möglichkeit des selbständigen fachmännischen Arbeitens erlernt
werden sollen, den Akademien einfach eingegliedert werden.
Dieser Punkt scheint mir der schwächste in dem sehr ernsten und
menschlich schönen Programm zu sein.
In der Reihe dieser Schriften sind auch die Vorschläge zu
einem Lehrplan für Handwerker, Architekten und bildende Künstler
zu erwähnen, die der Architekt Otto B a r t n i n g mehrfach ver-
öffentlicht hat. Auch er sieht im Handwerk das einheitliche Mittel
jeder bildnerischen Tätigkeit, ihren letzten Sinn aber im „Bau“.
Vom Handwerk zum Bauwerk, dem Gesamtkunstwerk, führt der
natürliche Werdegang. Sein Unterrichtsplan umfaßt eine Hand-
werker- und eine Bauschule, die aus der Umwandlung und Ver-
einigung bestehender Schultypen zu gewinnen wären, und drittens
die sogen, hohe Schule, eine Fakultät der „hohen Baukunst“ in
umfassendem Sinn, angegliedert an die Universität. Natürlich
fallen im Chor der Reformer auch die Stimmen der Schüler nicht.
Den Anfang machten die Studierenden der Architekturabteilung
an der Technischen Hochschule Charlottenburg mit einer Eingabe
an das Kultusministerium, in der sie eine Neugestaltung des Unter-
richts vorschlugen. Ihnen folgten die zu einem Landesverband
der „Lernenden“ preußischer Kunstschulen vereinigten Kunst- und
Gewerbeschüler; in einem Aufruf, dem ebensoviel Einsicht und
Gründlichkeit wie Idealismus zuerkannt werden muß, verlangen
sie die Verstaatlichung sämtlicher Schultypen und ihre Vereinheit-
lichung zu staatlichen Kunsthandwerkstätten, entwickeln ein Pro-
gramm, das den schon erwähnten sehr nahe verwandt ist und
gehen — selbstverständlich unter Betonung der weitesten Rechte
der Lernenden — über die Fragen des Unterrichtswesens mit
z. T. sehr ernsthaften Vorschlägen weit hinaus. Demgegenüber
bewegt sich der „Entwurf von Leitsätzen zur künstlerischen und
technischen Ausbildung der Architekten“, vom Deut-
schen Ausschuß für technisches Schulwesen herausgegeben, in
gemäßigt reformerischer Richtung; auch für den Architekten wird
die handwerkliche Vorbildung als „höchst wünschenswert“ be-
trachtet, ohne daß jedoch der Hochschullehrplan genügende Rück-
sicht auf sie nimmt.
Endlich sei noch auf Gustav Wiethüchters Denkschrift
über „die kunstpflegerischen Aufgaben der deutschen Republik“
verwiesen. Aus einer tiefen und selbständigen Kunstanschauung,
die die allgemein bewegenden Probleme im Kern erfaßt und die
kunstpolitische Lage aufs knappste und stärkste formuliert, wird
eine Neuordnung der Kunsterziehung angedeutet, die im Einzelnen
zwar genug Widerspruch hervorruft, im Ganzen aber als ernstester
Versuch, zur Bildung eines freien, gesunden, geistigen Kunstlebens
168
Das letzte Jahr, in Wahrheit ein Jahr der Programme und
Manifeste, hat mit seiner Hochflut von Reformvorschlägen auch
alle Gebiete des Kunstinteresses befruchtet. Öffentliche Kunst-
pflege, die Einrichtung der Museen und Sammlungen, die Er-
ziehung zur Kunst und zum Künstler — all das und mehr soll
von Grund auf neugestaltet werden. Ein im veränderten Zeitbe-
wußtsein fundierter Wille zur kulturellen Erneuerung entlädt sich
in einer Überfülle von Plänen und Entwürfen, aus der hier ein-
mal jene Aufrufe, Denkschriften und Programme, die sich in
Broschüren, Journalen und grundlegenden Werken mit dem Fragen-
komplex des Kunstunterrichts befassen, herausgehoben seien. Zum
Teil wollen diese Schriften ganz allgemeine Richtlinien weisen,
die zu einer Gesundung der in der Tat völlig verelendeten Zu-
stände führen sollen, zum Teil bescheiden sie sich damit, ein
exaktes Programm für den neuen Kunstschultypus aufzustellen.
Auch an phantastisch dithyrambischen Ergüssen fehlt es nicht;
doch sollen uns hier nur die praktischen Vorschläge der Fachleute
beschäftigen.
Ein Grundprinzip beherrscht alle diese Ausführungen. Daß
es von den Anhängern verschiedener, ja feindlicher Lager vertreten
wird, spricht für seine zeitgeborene Echtheit. Mit den Studierenden
finden sich führende Künstler und Theoretiker zusammen in der
Hauptforderung nach der Einheitskunstschule. Und
diese Übereinstimmung geht noch weiter bis zur präzisen Formu-
lierung, daß die künstlich errichteten Scheidewände zwischen der
sogenannten hohen Kunst und dem Handwerk fallen müssen und
daß nur auf der Grundlage handwerklicher Erziehung ein neues
gekräftigtes Künstlergeschlecht, eine neue künstlerische Kultur
gedeihen kann. Dieses Leitmotiv erfährt nun mannigfache Ab-
wandlungen. Als Ausgangspunkt einer vortrefflichen Denkschrift
von Bruno Paul „Erziehung der Künstler an staatlichen Schulen“
wird es zum Lehrplan einer Einheitskunstschule entwickelt, die —
handwerkliche Vorbildung ist Vorbedingung — alle Zweige der
freien und der angewandten Kunst umfaßt und den Schüler nach
dem Prinzip der Begabtenauswahl durch zwei Stufen, einen Unter-
kursus (der Kunstfachschule) und einen Oberkursus (der Meister-
schule) heranbildet. Eine reichliche Zahl von Lehrwerkstätten, in
denen alle wichtigen Handwerke unter unmittelbarer Mitarbeit der
„Entwerfenden“ betrieben werden sollen, ist der Schule anzu-
gliedern. Ein anderer Lehrer und Leiter einer Kunstschule, der
Bildhauer Rudolf Bosselt fordert (in seinem Werk „Probleme
der plastischen Kunst und des Kunstunterrichts“, Magdeburg, bei
Carl Peters) ebenfalls die Vereinheitlichung der Erziehung auf
handwerklicher Grundlage, die auch für den Maler und Bildhauer
unerläßlich sei; eine Lehrzeit von 3-4 Jahren, wie sie Paul und
andere wünschen, hält er — wohl nicht mit Unrecht für über-
trieben lang. Sein Lehrplan beginnt mit einer Klasse für die all-
gemeinste künstlerische Vorbildung, in der jeder Schüler die Frei-
heit hat, seiner eigensten Neigung nach alles zu beobachten und
zu versuchen, dann sollen Spezialklassen für die verschiedenen
Fächer folgen, ohne endgültig festzusetzende Abgrenzungen und
nach Bedürfnis vermehrbar. Nachdrücklich betont Bosselt — im
Gegensatz zu den anderen Autoren und zur modernen Anschauung
den letzten Endes wesentlichen Wertunterschied zwischen Kunst
und Kunstgewerbe, weil er anscheinend das Element des Nicht-
erlernbaren, Einmaligen, Originalen, eben des eigentlich Künstle-
rischen, dem Handwerk nicht zuerkennt. Hier scheint er weniger
vom natürlich-Möglichen als vom zufällig Gegebenen auszugehen,
während er allen gegenüber, die dem Künstler durch gewerbliche
Vorbildung so etwas wie eine Unfallversicherung für den Fall
seiner Unzulänglichkeit geben wollen, zweifellos mit Recht sagt,
daß aus einem verpfuschten Maler nie und nimmer ein guter Hand-
werker wird. — Am allerentschiedensten stellt ein dritter bedeu-
tender Fachmann, Richard Riemerschmid in München, alle
Kunsterziehung auf handwerkliche Basis. („Künstlerische Er-
ziehungsfragen“, Heft I und V der Flugschriften des Münchener
Bundes). Für ihn bedeutet Schule nichts als Werkstatt im weitesten
Sinn. Weder der Lehrer noch eine Kommission aus dem Lehr-
körper, wie es sonst gefordert wird, sondern der Lehrplan selbst,
der die größte Freiheit walten und niemals Erstarrung und Regel-
mäßigkeit aufkommen lassen darf, muß die Auslese, eines der
schwierigsten Erziehungsprobleme, herbeiführen. Dem schwächer
Begabten wird ein Handwerk, bei dem die sichere Beherrschung
alles Technischen den entscheidenden Teil des erreichbaren Kunst-
wertes bildet, zum Ziel gesetzt; der kräftiger Begabte wird einen
höheren Grad erreichen: das Handwerk, zu dem eine glückliche
Empfindungsgabe und formsichere Eigenart die entscheidenden
Werte beiträgt; und der Bezirk der wenigen „Künstler“ ist für
Riemerschmid: Handwerk, bei dem alle gröberen Nützlichkeits-
werte ganz in den Hintergrund treten. Bau-, Handwerk- und Fach-
schule mit dem Lehrziel des ausführenden Handwerkers bilden
die Vorstufe der Kunstschule, deren Lehrziel formgebende Kunst
genannt wird ... Zu ihr hat sich die Baukunst zu gesellen. Erheb-
lich leichter denkt sich Prof. Kurt Kluge in einer gelegentlich der
Eingabe der Leipziger Künstlerschaft an das Kultusministerium
veröffentlichten Schrift die Neugestaltung der Künstererziehung.
Auch er erkennt die tragische Schuld der Akademie darin, die
seltene geniale Begabung als Lehrmaß anzunehmen, und erblickt
das Ziel allein in der Ausbildung zu handwerklicher Berufsarbeit
als einziger Möglichkeit, die Unabhängigkeit des Künstlers von
Geld, Presse, Mode und Handel zu sichern. Der Bildungsgang
seines Entwurfs besteht aus einer Unterstufe für allgemeine formale
Ausbildung, einer Mittelstufe, der Werkschule, und einer Oberstufe,
der hohen Schule der Kunst. Die Reform glaubt Kluge ohne ge-
fährliche Umwälzungen der jetzigen Institute durchführen zu können,
indem die Mittelstufe, in der die gewerblichen Berufe bis zur
Möglichkeit des selbständigen fachmännischen Arbeitens erlernt
werden sollen, den Akademien einfach eingegliedert werden.
Dieser Punkt scheint mir der schwächste in dem sehr ernsten und
menschlich schönen Programm zu sein.
In der Reihe dieser Schriften sind auch die Vorschläge zu
einem Lehrplan für Handwerker, Architekten und bildende Künstler
zu erwähnen, die der Architekt Otto B a r t n i n g mehrfach ver-
öffentlicht hat. Auch er sieht im Handwerk das einheitliche Mittel
jeder bildnerischen Tätigkeit, ihren letzten Sinn aber im „Bau“.
Vom Handwerk zum Bauwerk, dem Gesamtkunstwerk, führt der
natürliche Werdegang. Sein Unterrichtsplan umfaßt eine Hand-
werker- und eine Bauschule, die aus der Umwandlung und Ver-
einigung bestehender Schultypen zu gewinnen wären, und drittens
die sogen, hohe Schule, eine Fakultät der „hohen Baukunst“ in
umfassendem Sinn, angegliedert an die Universität. Natürlich
fallen im Chor der Reformer auch die Stimmen der Schüler nicht.
Den Anfang machten die Studierenden der Architekturabteilung
an der Technischen Hochschule Charlottenburg mit einer Eingabe
an das Kultusministerium, in der sie eine Neugestaltung des Unter-
richts vorschlugen. Ihnen folgten die zu einem Landesverband
der „Lernenden“ preußischer Kunstschulen vereinigten Kunst- und
Gewerbeschüler; in einem Aufruf, dem ebensoviel Einsicht und
Gründlichkeit wie Idealismus zuerkannt werden muß, verlangen
sie die Verstaatlichung sämtlicher Schultypen und ihre Vereinheit-
lichung zu staatlichen Kunsthandwerkstätten, entwickeln ein Pro-
gramm, das den schon erwähnten sehr nahe verwandt ist und
gehen — selbstverständlich unter Betonung der weitesten Rechte
der Lernenden — über die Fragen des Unterrichtswesens mit
z. T. sehr ernsthaften Vorschlägen weit hinaus. Demgegenüber
bewegt sich der „Entwurf von Leitsätzen zur künstlerischen und
technischen Ausbildung der Architekten“, vom Deut-
schen Ausschuß für technisches Schulwesen herausgegeben, in
gemäßigt reformerischer Richtung; auch für den Architekten wird
die handwerkliche Vorbildung als „höchst wünschenswert“ be-
trachtet, ohne daß jedoch der Hochschullehrplan genügende Rück-
sicht auf sie nimmt.
Endlich sei noch auf Gustav Wiethüchters Denkschrift
über „die kunstpflegerischen Aufgaben der deutschen Republik“
verwiesen. Aus einer tiefen und selbständigen Kunstanschauung,
die die allgemein bewegenden Probleme im Kern erfaßt und die
kunstpolitische Lage aufs knappste und stärkste formuliert, wird
eine Neuordnung der Kunsterziehung angedeutet, die im Einzelnen
zwar genug Widerspruch hervorruft, im Ganzen aber als ernstester
Versuch, zur Bildung eines freien, gesunden, geistigen Kunstlebens
168