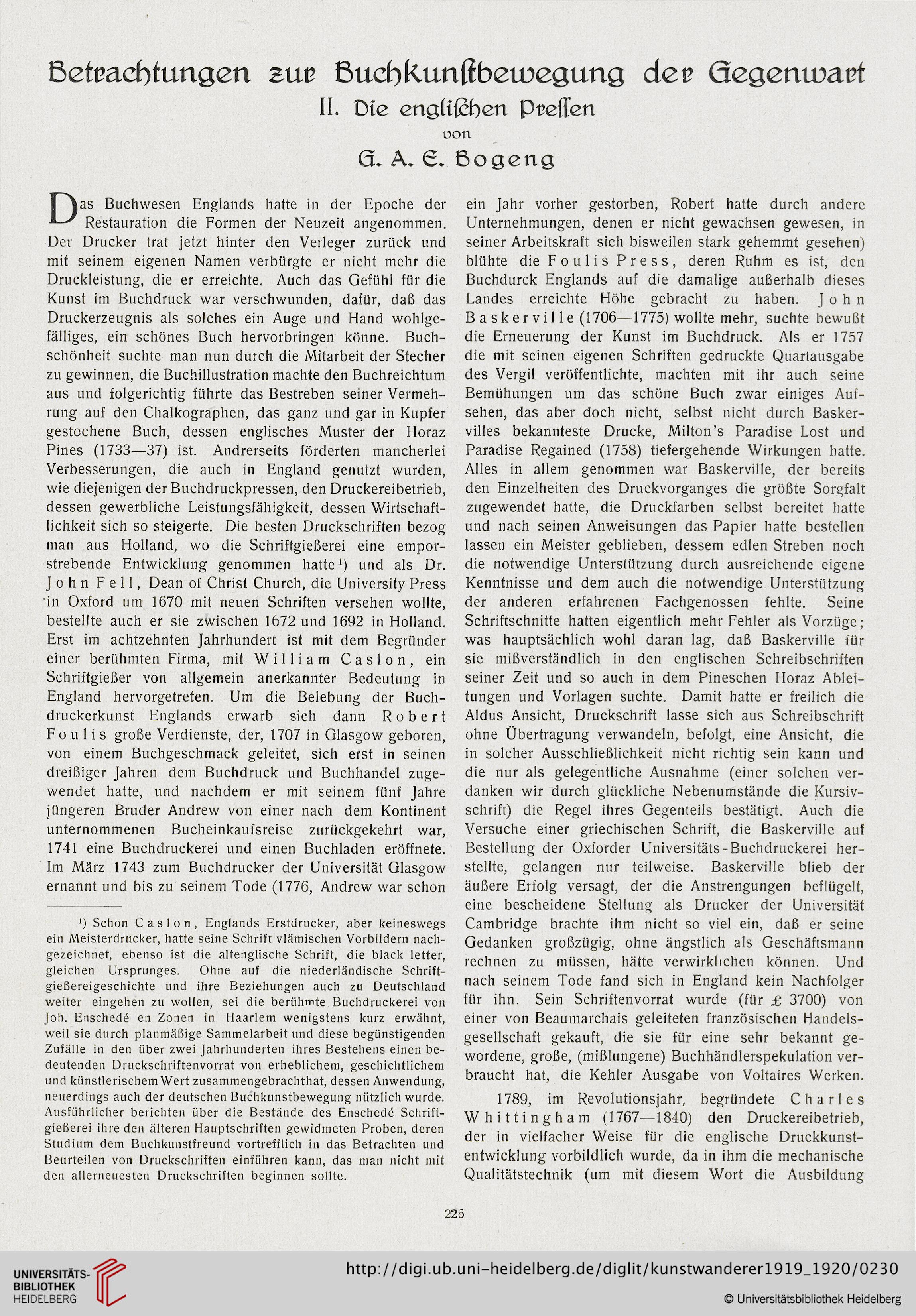Betrachtungen zuv Bucbkunftbeu^egung der Gegenwart
II. Die englticben Püeflen
oon
6. A. 6. Bogeng
|jas Buchwesen Englands hatte in der Epoche der
Restauration die Formen der Neuzeit angenommen.
Der Drucker trat jetzt hinter den Verleger zurück und
mit seinem eigenen Namen verbürgte er nicht mehr die
Druckleistung, die er erreichte. Auch das Gefühl für die
Kunst im Buchdruck war verschwunden, dafür, daß das
Druckerzeugnis als solches ein Auge und Hand wohlge-
fälliges, ein schönes Buch hervorbringen könne. Buch-
schönheit suchte man nun durch die Mitarbeit der Stecher
zu gewinnen, die Buchillustration machte den Buchreichtum
aus und folgerichtig führte das Bestreben seiner Vermeh-
rung auf den Chalkographen, das ganz und gar in Kupfer
gestochene Buch, dessen englisches Muster der Horaz
Pines (1733—37) ist. Andrerseits förderten mancherlei
Verbesserungen, die auch in England genutzt wurden,
wie diejenigen der Buchdruckpressen, den Druckereibetrieb,
dessen gewerbliche Leistungsfähigkeit, dessen Wirtschaft-
lichkeit sich so steigerte. Die besten Druckschriften bezog
man aus Holland, wo die Schriftgießerei eine empor-
strebende Entwicklung genommen hatte1) und als Dr.
John Fell, Dean of Christ Church, die University Press
in Oxford um 1670 mit neuen Schriften versehen wollte,
bestellte auch er sie zwischen 1672 und 1692 in Holland.
Erst im achtzehnten Jahrhundert ist mit dem Begründer
einer berühmten Firma, mit William Caslon, ein
Schriftgießer von allgemein anerkannter Bedeutung in
England hervorgetreten. Um die Belebung der Buch-
druckerkunst Englands erwarb sich dann Robert
F o u 1 i s große Verdienste, der, 1707 in Glasgow geboren,
von einem Buchgeschmack geleitet, sich erst in seinen
dreißiger Jahren dem Buchdruck und Buchhandel zuge-
wendet hatte, und nachdem er mit seinem fünf Jahre
jüngeren Bruder Andrew von einer nach dem Kontinent
unternommenen Bucheinkaufsreise zurückgekehrt war,
1741 eine Buchdruckerei und einen Buchladen eröffnete.
Im März 1743 zum Buchdrucker der Universität Glasgow
ernannt und bis zu seinem Tode (1776, Andrew war schon
■) Schon Caslon, Englands Erstdrucker, aber keineswegs
ein Meisterdrucker, hatte seine Schrift vlämischen Vorbildern nach-
gezeichnet, ebenso ist die altenglische Schrift, die black letter,
gleichen Ursprunges. Ohne auf die niederländische Schrift-
gießereigeschichte und ihre Beziehungen auch zu Deutschland
weiter eingehen zu wollen, sei die berühmte Buchdruckerei von
Joh. Enschede en Zonen in Haarlem wenigstens kurz erwähnt,
weil sie durch planmäßige Sammelarbeit und diese begünstigenden
Zufälle in den über zwei Jahrhunderten ihres Bestehens einen be-
deutenden Druckschriftenvorrat von erheblichem, geschichtlichem
und künstlerischem Wert zusammengebrachthat, dessen Anwendung,
neuerdings auch der deutschen Buchkunstbewegung nützlich wurde.
Ausführlicher berichten über die Bestände des Enschede Schrift-
gießerei ihre den älteren Hauptschriften gewidmeten Proben, deren
Studium dem Buchkunstfreund vortrefflich in das Betrachten und
Beurteilen von Druckschriften einführen kann, das man nicht mit
den allerneuesten Druckschriften beginnen sollte.
ein Jahr vorher gestorben, Robert hatte durch andere
Unternehmungen, denen er nicht gewachsen gewesen, in
seiner Arbeitskraft sich bisweilen stark gehemmt gesehen)
blühte die Foulis Press, deren Ruhm es ist, den
Buchdurck Englands auf die damalige außerhalb dieses
Landes erreichte Höhe gebracht zu haben. John
Baskerville (1706—1775) wollte mehr, suchte bewußt
die Erneuerung der Kunst im Buchdruck. Als er 1757
die mit seinen eigenen Schriften gedruckte Quartausgabe
des Vergil veröffentlichte, machten mit ihr auch seine
Bemühungen um das schöne Buch zwar einiges Auf-
sehen, das aber doch nicht, selbst nicht durch Basker-
villes bekannteste Drucke, Milton’s Paradise Lost und
Paradise Regained (1758) tiefergehende Wirkungen hatte.
Alles in allem genommen war Baskerville, der bereits
den Einzelheiten des Druckvorganges die größte Sorgfalt
zugewendet hatte, die Druckfarben selbst bereitet hatte
und nach seinen Anweisungen das Papier hatte bestellen
lassen ein Meister geblieben, dessem edlen Streben noch
die notwendige Unterstützung durch ausreichende eigene
Kenntnisse und dem auch die notwendige Unterstützung
der anderen erfahrenen Fachgenossen fehlte. Seine
Schriftschnitte hatten eigentlich mehr Fehler als Vorzüge;
was hauptsächlich wohl daran lag, daß Baskerville für
sie mißverständlich in den englischen Schreibschriften
seiner Zeit und so auch in dem Pineschen Horaz Ablei-
tungen und Vorlagen suchte. Damit hatte er freilich die
Aldus Ansicht, Druckschrift lasse sich aus Schreibschrift
ohne Übertragung verwandeln, befolgt, eine Ansicht, die
in solcher Ausschließlichkeit nicht richtig sein kann und
die nur als gelegentliche Ausnahme (einer solchen ver-
danken wir durch glückliche Nebenumstände die Kursiv-
schrift) die Regel ihres Gegenteils bestätigt. Auch die
Versuche einer griechischen Schrift, die Baskerville auf
Bestellung der Oxforder Universitäts-Buchdruckerei her-
stellte, gelangen nur teilweise. Baskerville blieb der
äußere Erfolg versagt, der die Anstrengungen beflügelt,
eine bescheidene Stellung als Drucker der Universität
Cambridge brachte ihm nicht so viel ein, daß er seine
Gedanken großzügig, ohne ängstlich als Geschäftsmann
rechnen zu müssen, hätte verwirklichen können. Und
nach seinem Tode fand sich in England kein Nachfolger
für ihn. Sein Schriftenvorrat wurde (für £ 3700) von
einer von Beaumarchais geleiteten französischen Handels-
gesellschaft gekauft, die sie für eine sehr bekannt ge-
wordene, große, (mißlungene) Buchhändlerspekulation ver-
braucht hat, die Kehler Ausgabe von Voltaires Werken.
1789, im Revolutionsjahr, begründete Charles
Whittingham (1767—1840) den Druckereibetrieb,
der in vielfacher Weise für die englische Druckkunst-
entwicklung vorbildlich wurde, da in ihm die mechanische
Qualitätstechnik (um mit diesem Wort die Ausbildung
225
II. Die englticben Püeflen
oon
6. A. 6. Bogeng
|jas Buchwesen Englands hatte in der Epoche der
Restauration die Formen der Neuzeit angenommen.
Der Drucker trat jetzt hinter den Verleger zurück und
mit seinem eigenen Namen verbürgte er nicht mehr die
Druckleistung, die er erreichte. Auch das Gefühl für die
Kunst im Buchdruck war verschwunden, dafür, daß das
Druckerzeugnis als solches ein Auge und Hand wohlge-
fälliges, ein schönes Buch hervorbringen könne. Buch-
schönheit suchte man nun durch die Mitarbeit der Stecher
zu gewinnen, die Buchillustration machte den Buchreichtum
aus und folgerichtig führte das Bestreben seiner Vermeh-
rung auf den Chalkographen, das ganz und gar in Kupfer
gestochene Buch, dessen englisches Muster der Horaz
Pines (1733—37) ist. Andrerseits förderten mancherlei
Verbesserungen, die auch in England genutzt wurden,
wie diejenigen der Buchdruckpressen, den Druckereibetrieb,
dessen gewerbliche Leistungsfähigkeit, dessen Wirtschaft-
lichkeit sich so steigerte. Die besten Druckschriften bezog
man aus Holland, wo die Schriftgießerei eine empor-
strebende Entwicklung genommen hatte1) und als Dr.
John Fell, Dean of Christ Church, die University Press
in Oxford um 1670 mit neuen Schriften versehen wollte,
bestellte auch er sie zwischen 1672 und 1692 in Holland.
Erst im achtzehnten Jahrhundert ist mit dem Begründer
einer berühmten Firma, mit William Caslon, ein
Schriftgießer von allgemein anerkannter Bedeutung in
England hervorgetreten. Um die Belebung der Buch-
druckerkunst Englands erwarb sich dann Robert
F o u 1 i s große Verdienste, der, 1707 in Glasgow geboren,
von einem Buchgeschmack geleitet, sich erst in seinen
dreißiger Jahren dem Buchdruck und Buchhandel zuge-
wendet hatte, und nachdem er mit seinem fünf Jahre
jüngeren Bruder Andrew von einer nach dem Kontinent
unternommenen Bucheinkaufsreise zurückgekehrt war,
1741 eine Buchdruckerei und einen Buchladen eröffnete.
Im März 1743 zum Buchdrucker der Universität Glasgow
ernannt und bis zu seinem Tode (1776, Andrew war schon
■) Schon Caslon, Englands Erstdrucker, aber keineswegs
ein Meisterdrucker, hatte seine Schrift vlämischen Vorbildern nach-
gezeichnet, ebenso ist die altenglische Schrift, die black letter,
gleichen Ursprunges. Ohne auf die niederländische Schrift-
gießereigeschichte und ihre Beziehungen auch zu Deutschland
weiter eingehen zu wollen, sei die berühmte Buchdruckerei von
Joh. Enschede en Zonen in Haarlem wenigstens kurz erwähnt,
weil sie durch planmäßige Sammelarbeit und diese begünstigenden
Zufälle in den über zwei Jahrhunderten ihres Bestehens einen be-
deutenden Druckschriftenvorrat von erheblichem, geschichtlichem
und künstlerischem Wert zusammengebrachthat, dessen Anwendung,
neuerdings auch der deutschen Buchkunstbewegung nützlich wurde.
Ausführlicher berichten über die Bestände des Enschede Schrift-
gießerei ihre den älteren Hauptschriften gewidmeten Proben, deren
Studium dem Buchkunstfreund vortrefflich in das Betrachten und
Beurteilen von Druckschriften einführen kann, das man nicht mit
den allerneuesten Druckschriften beginnen sollte.
ein Jahr vorher gestorben, Robert hatte durch andere
Unternehmungen, denen er nicht gewachsen gewesen, in
seiner Arbeitskraft sich bisweilen stark gehemmt gesehen)
blühte die Foulis Press, deren Ruhm es ist, den
Buchdurck Englands auf die damalige außerhalb dieses
Landes erreichte Höhe gebracht zu haben. John
Baskerville (1706—1775) wollte mehr, suchte bewußt
die Erneuerung der Kunst im Buchdruck. Als er 1757
die mit seinen eigenen Schriften gedruckte Quartausgabe
des Vergil veröffentlichte, machten mit ihr auch seine
Bemühungen um das schöne Buch zwar einiges Auf-
sehen, das aber doch nicht, selbst nicht durch Basker-
villes bekannteste Drucke, Milton’s Paradise Lost und
Paradise Regained (1758) tiefergehende Wirkungen hatte.
Alles in allem genommen war Baskerville, der bereits
den Einzelheiten des Druckvorganges die größte Sorgfalt
zugewendet hatte, die Druckfarben selbst bereitet hatte
und nach seinen Anweisungen das Papier hatte bestellen
lassen ein Meister geblieben, dessem edlen Streben noch
die notwendige Unterstützung durch ausreichende eigene
Kenntnisse und dem auch die notwendige Unterstützung
der anderen erfahrenen Fachgenossen fehlte. Seine
Schriftschnitte hatten eigentlich mehr Fehler als Vorzüge;
was hauptsächlich wohl daran lag, daß Baskerville für
sie mißverständlich in den englischen Schreibschriften
seiner Zeit und so auch in dem Pineschen Horaz Ablei-
tungen und Vorlagen suchte. Damit hatte er freilich die
Aldus Ansicht, Druckschrift lasse sich aus Schreibschrift
ohne Übertragung verwandeln, befolgt, eine Ansicht, die
in solcher Ausschließlichkeit nicht richtig sein kann und
die nur als gelegentliche Ausnahme (einer solchen ver-
danken wir durch glückliche Nebenumstände die Kursiv-
schrift) die Regel ihres Gegenteils bestätigt. Auch die
Versuche einer griechischen Schrift, die Baskerville auf
Bestellung der Oxforder Universitäts-Buchdruckerei her-
stellte, gelangen nur teilweise. Baskerville blieb der
äußere Erfolg versagt, der die Anstrengungen beflügelt,
eine bescheidene Stellung als Drucker der Universität
Cambridge brachte ihm nicht so viel ein, daß er seine
Gedanken großzügig, ohne ängstlich als Geschäftsmann
rechnen zu müssen, hätte verwirklichen können. Und
nach seinem Tode fand sich in England kein Nachfolger
für ihn. Sein Schriftenvorrat wurde (für £ 3700) von
einer von Beaumarchais geleiteten französischen Handels-
gesellschaft gekauft, die sie für eine sehr bekannt ge-
wordene, große, (mißlungene) Buchhändlerspekulation ver-
braucht hat, die Kehler Ausgabe von Voltaires Werken.
1789, im Revolutionsjahr, begründete Charles
Whittingham (1767—1840) den Druckereibetrieb,
der in vielfacher Weise für die englische Druckkunst-
entwicklung vorbildlich wurde, da in ihm die mechanische
Qualitätstechnik (um mit diesem Wort die Ausbildung
225