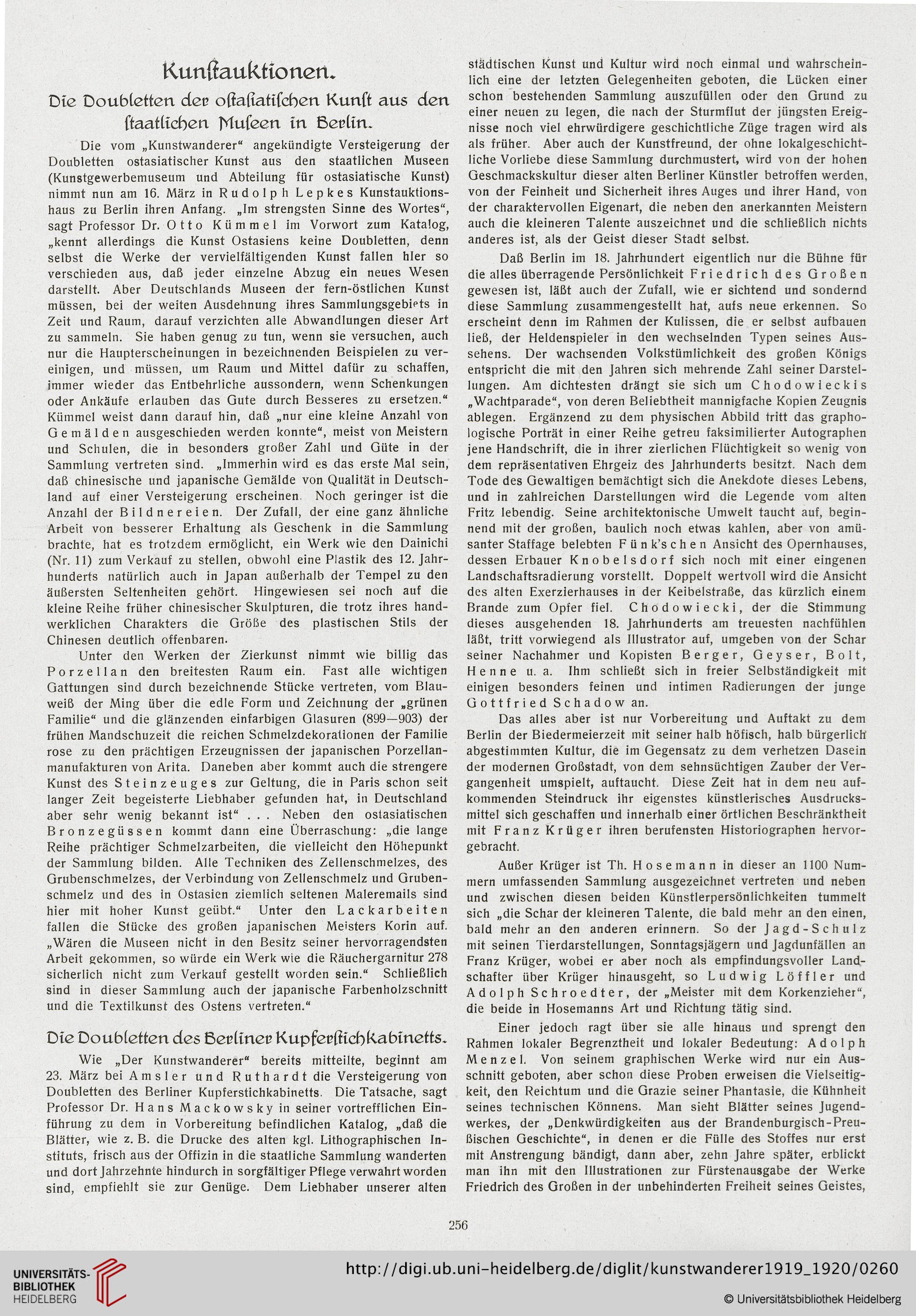Kun{faukiioneru
Die Doubletten det? offaliatifcben Kunft aus den
ftaatlicben JYfufeen in Beelin.
Die vom „Kunstwanderer“ angekündigte Versteigerung der
Doubletten ostasiatischer Kunst aus den staatlichen Museen
(Kunstgewerbemuseum und Abteilung für ostasiatische Kunst)
nimmt nun am 16. März in Rudolph Lepkes Kunstauktions-
haus zu Berlin ihren Anfang. „Im strengsten Sinne des Wortes“,
sagt Professor Dr. Otto Kümmel im Vorwort zum Katalog,
„kennt allerdings die Kunst Ostasiens keine Doubletten, denn
selbst die Werke der vervielfältigenden Kunst fallen hier so
verschieden aus, daß jeder einzelne Abzug ein neues Wesen
darstellt. Aber Deutschlands Museen der fern-östlichen Kunst
müssen, bei der weiten Ausdehnung ihres Sammlungsgebiets in
Zeit und Raum, darauf verzichten alle Abwandlungen dieser Art
zu sammeln. Sie haben genug zu tun, wenn sie versuchen, auch
nur die Haupterscheinungen in bezeichnenden Beispielen zu ver-
einigen, und müssen, um Raum und Mittel dafür zu schaffen,
immer wieder das Entbehrliche aussondern, wenn Schenkungen
oder Ankäufe erlauben das Gute durch Besseres zu ersetzen.“
Kümmel weist dann darauf hin, daß „nur eine kleine Anzahl von
Gemälden ausgeschieden werden konnte“, meist von Meistern
und Schulen, die in besonders großer Zahl und Güte in der
Sammlung vertreten sind. „Immerhin wird es das erste Mal sein,
daß chinesische und japanische Gemälde von Qualität in Deutsch-
land auf einer Versteigerung erscheinen Noch geringer ist die
Anzahl der Bildnereien. Der Zufall, der eine ganz ähnliche
Arbeit von besserer Erhaltung als Geschenk in die Sammlung
brachte, hat es trotzdem ermöglicht, ein Werk wie den Dainichi
(Nr. 11) zum Verkauf zu stellen, obwohl eine Plastik des 12. Jahr-
hunderts natürlich auch in Japan außerhalb der Tempel zu den
äußersten Seltenheiten gehört. Hingewiesen sei noch auf die
kleine Reihe früher chinesischer Skulpturen, die trotz ihres hand-
werklichen Charakters die Größe des plastischen Stils der
Chinesen deutlich offenbaren.
Unter den Werken der Zierkunst nimmt wie billig das
Porzellan den breitesten Raum ein. Fast alle wichtigen
Gattungen sind durch bezeichnende Stücke vertreten, vom Blau-
weiß der Ming über die edle Form und Zeichnung der „grünen
Familie“ und die glänzenden einfarbigen Glasuren (899—903) der
frühen Mandschuzeit die reichen Schmelzdekorationen der Familie
rose zu den prächtigen Erzeugnissen der japanischen Porzellan-
manufakturen von Arita. Daneben aber kommt auch die strengere
Kunst des Steinzeuges zur Geltung, die in Paris schon seit
langer Zeit begeisterte Liebhaber gefunden hat, in Deutschland
aber sehr wenig bekannt ist“ . . . Neben den ostasiatischen
Bronzegüssen kommt dann eine Überraschung: „die lange
Reihe prächtiger Schmelzarbeiten, die vielleicht den Höhepunkt
der Sammlung bilden. Alle Techniken des Zellenschmelzes, des
Grubenschmelzes, der Verbindung von Zellenschmelz und Gruben-
schmelz und des in Ostasien ziemlich seltenen Maleremails sind
hier mit hoher Kunst geübt.“ Unter den Lackarbeiten
fallen die Stücke des großen japanischen Meisters Korin auf.
„Wären die Museen nicht in den Besitz seiner hervorragendsten
Arbeit gekommen, so würde ein Werk wie die Räuchergarnitur 278
sicherlich nicht zum Verkauf gestellt worden sein.“ Schließlich
sind in dieser Sammlung auch der japanische Farbenholzschnitt
und die Textilkunst des Ostens vertreten.“
Die Doubletten des BettUnet? KupfecßicbKabinetts.
Wie „Der Kunstwanderer“ bereits mitteilte, beginnt am
23. März beiAmsler und Ruthardtdie Versteigerung von
Doubletten des Berliner Kupferstichkabinetts. Die Tatsache, sagt
Professor Dr. Hans Mackowsky in seiner vortrefflichen Ein-
führung zu dem in Vorbereitung befindlichen Katalog, „daß die
Blätter, wie z. B. die Drucke des alten kgl. Lithographischen In-
stituts, frisch aus der Offizin in die staatliche Sammlung wanderten
und dort Jahrzehnte hindurch in sorgfältiger Pflege verwahrt worden
sind, empfiehlt sie zur Genüge. Dem Liebhaber unserer alten
städtischen Kunst und Kultur wird noch einmal und wahrschein-
lich eine der letzten Gelegenheiten geboten, die Lücken einer
schon bestehenden Sammlung auszufüllen oder den Grund zu
einer neuen zu legen, die nach der Sturmflut der jüngsten Ereig-
nisse noch viel ehrwürdigere geschichtliche Züge tragen wird als
als früher. Aber auch der Kunstfreund, der ohne lokalgeschicht-
liche Vorliebe diese Sammlung durchmustert, wird von der hohen
Geschmackskultur dieser alten Berliner Künstler betroffen werden,
von der Feinheit und Sicherheit ihres Auges und ihrer Hand, von
der charaktervollen Eigenart, die neben den anerkannten Meistern
auch die kleineren Talente auszeichnet und die schließlich nichts
anderes ist, als der Geist dieser Stadt selbst.
Daß Berlin im 18. Jahrhundert eigentlich nur die Bühne für
die alles überragende Persönlichkeit Friedrich des Großen
gewesen ist, läßt auch der Zufall, wie er sichtend und sondernd
diese Sammlung zusammengestellt hat, aufs neue erkennen. So
erscheint denn im Rahmen der Kulissen, die er selbst aufbauen
ließ, der Heldenspieler in den wechselnden Typen seines Aus-
sehens. Der wachsenden Volkstümlichkeit des großen Königs
entspricht die mit den Jahren sich mehrende Zahl seiner Darstel-
lungen. Am dichtesten drängt sie sich um Chodowieckis
„Wachtparade“, von deren Beliebtheit mannigfache Kopien Zeugnis
ablegen. Ergänzend zu dem physischen Abbild tritt das grapho-
logische Porträt in einer Reihe getreu faksimilierter Autographen
jene Handschrift, die in ihrer zierlichen Flüchtigkeit so wenig von
dem repräsentativen Ehrgeiz des Jahrhunderts besitzt. Nach dem
Tode des Gewaltigen bemächtigt sich die Anekdote dieses Lebens,
und in zahlreichen Darstellungen wird die Legende vom alten
Fritz lebendig. Seine architektonische Umwelt taucht auf, begin-
nend mit der großen, baulich noch etwas kahlen, aber von amü-
santer Staffage belebten F ü n k’s c h e n Ansicht des Opernhauses,
dessen Erbauer Knobelsdorf sich noch mit einer eingenen
Landschaftsradierung vorstellt. Doppelt wertvoll wird die Ansicht
des alten Exerzierhauses in der Keibelstraße, das kürzlich einem
Brande zum Opfer fiel. Chodowiecki, der die Stimmung
dieses ausgehenden 18. Jahrhunderts am treuesten nachfühlen
läßt, tritt vorwiegend als Illustrator auf, umgeben von der Schar
seiner Nachahmer und Kopisten Berger, Geyser, Bolt,
Henne u. a. Ihm schließt sich in freier Selbständigkeit mit
einigen besonders feinen und intimen Radierungen der junge
Gottfried Schadow an.
Das alles aber ist nur Vorbereitung und Auftakt zu dem
Berlin der Biedermeierzeit mit seiner halb höfisch, halb bürgerlich
abgestimmten Kultur, die im Gegensatz zu dem verhetzen Dasein
der modernen Großstadt, von dem sehnsüchtigen Zauber der Ver-
gangenheit umspielt, auftaucht. Diese Zeit hat in dem neu auf-
kommenden Steindruck ihr eigenstes künstlerisches Ausdrucks-
mittel sich geschaffen und innerhalb einer örtlichen Beschränktheit
mit Franz Krüger ihren berufensten Historiographen hervor-
gebracht.
Außer Krüger ist Th. Hosemann in dieser an 1100 Num-
mern umfassenden Sammlung ausgezeichnet vertreten und neben
und zwischen diesen beiden Künstlerpersönlichkeiten tummelt
sich „die Schar der kleineren Talente, die bald mehr an den einen,
bald mehr an den anderen erinnern. So der Jagd-Schulz
mit seinen Tierdarstellungen, Sonntagsjägern und Jagdunfällen an
Franz Krüger, wobei er aber noch als empfindungsvoller Land-
schafter über Krüger hinausgeht, so Ludwig Löffler und
Adolph Schroedter, der „Meister mit dem Korkenzieher“,
die beide in Hosemanns Art und Richtung tätig sind.
Einer jedoch ragt über sie alle hinaus und sprengt den
Rahmen lokaler Begrenztheit und lokaler Bedeutung: Adolph
Menzel. Von seinem graphischen Werke wird nur ein Aus-
schnitt geboten, aber schon diese Proben erweisen die Vielseitig-
keit, den Reichtum und die Grazie seiner Phantasie, die Kühnheit
seines technischen Könnens. Man sieht Blätter seines Jugend-
werkes, der „Denkwürdigkeiten aus der Brandenburgisch-Preu-
ßischen Geschichte“, in denen er die Fülle des Stoffes nur erst
mit Anstrengung bändigt, dann aber, zehn Jahre später, erblickt
man ihn mit den Illustrationen zur Fürstenausgabe der Werke
Friedrich des Großen in der unbehinderten Freiheit seines Geistes,
256
Die Doubletten det? offaliatifcben Kunft aus den
ftaatlicben JYfufeen in Beelin.
Die vom „Kunstwanderer“ angekündigte Versteigerung der
Doubletten ostasiatischer Kunst aus den staatlichen Museen
(Kunstgewerbemuseum und Abteilung für ostasiatische Kunst)
nimmt nun am 16. März in Rudolph Lepkes Kunstauktions-
haus zu Berlin ihren Anfang. „Im strengsten Sinne des Wortes“,
sagt Professor Dr. Otto Kümmel im Vorwort zum Katalog,
„kennt allerdings die Kunst Ostasiens keine Doubletten, denn
selbst die Werke der vervielfältigenden Kunst fallen hier so
verschieden aus, daß jeder einzelne Abzug ein neues Wesen
darstellt. Aber Deutschlands Museen der fern-östlichen Kunst
müssen, bei der weiten Ausdehnung ihres Sammlungsgebiets in
Zeit und Raum, darauf verzichten alle Abwandlungen dieser Art
zu sammeln. Sie haben genug zu tun, wenn sie versuchen, auch
nur die Haupterscheinungen in bezeichnenden Beispielen zu ver-
einigen, und müssen, um Raum und Mittel dafür zu schaffen,
immer wieder das Entbehrliche aussondern, wenn Schenkungen
oder Ankäufe erlauben das Gute durch Besseres zu ersetzen.“
Kümmel weist dann darauf hin, daß „nur eine kleine Anzahl von
Gemälden ausgeschieden werden konnte“, meist von Meistern
und Schulen, die in besonders großer Zahl und Güte in der
Sammlung vertreten sind. „Immerhin wird es das erste Mal sein,
daß chinesische und japanische Gemälde von Qualität in Deutsch-
land auf einer Versteigerung erscheinen Noch geringer ist die
Anzahl der Bildnereien. Der Zufall, der eine ganz ähnliche
Arbeit von besserer Erhaltung als Geschenk in die Sammlung
brachte, hat es trotzdem ermöglicht, ein Werk wie den Dainichi
(Nr. 11) zum Verkauf zu stellen, obwohl eine Plastik des 12. Jahr-
hunderts natürlich auch in Japan außerhalb der Tempel zu den
äußersten Seltenheiten gehört. Hingewiesen sei noch auf die
kleine Reihe früher chinesischer Skulpturen, die trotz ihres hand-
werklichen Charakters die Größe des plastischen Stils der
Chinesen deutlich offenbaren.
Unter den Werken der Zierkunst nimmt wie billig das
Porzellan den breitesten Raum ein. Fast alle wichtigen
Gattungen sind durch bezeichnende Stücke vertreten, vom Blau-
weiß der Ming über die edle Form und Zeichnung der „grünen
Familie“ und die glänzenden einfarbigen Glasuren (899—903) der
frühen Mandschuzeit die reichen Schmelzdekorationen der Familie
rose zu den prächtigen Erzeugnissen der japanischen Porzellan-
manufakturen von Arita. Daneben aber kommt auch die strengere
Kunst des Steinzeuges zur Geltung, die in Paris schon seit
langer Zeit begeisterte Liebhaber gefunden hat, in Deutschland
aber sehr wenig bekannt ist“ . . . Neben den ostasiatischen
Bronzegüssen kommt dann eine Überraschung: „die lange
Reihe prächtiger Schmelzarbeiten, die vielleicht den Höhepunkt
der Sammlung bilden. Alle Techniken des Zellenschmelzes, des
Grubenschmelzes, der Verbindung von Zellenschmelz und Gruben-
schmelz und des in Ostasien ziemlich seltenen Maleremails sind
hier mit hoher Kunst geübt.“ Unter den Lackarbeiten
fallen die Stücke des großen japanischen Meisters Korin auf.
„Wären die Museen nicht in den Besitz seiner hervorragendsten
Arbeit gekommen, so würde ein Werk wie die Räuchergarnitur 278
sicherlich nicht zum Verkauf gestellt worden sein.“ Schließlich
sind in dieser Sammlung auch der japanische Farbenholzschnitt
und die Textilkunst des Ostens vertreten.“
Die Doubletten des BettUnet? KupfecßicbKabinetts.
Wie „Der Kunstwanderer“ bereits mitteilte, beginnt am
23. März beiAmsler und Ruthardtdie Versteigerung von
Doubletten des Berliner Kupferstichkabinetts. Die Tatsache, sagt
Professor Dr. Hans Mackowsky in seiner vortrefflichen Ein-
führung zu dem in Vorbereitung befindlichen Katalog, „daß die
Blätter, wie z. B. die Drucke des alten kgl. Lithographischen In-
stituts, frisch aus der Offizin in die staatliche Sammlung wanderten
und dort Jahrzehnte hindurch in sorgfältiger Pflege verwahrt worden
sind, empfiehlt sie zur Genüge. Dem Liebhaber unserer alten
städtischen Kunst und Kultur wird noch einmal und wahrschein-
lich eine der letzten Gelegenheiten geboten, die Lücken einer
schon bestehenden Sammlung auszufüllen oder den Grund zu
einer neuen zu legen, die nach der Sturmflut der jüngsten Ereig-
nisse noch viel ehrwürdigere geschichtliche Züge tragen wird als
als früher. Aber auch der Kunstfreund, der ohne lokalgeschicht-
liche Vorliebe diese Sammlung durchmustert, wird von der hohen
Geschmackskultur dieser alten Berliner Künstler betroffen werden,
von der Feinheit und Sicherheit ihres Auges und ihrer Hand, von
der charaktervollen Eigenart, die neben den anerkannten Meistern
auch die kleineren Talente auszeichnet und die schließlich nichts
anderes ist, als der Geist dieser Stadt selbst.
Daß Berlin im 18. Jahrhundert eigentlich nur die Bühne für
die alles überragende Persönlichkeit Friedrich des Großen
gewesen ist, läßt auch der Zufall, wie er sichtend und sondernd
diese Sammlung zusammengestellt hat, aufs neue erkennen. So
erscheint denn im Rahmen der Kulissen, die er selbst aufbauen
ließ, der Heldenspieler in den wechselnden Typen seines Aus-
sehens. Der wachsenden Volkstümlichkeit des großen Königs
entspricht die mit den Jahren sich mehrende Zahl seiner Darstel-
lungen. Am dichtesten drängt sie sich um Chodowieckis
„Wachtparade“, von deren Beliebtheit mannigfache Kopien Zeugnis
ablegen. Ergänzend zu dem physischen Abbild tritt das grapho-
logische Porträt in einer Reihe getreu faksimilierter Autographen
jene Handschrift, die in ihrer zierlichen Flüchtigkeit so wenig von
dem repräsentativen Ehrgeiz des Jahrhunderts besitzt. Nach dem
Tode des Gewaltigen bemächtigt sich die Anekdote dieses Lebens,
und in zahlreichen Darstellungen wird die Legende vom alten
Fritz lebendig. Seine architektonische Umwelt taucht auf, begin-
nend mit der großen, baulich noch etwas kahlen, aber von amü-
santer Staffage belebten F ü n k’s c h e n Ansicht des Opernhauses,
dessen Erbauer Knobelsdorf sich noch mit einer eingenen
Landschaftsradierung vorstellt. Doppelt wertvoll wird die Ansicht
des alten Exerzierhauses in der Keibelstraße, das kürzlich einem
Brande zum Opfer fiel. Chodowiecki, der die Stimmung
dieses ausgehenden 18. Jahrhunderts am treuesten nachfühlen
läßt, tritt vorwiegend als Illustrator auf, umgeben von der Schar
seiner Nachahmer und Kopisten Berger, Geyser, Bolt,
Henne u. a. Ihm schließt sich in freier Selbständigkeit mit
einigen besonders feinen und intimen Radierungen der junge
Gottfried Schadow an.
Das alles aber ist nur Vorbereitung und Auftakt zu dem
Berlin der Biedermeierzeit mit seiner halb höfisch, halb bürgerlich
abgestimmten Kultur, die im Gegensatz zu dem verhetzen Dasein
der modernen Großstadt, von dem sehnsüchtigen Zauber der Ver-
gangenheit umspielt, auftaucht. Diese Zeit hat in dem neu auf-
kommenden Steindruck ihr eigenstes künstlerisches Ausdrucks-
mittel sich geschaffen und innerhalb einer örtlichen Beschränktheit
mit Franz Krüger ihren berufensten Historiographen hervor-
gebracht.
Außer Krüger ist Th. Hosemann in dieser an 1100 Num-
mern umfassenden Sammlung ausgezeichnet vertreten und neben
und zwischen diesen beiden Künstlerpersönlichkeiten tummelt
sich „die Schar der kleineren Talente, die bald mehr an den einen,
bald mehr an den anderen erinnern. So der Jagd-Schulz
mit seinen Tierdarstellungen, Sonntagsjägern und Jagdunfällen an
Franz Krüger, wobei er aber noch als empfindungsvoller Land-
schafter über Krüger hinausgeht, so Ludwig Löffler und
Adolph Schroedter, der „Meister mit dem Korkenzieher“,
die beide in Hosemanns Art und Richtung tätig sind.
Einer jedoch ragt über sie alle hinaus und sprengt den
Rahmen lokaler Begrenztheit und lokaler Bedeutung: Adolph
Menzel. Von seinem graphischen Werke wird nur ein Aus-
schnitt geboten, aber schon diese Proben erweisen die Vielseitig-
keit, den Reichtum und die Grazie seiner Phantasie, die Kühnheit
seines technischen Könnens. Man sieht Blätter seines Jugend-
werkes, der „Denkwürdigkeiten aus der Brandenburgisch-Preu-
ßischen Geschichte“, in denen er die Fülle des Stoffes nur erst
mit Anstrengung bändigt, dann aber, zehn Jahre später, erblickt
man ihn mit den Illustrationen zur Fürstenausgabe der Werke
Friedrich des Großen in der unbehinderten Freiheit seines Geistes,
256