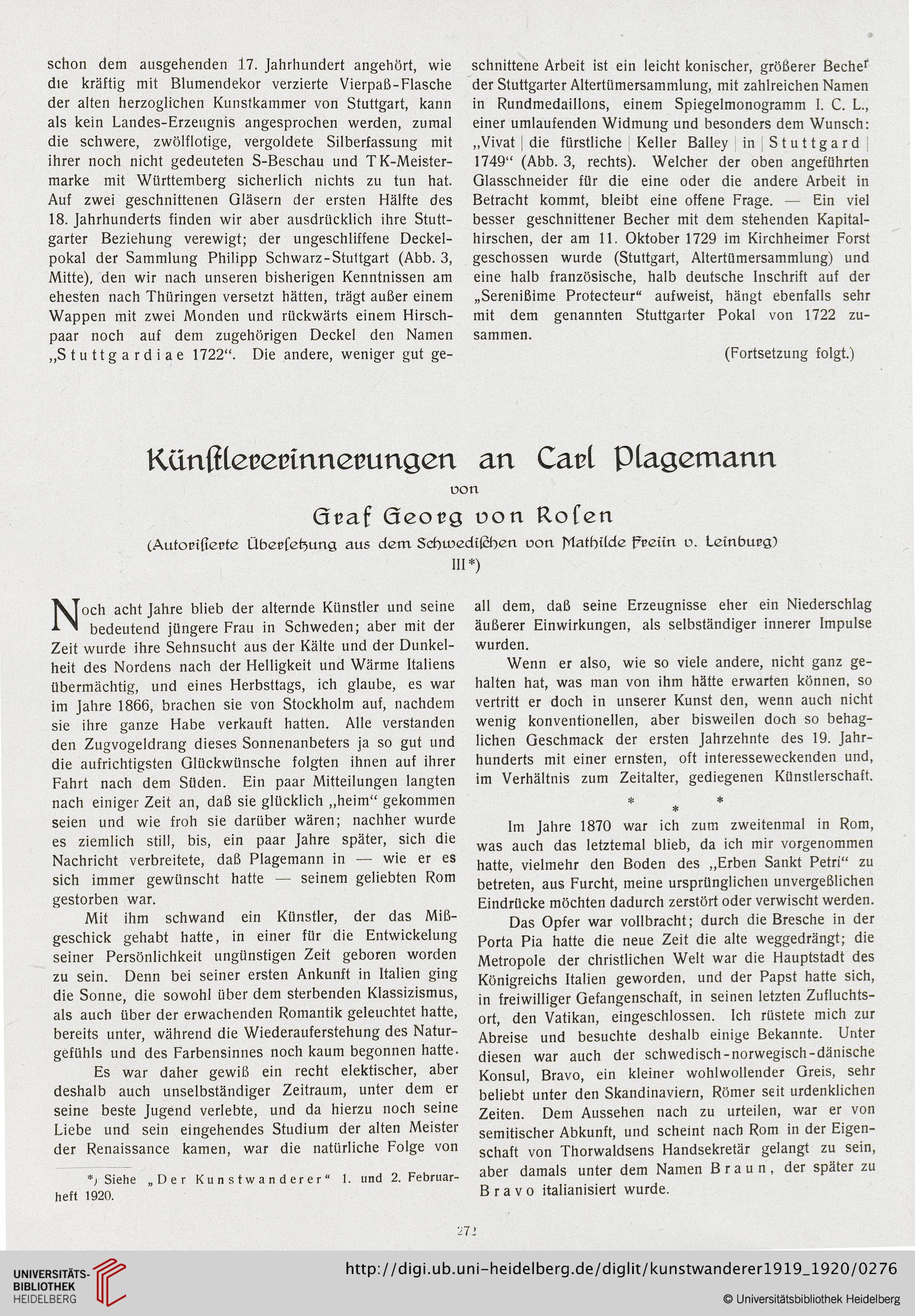schon dem ausgehenden 17. Jahrhundert angehört, wie
die kräftig mit Blumendekor verzierte Vierpaß-Flasche
der alten herzoglichen Kunstkammer von Stuttgart, kann
als kein Landes-Erzeugnis angesprochen werden, zumal
die schwere, zwölflotige, vergoldete Silberfassung mit
ihrer noch nicht gedeuteten S-Beschau und TK-Meister-
marke mit Württemberg sicherlich nichts zu tun hat.
Auf zwei geschnittenen Gläsern der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts finden wir aber ausdrücklich ihre Stutt-
garter Beziehung verewigt; der ungeschliffene Deckel-
pokal der Sammlung Philipp Schwarz-Stuttgart (Abb. 3,
Mitte), den wir nach unseren bisherigen Kenntnissen am
ehesten nach Thüringen versetzt hätten, trägt außer einem
Wappen mit zwei Monden und rückwärts einem Hirsch-
paar noch auf dem zugehörigen Deckel den Namen
,,S t u 11 g a r d i a e 1722“. Die andere, weniger gut ge-
schnittene Arbeit ist ein leicht konischer, größerer Bechet
der Stuttgarter Altertümersammlung, mit zahlreichen Namen
in Rundmedaillons, einem Spiegelmonogramm I. C. L.,
einer umlaufenden Widmung und besonders dem Wunsch:
„Vivat ] die fürstliche Keller Balley in Stuttgard
1749“ (Abb. 3, rechts). Welcher der oben angeführten
Glasschneider für die eine oder die andere Arbeit in
Betracht kommt, bleibt eine offene Frage. — Ein viel
besser geschnittener Becher mit dem stehenden Kapital-
hirschen, der am 11. Oktober 1729 im Kirchheimer Forst
geschossen wurde (Stuttgart, Altertümersammlung) und
eine halb französische, halb deutsche Inschrift auf der
„Serenißime Protecteur“ aufweist, hängt ebenfalls sehr
mit dem genannten Stuttgarter Pokal von 1722 zu-
sammen.
(Fortsetzung folgt.)
Kün{tlet’eümnet?urigen an Cat?l plagemann
oon
Qt’af öeocg oon Rofen
(Autotnfierte Übeefet^ung aus dem Scbu?edi(cben oon Mathilde freim o. Leinburg)
111*)
Noch acht Jahre blieb der alternde Künstler und seine
bedeutend jüngere Frau in Schweden; aber mit der
Zeit wurde ihre Sehnsucht aus der Kälte und der Dunkel-
heit des Nordens nach der Helligkeit und Wärme Italiens
übermächtig, und eines Herbsttags, ich glaube, es war
im Jahre 1866, brachen sie von Stockholm auf, nachdem
sie ihre ganze Habe verkauft hatten. Alle verstanden
den Zugvogeldrang dieses Sonnenanbeters ja so gut und
die aufrichtigsten Glückwünsche folgten ihnen auf ihrer
Fahrt nach dem Süden. Ein paar Mitteilungen langten
nach einiger Zeit an, daß sie glücklich „heim“ gekommen
seien und wie froh sie darüber wären; nachher wurde
es ziemlich still, bis, ein paar Jahre später, sich die
Nachricht verbreitete, daß Plagemann in — wie er es
sich immer gewünscht hatte — seinem geliebten Rom
gestorben war.
Mit ihm schwand ein Künstler, der das Miß-
geschick gehabt hatte, in einer für die Entwickelung
seiner Persönlichkeit ungünstigen Zeit geboren worden
zu sein. Denn bei seiner ersten Ankunft in Italien ging
die Sonne, die sowohl über dem sterbenden Klassizismus,
als auch über der erwachenden Romantik geleuchtet hatte,
bereits unter, während die Wiederauferstehung des Natur-
gefühls und des Farbensinnes noch kaum begonnen hatte.
Es war daher gewiß ein recht elektischer, aber
deshalb auch unselbständiger Zeitraum, unter dem er
seine beste Jugend verlebte, und da hierzu noch seine
Liebe und sein eingehendes Studium der alten Meister
der Renaissance kamen, war die natürliche Folge von
*> Siehe „Der Kunstwanderer“ 1. und 2. Februar-
heft 1920.
all dem, daß seine Erzeugnisse eher ein Niederschlag
äußerer Einwirkungen, als selbständiger innerer Impulse
wurden.
Wenn er also, wie so viele andere, nicht ganz ge-
halten hat, was man von ihm hätte erwarten können, so
vertritt er doch in unserer Kunst den, wenn auch nicht
wenig konventionellen, aber bisweilen doch so behag-
lichen Geschmack der ersten Jahrzehnte des 19. Jahr-
hunderts mit einer ernsten, oft interesseweckenden und,
im Verhältnis zum Zeitalter, gediegenen Künstlerschaft.
* *
*
Im Jahre 1870 war ich zum zweitenmal in Rom,
was auch das letztemal blieb, da ich mir vorgenommen
hatte, vielmehr den Boden des „Erben Sankt Petri“ zu
betreten, aus Furcht, meine ursprünglichen unvergeßlichen
Eindrücke möchten dadurch zerstört oder verwischt werden.
Das Opfer war vollbracht; durch die Bresche in der
Porta Pia hatte die neue Zeit die alte weggedrängt; die
Metropole der christlichen Welt war die Hauptstadt des
Königreichs Italien geworden, und der Papst hatte sich,
in freiwilliger Gefangenschaft, in seinen letzten Zufluchts-
ort, den Vatikan, eingeschlossen. Ich rüstete mich zur
Abreise und besuchte deshalb einige Bekannte. Unter
diesen war auch der schwedisch-norwegisch-dänische
Konsul, Bravo, ein kleiner wohlwollender Greis, sehr
beliebt unter den Skandinaviern, Römer seit urdenklichen
Zeiten. Dem Aussehen nach zu urteilen, war er von
semitischer Abkunft, und scheint nach Rom in der Eigen-
schaft von Thorwaldsens Handsekretär gelangt zu sein,
aber damals unter dem Namen Braun, der später zu
Bravo italianisiert wurde.
die kräftig mit Blumendekor verzierte Vierpaß-Flasche
der alten herzoglichen Kunstkammer von Stuttgart, kann
als kein Landes-Erzeugnis angesprochen werden, zumal
die schwere, zwölflotige, vergoldete Silberfassung mit
ihrer noch nicht gedeuteten S-Beschau und TK-Meister-
marke mit Württemberg sicherlich nichts zu tun hat.
Auf zwei geschnittenen Gläsern der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts finden wir aber ausdrücklich ihre Stutt-
garter Beziehung verewigt; der ungeschliffene Deckel-
pokal der Sammlung Philipp Schwarz-Stuttgart (Abb. 3,
Mitte), den wir nach unseren bisherigen Kenntnissen am
ehesten nach Thüringen versetzt hätten, trägt außer einem
Wappen mit zwei Monden und rückwärts einem Hirsch-
paar noch auf dem zugehörigen Deckel den Namen
,,S t u 11 g a r d i a e 1722“. Die andere, weniger gut ge-
schnittene Arbeit ist ein leicht konischer, größerer Bechet
der Stuttgarter Altertümersammlung, mit zahlreichen Namen
in Rundmedaillons, einem Spiegelmonogramm I. C. L.,
einer umlaufenden Widmung und besonders dem Wunsch:
„Vivat ] die fürstliche Keller Balley in Stuttgard
1749“ (Abb. 3, rechts). Welcher der oben angeführten
Glasschneider für die eine oder die andere Arbeit in
Betracht kommt, bleibt eine offene Frage. — Ein viel
besser geschnittener Becher mit dem stehenden Kapital-
hirschen, der am 11. Oktober 1729 im Kirchheimer Forst
geschossen wurde (Stuttgart, Altertümersammlung) und
eine halb französische, halb deutsche Inschrift auf der
„Serenißime Protecteur“ aufweist, hängt ebenfalls sehr
mit dem genannten Stuttgarter Pokal von 1722 zu-
sammen.
(Fortsetzung folgt.)
Kün{tlet’eümnet?urigen an Cat?l plagemann
oon
Qt’af öeocg oon Rofen
(Autotnfierte Übeefet^ung aus dem Scbu?edi(cben oon Mathilde freim o. Leinburg)
111*)
Noch acht Jahre blieb der alternde Künstler und seine
bedeutend jüngere Frau in Schweden; aber mit der
Zeit wurde ihre Sehnsucht aus der Kälte und der Dunkel-
heit des Nordens nach der Helligkeit und Wärme Italiens
übermächtig, und eines Herbsttags, ich glaube, es war
im Jahre 1866, brachen sie von Stockholm auf, nachdem
sie ihre ganze Habe verkauft hatten. Alle verstanden
den Zugvogeldrang dieses Sonnenanbeters ja so gut und
die aufrichtigsten Glückwünsche folgten ihnen auf ihrer
Fahrt nach dem Süden. Ein paar Mitteilungen langten
nach einiger Zeit an, daß sie glücklich „heim“ gekommen
seien und wie froh sie darüber wären; nachher wurde
es ziemlich still, bis, ein paar Jahre später, sich die
Nachricht verbreitete, daß Plagemann in — wie er es
sich immer gewünscht hatte — seinem geliebten Rom
gestorben war.
Mit ihm schwand ein Künstler, der das Miß-
geschick gehabt hatte, in einer für die Entwickelung
seiner Persönlichkeit ungünstigen Zeit geboren worden
zu sein. Denn bei seiner ersten Ankunft in Italien ging
die Sonne, die sowohl über dem sterbenden Klassizismus,
als auch über der erwachenden Romantik geleuchtet hatte,
bereits unter, während die Wiederauferstehung des Natur-
gefühls und des Farbensinnes noch kaum begonnen hatte.
Es war daher gewiß ein recht elektischer, aber
deshalb auch unselbständiger Zeitraum, unter dem er
seine beste Jugend verlebte, und da hierzu noch seine
Liebe und sein eingehendes Studium der alten Meister
der Renaissance kamen, war die natürliche Folge von
*> Siehe „Der Kunstwanderer“ 1. und 2. Februar-
heft 1920.
all dem, daß seine Erzeugnisse eher ein Niederschlag
äußerer Einwirkungen, als selbständiger innerer Impulse
wurden.
Wenn er also, wie so viele andere, nicht ganz ge-
halten hat, was man von ihm hätte erwarten können, so
vertritt er doch in unserer Kunst den, wenn auch nicht
wenig konventionellen, aber bisweilen doch so behag-
lichen Geschmack der ersten Jahrzehnte des 19. Jahr-
hunderts mit einer ernsten, oft interesseweckenden und,
im Verhältnis zum Zeitalter, gediegenen Künstlerschaft.
* *
*
Im Jahre 1870 war ich zum zweitenmal in Rom,
was auch das letztemal blieb, da ich mir vorgenommen
hatte, vielmehr den Boden des „Erben Sankt Petri“ zu
betreten, aus Furcht, meine ursprünglichen unvergeßlichen
Eindrücke möchten dadurch zerstört oder verwischt werden.
Das Opfer war vollbracht; durch die Bresche in der
Porta Pia hatte die neue Zeit die alte weggedrängt; die
Metropole der christlichen Welt war die Hauptstadt des
Königreichs Italien geworden, und der Papst hatte sich,
in freiwilliger Gefangenschaft, in seinen letzten Zufluchts-
ort, den Vatikan, eingeschlossen. Ich rüstete mich zur
Abreise und besuchte deshalb einige Bekannte. Unter
diesen war auch der schwedisch-norwegisch-dänische
Konsul, Bravo, ein kleiner wohlwollender Greis, sehr
beliebt unter den Skandinaviern, Römer seit urdenklichen
Zeiten. Dem Aussehen nach zu urteilen, war er von
semitischer Abkunft, und scheint nach Rom in der Eigen-
schaft von Thorwaldsens Handsekretär gelangt zu sein,
aber damals unter dem Namen Braun, der später zu
Bravo italianisiert wurde.