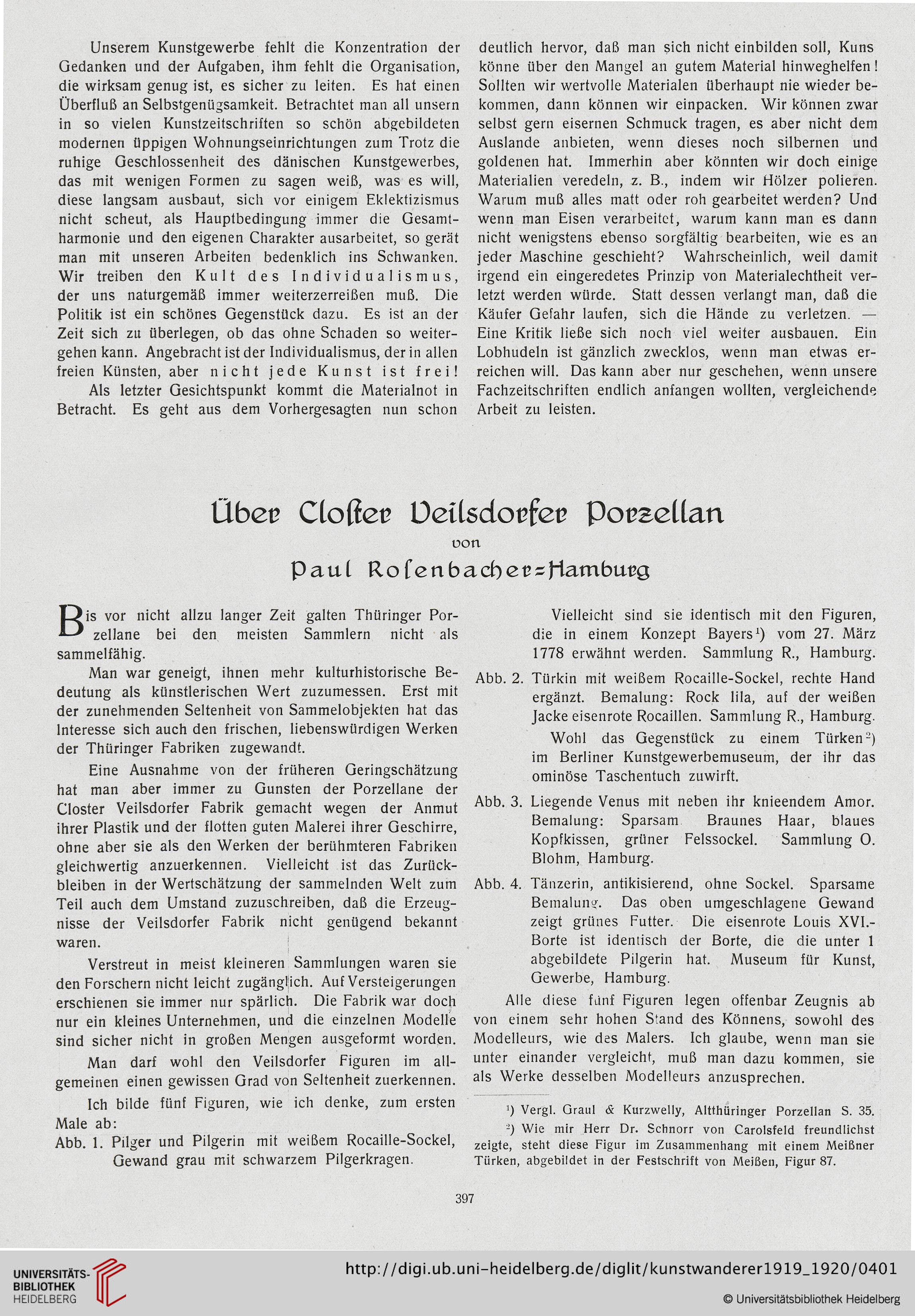Unserem Kunstgewerbe fehlt die Konzentration der
Gedanken und der Aufgaben, ihm fehlt die Organisation,
die wirksam genug ist, es sicher zu leiten. Es hat einen
Überfluß an Selbstgenügsamkeit. Betrachtet man all unsern
in so vielen Kunstzeitschriften so schön abgebildeten
modernen üppigen Wohnungseinrichtungen zum Trotz die
ruhige Geschlossenheit des dänischen Kunstgewerbes,
das mit wenigen Formen zu sagen weiß, was es will,
diese langsam ausbaut, sich vor einigem Eklektizismus
nicht scheut, als Hauptbedingung immer die Gesamt-
harmonie und den eigenen Charakter ausarbeitet, so gerät
man mit unseren Arbeiten bedenklich ins Schwanken.
Wir treiben den Kult des Individualismus,
der uns naturgemäß immer weiterzerreißen muß. Die
Politik ist ein schönes Gegenstück dazu. Es ist an der
Zeit sich zu überlegen, ob das ohne Schaden so weiter-
gehen kann. Angebracht ist der Individualismus, der in allen
freien Künsten, aber nicht jede Kunst ist frei!
Als letzter Gesichtspunkt kommt die Materialnot in
Betracht. Es geht aus dem Vorhergesagten nun schon
deutlich hervor, daß man sich nicht einbilden soll, Kuns
könne über den Mangel an gutem Material hinweghelfen!
Sollten wir wertvolle Materialen überhaupt nie wieder be-
kommen, dann können wir einpacken. Wir können zwar
selbst gern eisernen Schmuck tragen, es aber nicht dem
Auslande anbieten, wenn dieses noch silbernen und
goldenen hat. Immerhin aber könnten wir doch einige
Materialien veredeln, z. B., indem wir Hölzer polieren.
Warum muß alles matt oder roh gearbeitet werden? Und
wenn man Eisen verarbeitet, warum kann man es dann
nicht wenigstens ebenso sorgfältig bearbeiten, wie es an
jeder Maschine geschieht? Wahrscheinlich, weil damit
irgend ein eingeredetes Prinzip von Materialechtheit ver-
letzt werden würde. Statt dessen verlangt man, daß die
Käufer Gefahr laufen, sich die Hände zu verletzen. —
Eine Kritik ließe sich noch viel weiter ausbauen. Ein
Lobhudeln ist gänzlich zwecklos, wenn man etwas er-
reichen will. Das kann aber nur geschehen, wenn unsere
Fachzeitschriften endlich anfangen wollten, vergleichende
Arbeit zu leisten.
Übet? Cloffet? DeUsdot?£et? Poesedan
non
Paul Rofenbacbet^Hambupg
Bis vor nicht allzu langer Zeit galten Thüringer Por-
zellane bei den meisten Sammlern nicht als
sammelfähig.
Man war geneigt, ihnen mehr kulturhistorische Be-
deutung als künstlerischen Wert zuzumessen. Erst mit
der zunehmenden Seltenheit von Sammelobjekten hat das
Interesse sich auch den frischen, liebenswürdigen Werken
der Thüringer Fabriken zugewandt.
Eine Ausnahme von der früheren Geringschätzung
hat man aber immer zu Gunsten der Porzellane der
Closter Veilsdorfer Fabrik gemacht wegen der Anmut
ihrer Plastik und der flotten guten Malerei ihrer Geschirre,
ohne aber sie als den Werken der berühmteren Fabriken
gleichwertig anzueikennen. Vielleicht ist das Zurück-
bleiben in der Wertschätzung der sammelnden Welt zum
Teil auch dem Umstand zuzuschreiben, daß die Erzeug-
nisse der Veilsdorfer Fabrik nicht genügend bekannt
waren.
Verstreut in meist kleineren Sammlungen waren sie
den Forschern nicht leicht zugänglich. Auf Versteigerungen
erschienen sie immer nur spärlich. Die Fabrik war doch
nur ein kleines Unternehmen, und die einzelnen Modelle
sind sicher nicht in großen Mengen ausgeformt worden.
Man darf wohl den Veilsdorfer Figuren im all-
gemeinen einen gewissen Grad von Seltenheit zuerkennen.
Ich bilde fünf Figuren, wie ich denke, zum ersten
Male ab:
Abb. 1. Pilger und Pilgerin mit weißem Rocaille-Sockel,
Gewand grau mit schwarzem Pilgerkragen.
Vielleicht sind sie identisch mit den Figuren,
die in einem Konzept Bayers1) vom 27. März
1778 erwähnt werden. Sammlung R., Hamburg.
Abb. 2. Türkin mit weißem Rocaille-Sockel, rechte Hand
ergänzt. Bemalung: Rock lila, auf der weißen
Jacke eisenrote Rocaillen. Sammlung R., Hamburg.
Wohl das Gegenstück zu einem Türken2)
im Berliner Kunstgewerbemuseum, der ihr das
ominöse Taschentuch zuwirft.
Abb. 3. Liegende Venus mit neben ihr knieendem Amor.
Bemalung: Sparsam Braunes Haar, blaues
Kopfkissen, grüner Felssockel. Sammlung 0.
Blohm, Hamburg.
Abb. 4. Tänzerin, antikisierend, ohne Sockel. Sparsame
Bemalung. Das oben umgeschlagene Gewand
zeigt grünes Futter. Die eisenrote Louis XVI.-
Borte ist identisch der Borte, die die unter 1
abgebildete Pilgerin hat. Museum für Kunst,
Gewerbe, Hamburg.
Alle diese fünf Figuren legen offenbar Zeugnis ab
von einem sehr hohen Stand des Könnens, sowohl des
Modelleurs, wie des Malers. Ich glaube, wenn man sie
unter einander vergleicht, muß man dazu kommen, sie
als Werke desselben Modelleurs anzusprechen.
’) Vergl. Graul & Kurzwelly, Altthüringer Porzellan S. 35.
2) Wie mir Herr Dr. Schnorr von Carolsfeld freundlichst
zeigte, steht diese Figur im Zusammenhang mit einem Meißner
Türken, abgebildet in der Festschrift von Meißen, Figur 87.
397
Gedanken und der Aufgaben, ihm fehlt die Organisation,
die wirksam genug ist, es sicher zu leiten. Es hat einen
Überfluß an Selbstgenügsamkeit. Betrachtet man all unsern
in so vielen Kunstzeitschriften so schön abgebildeten
modernen üppigen Wohnungseinrichtungen zum Trotz die
ruhige Geschlossenheit des dänischen Kunstgewerbes,
das mit wenigen Formen zu sagen weiß, was es will,
diese langsam ausbaut, sich vor einigem Eklektizismus
nicht scheut, als Hauptbedingung immer die Gesamt-
harmonie und den eigenen Charakter ausarbeitet, so gerät
man mit unseren Arbeiten bedenklich ins Schwanken.
Wir treiben den Kult des Individualismus,
der uns naturgemäß immer weiterzerreißen muß. Die
Politik ist ein schönes Gegenstück dazu. Es ist an der
Zeit sich zu überlegen, ob das ohne Schaden so weiter-
gehen kann. Angebracht ist der Individualismus, der in allen
freien Künsten, aber nicht jede Kunst ist frei!
Als letzter Gesichtspunkt kommt die Materialnot in
Betracht. Es geht aus dem Vorhergesagten nun schon
deutlich hervor, daß man sich nicht einbilden soll, Kuns
könne über den Mangel an gutem Material hinweghelfen!
Sollten wir wertvolle Materialen überhaupt nie wieder be-
kommen, dann können wir einpacken. Wir können zwar
selbst gern eisernen Schmuck tragen, es aber nicht dem
Auslande anbieten, wenn dieses noch silbernen und
goldenen hat. Immerhin aber könnten wir doch einige
Materialien veredeln, z. B., indem wir Hölzer polieren.
Warum muß alles matt oder roh gearbeitet werden? Und
wenn man Eisen verarbeitet, warum kann man es dann
nicht wenigstens ebenso sorgfältig bearbeiten, wie es an
jeder Maschine geschieht? Wahrscheinlich, weil damit
irgend ein eingeredetes Prinzip von Materialechtheit ver-
letzt werden würde. Statt dessen verlangt man, daß die
Käufer Gefahr laufen, sich die Hände zu verletzen. —
Eine Kritik ließe sich noch viel weiter ausbauen. Ein
Lobhudeln ist gänzlich zwecklos, wenn man etwas er-
reichen will. Das kann aber nur geschehen, wenn unsere
Fachzeitschriften endlich anfangen wollten, vergleichende
Arbeit zu leisten.
Übet? Cloffet? DeUsdot?£et? Poesedan
non
Paul Rofenbacbet^Hambupg
Bis vor nicht allzu langer Zeit galten Thüringer Por-
zellane bei den meisten Sammlern nicht als
sammelfähig.
Man war geneigt, ihnen mehr kulturhistorische Be-
deutung als künstlerischen Wert zuzumessen. Erst mit
der zunehmenden Seltenheit von Sammelobjekten hat das
Interesse sich auch den frischen, liebenswürdigen Werken
der Thüringer Fabriken zugewandt.
Eine Ausnahme von der früheren Geringschätzung
hat man aber immer zu Gunsten der Porzellane der
Closter Veilsdorfer Fabrik gemacht wegen der Anmut
ihrer Plastik und der flotten guten Malerei ihrer Geschirre,
ohne aber sie als den Werken der berühmteren Fabriken
gleichwertig anzueikennen. Vielleicht ist das Zurück-
bleiben in der Wertschätzung der sammelnden Welt zum
Teil auch dem Umstand zuzuschreiben, daß die Erzeug-
nisse der Veilsdorfer Fabrik nicht genügend bekannt
waren.
Verstreut in meist kleineren Sammlungen waren sie
den Forschern nicht leicht zugänglich. Auf Versteigerungen
erschienen sie immer nur spärlich. Die Fabrik war doch
nur ein kleines Unternehmen, und die einzelnen Modelle
sind sicher nicht in großen Mengen ausgeformt worden.
Man darf wohl den Veilsdorfer Figuren im all-
gemeinen einen gewissen Grad von Seltenheit zuerkennen.
Ich bilde fünf Figuren, wie ich denke, zum ersten
Male ab:
Abb. 1. Pilger und Pilgerin mit weißem Rocaille-Sockel,
Gewand grau mit schwarzem Pilgerkragen.
Vielleicht sind sie identisch mit den Figuren,
die in einem Konzept Bayers1) vom 27. März
1778 erwähnt werden. Sammlung R., Hamburg.
Abb. 2. Türkin mit weißem Rocaille-Sockel, rechte Hand
ergänzt. Bemalung: Rock lila, auf der weißen
Jacke eisenrote Rocaillen. Sammlung R., Hamburg.
Wohl das Gegenstück zu einem Türken2)
im Berliner Kunstgewerbemuseum, der ihr das
ominöse Taschentuch zuwirft.
Abb. 3. Liegende Venus mit neben ihr knieendem Amor.
Bemalung: Sparsam Braunes Haar, blaues
Kopfkissen, grüner Felssockel. Sammlung 0.
Blohm, Hamburg.
Abb. 4. Tänzerin, antikisierend, ohne Sockel. Sparsame
Bemalung. Das oben umgeschlagene Gewand
zeigt grünes Futter. Die eisenrote Louis XVI.-
Borte ist identisch der Borte, die die unter 1
abgebildete Pilgerin hat. Museum für Kunst,
Gewerbe, Hamburg.
Alle diese fünf Figuren legen offenbar Zeugnis ab
von einem sehr hohen Stand des Könnens, sowohl des
Modelleurs, wie des Malers. Ich glaube, wenn man sie
unter einander vergleicht, muß man dazu kommen, sie
als Werke desselben Modelleurs anzusprechen.
’) Vergl. Graul & Kurzwelly, Altthüringer Porzellan S. 35.
2) Wie mir Herr Dr. Schnorr von Carolsfeld freundlichst
zeigte, steht diese Figur im Zusammenhang mit einem Meißner
Türken, abgebildet in der Festschrift von Meißen, Figur 87.
397