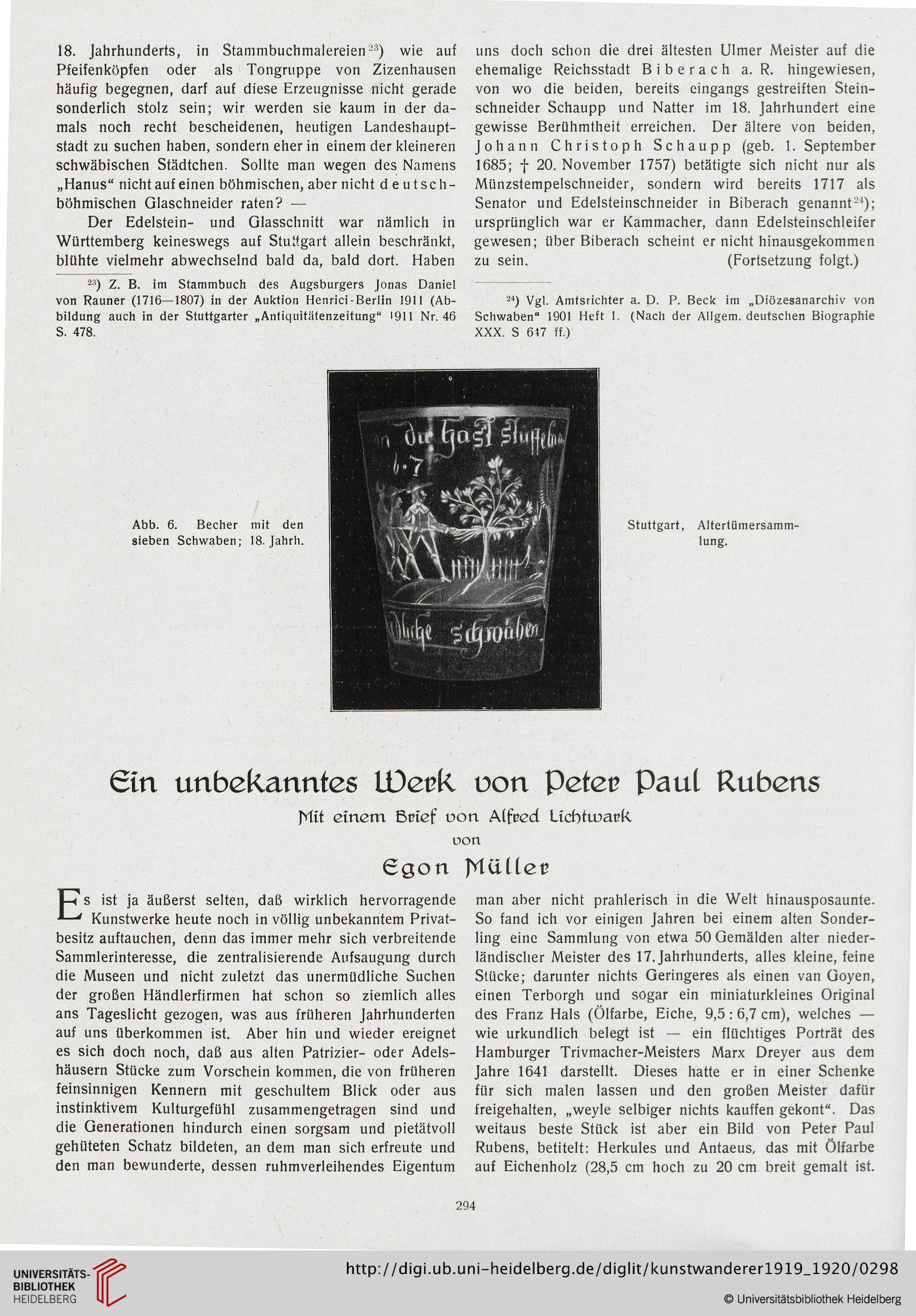18. Jahrhunderts, in Stammbuchmalereien-3) wie auf
Pfeifenköpfen oder als Tongruppe von Zizenhausen
häufig begegnen, darf auf diese Erzeugnisse nicht gerade
sonderlich stolz sein; wir werden sie kaum in der da-
mals noch recht bescheidenen, heutigen Landeshaupt-
stadt zu suchen haben, sondern eher in einem der kleineren
schwäbischen Städtchen. Sollte man wegen des Namens
„Hanus“ nicht auf einen böhmischen, aber nicht deutsch-
böhmischen Glaschneider raten? —
Der Edelstein- und Glasschnitt war nämlich in
Württemberg keineswegs auf Stuttgart allein beschränkt,
blühte vielmehr abwechselnd bald da, bald dort. Haben
23) Z. B. im Stammbuch des Augsburgers Jonas Daniel
von Rauner (1716—1807) in der Auktion Henrici-Berlin 1911 (Ab-
bildung auch in der Stuttgarter „Antiquitätenzeitung“ 1911 Nr. 46
S. 478.
uns doch schon die drei ältesten Ulmer Meister auf die
ehemalige Reichsstadt Biberach a. R. hingewiesen,
von wo die beiden, bereits eingangs gestreiften Stein-
schneider Schaupp und Natter im 18. Jahrhundert eine
gewisse Berühmtheit erreichen. Der ältere von beiden,
Johann Christoph Schaupp (geb. 1. September
1685; f 20. November 1757) betätigte sich nicht nur als
Münzstempelschneider, sondern wird bereits 1717 als
Senator und Edelsteinschneider in Biberach genannt24);
ursprünglich war er Kammacher, dann Edelsteinschleifer
gewesen; über Biberach scheint er nicht hinausgekommen
zu sein. (Fortsetzung folgt.)
-4) Vgl. Amtsrichter a. D. P. Beck im „Diözesanarchiv von
Schwaben“ 1901 Heft 1. (Nach der Allgem. deutschen Biographie
XXX. S 647 ff.)
Abb. 6. Becher mit den
sieben Schwaben; 18. Jahrh.
Stuttgart, Altertümersamm-
lung.
Sin unbekanntes LDeck oon Peter Paul Rubens
jvlit einem Brief oon Alfred Lichtmark
oon
6gon
l-T s ist ja äußerst selten, daß wirklich hervorragende
4 Kunstwerke heute noch in völlig unbekanntem Privat-
besitz auftauchen, denn das immer mehr sich verbreitende
Sammlerinteresse, die zentralisierende Aufsaugung durch
die Museen und nicht zuletzt das unermüdliche Suchen
der großen Händlerfirmen hat schon so ziemlich alles
ans Tageslicht gezogen, was aus früheren Jahrhunderten
auf uns überkommen ist. Aber hin und wieder ereignet
es sich doch noch, daß aus alten Patrizier- oder Adels-
häusern Stücke zum Vorschein kommen, die von früheren
feinsinnigen Kennern mit geschultem Blick oder aus
instinktivem Kulturgefühl zusammengetragen sind und
die Generationen hindurch einen sorgsam und pietätvoll
gehüteten Schatz bildeten, an dem man sich erfreute und
den man bewunderte, dessen ruhmverleihendes Eigentum
jvtüüet?
man aber nicht prahlerisch in die Welt hinausposaunte.
So fand ich vor einigen Jahren bei einem alten Sonder-
ling eine Sammlung von etwa 50 Gemälden alter nieder-
ländischer Meister des 17. Jahrhunderts, alles kleine, feine
Stücke; darunter nichts Geringeres als einen van üoyen,
einen Terborgh und sogar ein miniaturkleines Original
des Franz Hals (Ölfarbe, Eiche, 9,5:6,7 cm), welches —
wie urkundlich belegt ist — ein flüchtiges Porträt des
Hamburger Trivmacher-Meisters Marx Dreyer aus dem
Jahre 1641 darstellt. Dieses hatte er in einer Schenke
für sich malen lassen und den großen Meister dafür
freigehalten, „weyle selbiger nichts kauften gekont“. Das
weitaus beste Stück ist aber ein Bild von Peter Paul
Rubens, betitelt: Herkules und Antaeus, das mit Ölfarbe
auf Eichenholz (28,5 cm hoch zu 20 cm breit gemalt ist.
294
Pfeifenköpfen oder als Tongruppe von Zizenhausen
häufig begegnen, darf auf diese Erzeugnisse nicht gerade
sonderlich stolz sein; wir werden sie kaum in der da-
mals noch recht bescheidenen, heutigen Landeshaupt-
stadt zu suchen haben, sondern eher in einem der kleineren
schwäbischen Städtchen. Sollte man wegen des Namens
„Hanus“ nicht auf einen böhmischen, aber nicht deutsch-
böhmischen Glaschneider raten? —
Der Edelstein- und Glasschnitt war nämlich in
Württemberg keineswegs auf Stuttgart allein beschränkt,
blühte vielmehr abwechselnd bald da, bald dort. Haben
23) Z. B. im Stammbuch des Augsburgers Jonas Daniel
von Rauner (1716—1807) in der Auktion Henrici-Berlin 1911 (Ab-
bildung auch in der Stuttgarter „Antiquitätenzeitung“ 1911 Nr. 46
S. 478.
uns doch schon die drei ältesten Ulmer Meister auf die
ehemalige Reichsstadt Biberach a. R. hingewiesen,
von wo die beiden, bereits eingangs gestreiften Stein-
schneider Schaupp und Natter im 18. Jahrhundert eine
gewisse Berühmtheit erreichen. Der ältere von beiden,
Johann Christoph Schaupp (geb. 1. September
1685; f 20. November 1757) betätigte sich nicht nur als
Münzstempelschneider, sondern wird bereits 1717 als
Senator und Edelsteinschneider in Biberach genannt24);
ursprünglich war er Kammacher, dann Edelsteinschleifer
gewesen; über Biberach scheint er nicht hinausgekommen
zu sein. (Fortsetzung folgt.)
-4) Vgl. Amtsrichter a. D. P. Beck im „Diözesanarchiv von
Schwaben“ 1901 Heft 1. (Nach der Allgem. deutschen Biographie
XXX. S 647 ff.)
Abb. 6. Becher mit den
sieben Schwaben; 18. Jahrh.
Stuttgart, Altertümersamm-
lung.
Sin unbekanntes LDeck oon Peter Paul Rubens
jvlit einem Brief oon Alfred Lichtmark
oon
6gon
l-T s ist ja äußerst selten, daß wirklich hervorragende
4 Kunstwerke heute noch in völlig unbekanntem Privat-
besitz auftauchen, denn das immer mehr sich verbreitende
Sammlerinteresse, die zentralisierende Aufsaugung durch
die Museen und nicht zuletzt das unermüdliche Suchen
der großen Händlerfirmen hat schon so ziemlich alles
ans Tageslicht gezogen, was aus früheren Jahrhunderten
auf uns überkommen ist. Aber hin und wieder ereignet
es sich doch noch, daß aus alten Patrizier- oder Adels-
häusern Stücke zum Vorschein kommen, die von früheren
feinsinnigen Kennern mit geschultem Blick oder aus
instinktivem Kulturgefühl zusammengetragen sind und
die Generationen hindurch einen sorgsam und pietätvoll
gehüteten Schatz bildeten, an dem man sich erfreute und
den man bewunderte, dessen ruhmverleihendes Eigentum
jvtüüet?
man aber nicht prahlerisch in die Welt hinausposaunte.
So fand ich vor einigen Jahren bei einem alten Sonder-
ling eine Sammlung von etwa 50 Gemälden alter nieder-
ländischer Meister des 17. Jahrhunderts, alles kleine, feine
Stücke; darunter nichts Geringeres als einen van üoyen,
einen Terborgh und sogar ein miniaturkleines Original
des Franz Hals (Ölfarbe, Eiche, 9,5:6,7 cm), welches —
wie urkundlich belegt ist — ein flüchtiges Porträt des
Hamburger Trivmacher-Meisters Marx Dreyer aus dem
Jahre 1641 darstellt. Dieses hatte er in einer Schenke
für sich malen lassen und den großen Meister dafür
freigehalten, „weyle selbiger nichts kauften gekont“. Das
weitaus beste Stück ist aber ein Bild von Peter Paul
Rubens, betitelt: Herkules und Antaeus, das mit Ölfarbe
auf Eichenholz (28,5 cm hoch zu 20 cm breit gemalt ist.
294