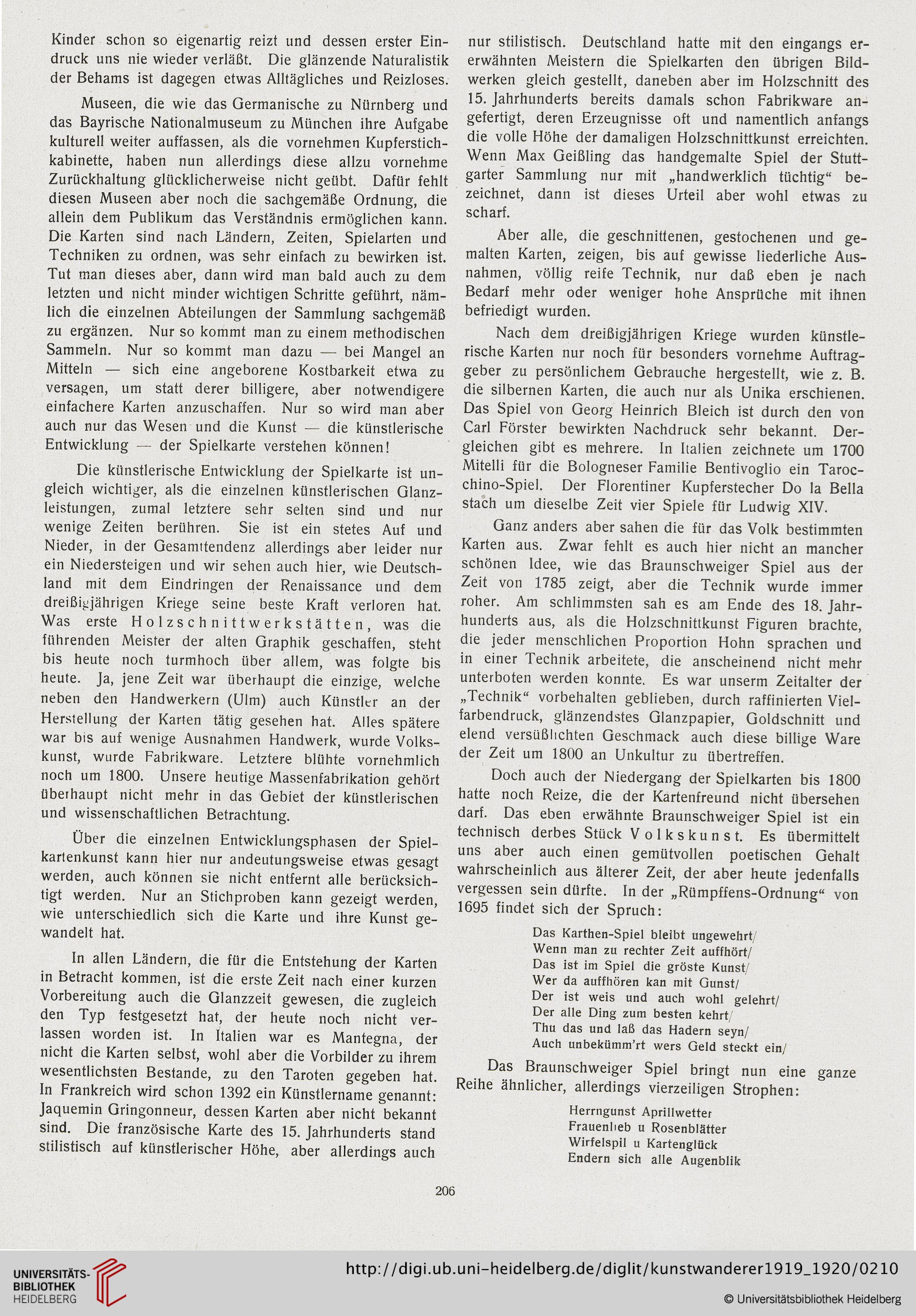Kinder schon so eigenartig reizt und dessen erster Ein-
druck uns nie wieder verläßt. Die glänzende Naturalistik
der Behams ist dagegen etwas Alltägliches und Reizloses.
Museen, die wie das Germanische zu Nürnberg und
das Bayrische Nationalmuseum zu München ihre Aufgabe
kulturell weiter auffassen, als die vornehmen Kupferstich-
kabinette, haben nun allerdings diese allzu vornehme
Zurückhaltung glücklicherweise nicht geübt. Dafür fehlt
diesen Museen aber noch die sachgemäße Ordnung, die
allein dem Publikum das Verständnis ermöglichen kann.
Die Karten sind nach Ländern, Zeiten, Spielarten und
Techniken zu ordnen, was sehr einfach zu bewirken ist.
Tut man dieses aber, dann wird man bald auch zu dem
letzten und nicht minder wichtigen Schritte geführt, näm-
lich die einzelnen Abteilungen der Sammlung sachgemäß
zu ergänzen. Nur so kommt man zu einem methodischen
Sammeln. Nur so kommt man dazu — bei Mangel an
Mitteln — sich eine angeborene Kostbarkeit etwa zu
versagen, um statt derer billigere, aber notwendigere
einfachere Karten anzuschaffen. Nur so wird man aber
auch nur das Wesen und die Kunst — die künstlerische
Entwicklung — der Spielkarte verstehen können!
Die künstlerische Entwicklung der Spielkarte ist un-
gleich wichtiger, als die einzelnen künstlerischen Glanz-
leistungen, zumal letztere sehr selten sind und nur
wenige Zeiten berühren. Sie ist ein stetes Auf und
Nieder, in der Gesamttendenz allerdings aber leider nur
ein Niedersteigen und wir sehen auch hier, wie Deutsch-
land mit dem Eindringen der Renaissance und dem
dreißigjährigen Kriege seine beste Kraft verloren hat.
Was erste Holzschnittwerkstätten, was die
führenden Meister der alten Graphik geschaffen, steht
bis heute noch turmhoch über allem, was folgte bis
heute. Ja, jene Zeit war überhaupt die einzige, welche
neben den Handwerkern (Ulm) auch Künstler an der
Herstellung der Karten tätig gesehen hat. Alles spätere
war bis auf wenige Ausnahmen Handwerk, wurde Volks-
kunst, wurde Fabrikware. Letztere blühte vornehmlich
noch um 1800. Unsere heutige Massenfabrikation gehört
überhaupt nicht mehr in das Gebiet der künstlerischen
und wissenschaftlichen Betrachtung.
Über die einzelnen Entwicklungsphasen der Spiel-
kartenkunst kann hier nur andeutungsweise etwas gesagt
werden, auch können sie nicht entfernt alle berücksich-
tigt werden. Nur an Stichproben kann gezeigt werden,
wie unterschiedlich sich die Karte und ihre Kunst ge-
wandelt hat.
ln allen Ländern, die für die Entstehung der Karten
in Betracht kommen, ist die erste Zeit nach einer kurzen
Vorbereitung auch die Glanzzeit gewesen, die zugleich
den Typ festgesetzt hat, der heute noch nicht ver-
lassen worden ist. In Italien war es Mantegna, der
nicht die Karten selbst, wohl aber die Vorbilder zu ihrem
wesentlichsten Bestände, zu den Taroten gegeben hat.
In Frankreich wird schon 1392 ein Künstlername genannt:
Jaquemin Gringonneur, dessen Karten aber nicht bekannt
sind. Die französische Karte des 15. Jahrhunderts stand
stilistisch auf künstlerischer Höhe, aber allerdings auch
nur stilistisch. Deutschland hatte mit den eingangs er-
erwähnten Meistern die Spielkarten den übrigen Bild-
werken gleich gestellt, daneben aber im Holzschnitt des
15. Jahrhunderts bereits damals schon Fabrikware an-
gefertigt, deren Erzeugnisse oft und namentlich anfangs
die volle Höhe der damaligen Holzschnittkunst erreichten.
Wenn Max Geißling das handgemalte Spiel der Stutt-
garter Sammlung nur mit „handwerklich tüchtig“ be-
zeichnet, dann ist dieses Urteil aber wohl etwas zu
scharf.
Aber alle, die geschnittenen, gestochenen und ge-
malten Karten, zeigen, bis auf gewisse liederliche Aus-
nahmen, völlig reife Technik, nur daß eben je nach
Bedarf mehr oder weniger hohe Ansprüche mit ihnen
befriedigt wurden.
Nach dem dreißigjährigen Kriege wurden künstle-
rische Karten nur noch für besonders vornehme Auftrag-
geber zu persönlichem Gebrauche hergestellt, wie z. B.
die silbernen Karten, die auch nur als Unika erschienen.
Das Spiel von Georg Heinrich Bleich ist durch den von
Carl Förster bewirkten Nachdruck sehr bekannt. Der-
gleichen gibt es mehrere. In Italien zeichnete um 1700
Mitelli für die Bologneser Familie Bentivoglio ein Taroc-
chino-Spiel. Der Florentiner Kupferstecher Do la Bella
stach um dieselbe Zeit vier Spiele für Ludwig XIV.
Ganz anders aber sahen die für das Volk bestimmten
Karten aus. Zwar fehlt es auch hier nicht an mancher
schönen Idee, wie das Braunschweiger Spiel aus der
Zeit von 1785 zeigt, aber die Technik wurde immer
roher. Am schlimmsten sah es am Ende des 18. Jahr-
hunderts aus, als die Holzschnittkunst Figuren brachte,
die jeder menschlichen Proportion Hohn sprachen und
in einer Technik arbeitete, die anscheinend nicht mehr
unterboten werden konnte. Es war unserm Zeitalter der
„Technik“ Vorbehalten geblieben, durch raffinierten Viel-
farbendruck, glänzendstes Glanzpapier, Goldschnitt und
elend versüßlichten Geschmack auch diese billige Ware
der Zeit um 1800 an Unkultur zu übertreffen.
Doch auch der Niedergang der Spielkarten bis 1800
hatte noch Reize, die der Kartenfreund nicht übersehen
darf. Das eben erwähnte Braunschweiger Spiel ist ein
technisch derbes Stück Volkskunst. Es übermittelt
uns aber auch einen gemütvollen poetischen Gehalt
wahrscheinlich aus älterer Zeit, der aber heute jedenfalls
vergessen sein dürfte. In der „Rümpffens-Ordnung“ von
1695 findet sich der Spruch:
Das Karthen-Splel bleibt ungewehrt/
Wenn man zu rechter Zeit auffhört/
Das ist im Spiel die gröste Kunst/
Wer da auffhören kan mit Gunst/
Der ist weis und auch wohl gelehrt/
Der alle Ding zum besten kehrt
Thu das und laß das Hadern seyn/
Auch unbekümm’rt wers Geld steckt ein/
Das Braunschweiger Spiel bringt nun eine ganze
Reihe ähnlicher, allerdings vierzeiligen Strophen:
Herrngunst Aprillwetter
Frauenlieb u Rosenblätter
Wirfelspil u Kartenglück
Endern sich alle Augenblik
206
druck uns nie wieder verläßt. Die glänzende Naturalistik
der Behams ist dagegen etwas Alltägliches und Reizloses.
Museen, die wie das Germanische zu Nürnberg und
das Bayrische Nationalmuseum zu München ihre Aufgabe
kulturell weiter auffassen, als die vornehmen Kupferstich-
kabinette, haben nun allerdings diese allzu vornehme
Zurückhaltung glücklicherweise nicht geübt. Dafür fehlt
diesen Museen aber noch die sachgemäße Ordnung, die
allein dem Publikum das Verständnis ermöglichen kann.
Die Karten sind nach Ländern, Zeiten, Spielarten und
Techniken zu ordnen, was sehr einfach zu bewirken ist.
Tut man dieses aber, dann wird man bald auch zu dem
letzten und nicht minder wichtigen Schritte geführt, näm-
lich die einzelnen Abteilungen der Sammlung sachgemäß
zu ergänzen. Nur so kommt man zu einem methodischen
Sammeln. Nur so kommt man dazu — bei Mangel an
Mitteln — sich eine angeborene Kostbarkeit etwa zu
versagen, um statt derer billigere, aber notwendigere
einfachere Karten anzuschaffen. Nur so wird man aber
auch nur das Wesen und die Kunst — die künstlerische
Entwicklung — der Spielkarte verstehen können!
Die künstlerische Entwicklung der Spielkarte ist un-
gleich wichtiger, als die einzelnen künstlerischen Glanz-
leistungen, zumal letztere sehr selten sind und nur
wenige Zeiten berühren. Sie ist ein stetes Auf und
Nieder, in der Gesamttendenz allerdings aber leider nur
ein Niedersteigen und wir sehen auch hier, wie Deutsch-
land mit dem Eindringen der Renaissance und dem
dreißigjährigen Kriege seine beste Kraft verloren hat.
Was erste Holzschnittwerkstätten, was die
führenden Meister der alten Graphik geschaffen, steht
bis heute noch turmhoch über allem, was folgte bis
heute. Ja, jene Zeit war überhaupt die einzige, welche
neben den Handwerkern (Ulm) auch Künstler an der
Herstellung der Karten tätig gesehen hat. Alles spätere
war bis auf wenige Ausnahmen Handwerk, wurde Volks-
kunst, wurde Fabrikware. Letztere blühte vornehmlich
noch um 1800. Unsere heutige Massenfabrikation gehört
überhaupt nicht mehr in das Gebiet der künstlerischen
und wissenschaftlichen Betrachtung.
Über die einzelnen Entwicklungsphasen der Spiel-
kartenkunst kann hier nur andeutungsweise etwas gesagt
werden, auch können sie nicht entfernt alle berücksich-
tigt werden. Nur an Stichproben kann gezeigt werden,
wie unterschiedlich sich die Karte und ihre Kunst ge-
wandelt hat.
ln allen Ländern, die für die Entstehung der Karten
in Betracht kommen, ist die erste Zeit nach einer kurzen
Vorbereitung auch die Glanzzeit gewesen, die zugleich
den Typ festgesetzt hat, der heute noch nicht ver-
lassen worden ist. In Italien war es Mantegna, der
nicht die Karten selbst, wohl aber die Vorbilder zu ihrem
wesentlichsten Bestände, zu den Taroten gegeben hat.
In Frankreich wird schon 1392 ein Künstlername genannt:
Jaquemin Gringonneur, dessen Karten aber nicht bekannt
sind. Die französische Karte des 15. Jahrhunderts stand
stilistisch auf künstlerischer Höhe, aber allerdings auch
nur stilistisch. Deutschland hatte mit den eingangs er-
erwähnten Meistern die Spielkarten den übrigen Bild-
werken gleich gestellt, daneben aber im Holzschnitt des
15. Jahrhunderts bereits damals schon Fabrikware an-
gefertigt, deren Erzeugnisse oft und namentlich anfangs
die volle Höhe der damaligen Holzschnittkunst erreichten.
Wenn Max Geißling das handgemalte Spiel der Stutt-
garter Sammlung nur mit „handwerklich tüchtig“ be-
zeichnet, dann ist dieses Urteil aber wohl etwas zu
scharf.
Aber alle, die geschnittenen, gestochenen und ge-
malten Karten, zeigen, bis auf gewisse liederliche Aus-
nahmen, völlig reife Technik, nur daß eben je nach
Bedarf mehr oder weniger hohe Ansprüche mit ihnen
befriedigt wurden.
Nach dem dreißigjährigen Kriege wurden künstle-
rische Karten nur noch für besonders vornehme Auftrag-
geber zu persönlichem Gebrauche hergestellt, wie z. B.
die silbernen Karten, die auch nur als Unika erschienen.
Das Spiel von Georg Heinrich Bleich ist durch den von
Carl Förster bewirkten Nachdruck sehr bekannt. Der-
gleichen gibt es mehrere. In Italien zeichnete um 1700
Mitelli für die Bologneser Familie Bentivoglio ein Taroc-
chino-Spiel. Der Florentiner Kupferstecher Do la Bella
stach um dieselbe Zeit vier Spiele für Ludwig XIV.
Ganz anders aber sahen die für das Volk bestimmten
Karten aus. Zwar fehlt es auch hier nicht an mancher
schönen Idee, wie das Braunschweiger Spiel aus der
Zeit von 1785 zeigt, aber die Technik wurde immer
roher. Am schlimmsten sah es am Ende des 18. Jahr-
hunderts aus, als die Holzschnittkunst Figuren brachte,
die jeder menschlichen Proportion Hohn sprachen und
in einer Technik arbeitete, die anscheinend nicht mehr
unterboten werden konnte. Es war unserm Zeitalter der
„Technik“ Vorbehalten geblieben, durch raffinierten Viel-
farbendruck, glänzendstes Glanzpapier, Goldschnitt und
elend versüßlichten Geschmack auch diese billige Ware
der Zeit um 1800 an Unkultur zu übertreffen.
Doch auch der Niedergang der Spielkarten bis 1800
hatte noch Reize, die der Kartenfreund nicht übersehen
darf. Das eben erwähnte Braunschweiger Spiel ist ein
technisch derbes Stück Volkskunst. Es übermittelt
uns aber auch einen gemütvollen poetischen Gehalt
wahrscheinlich aus älterer Zeit, der aber heute jedenfalls
vergessen sein dürfte. In der „Rümpffens-Ordnung“ von
1695 findet sich der Spruch:
Das Karthen-Splel bleibt ungewehrt/
Wenn man zu rechter Zeit auffhört/
Das ist im Spiel die gröste Kunst/
Wer da auffhören kan mit Gunst/
Der ist weis und auch wohl gelehrt/
Der alle Ding zum besten kehrt
Thu das und laß das Hadern seyn/
Auch unbekümm’rt wers Geld steckt ein/
Das Braunschweiger Spiel bringt nun eine ganze
Reihe ähnlicher, allerdings vierzeiligen Strophen:
Herrngunst Aprillwetter
Frauenlieb u Rosenblätter
Wirfelspil u Kartenglück
Endern sich alle Augenblik
206