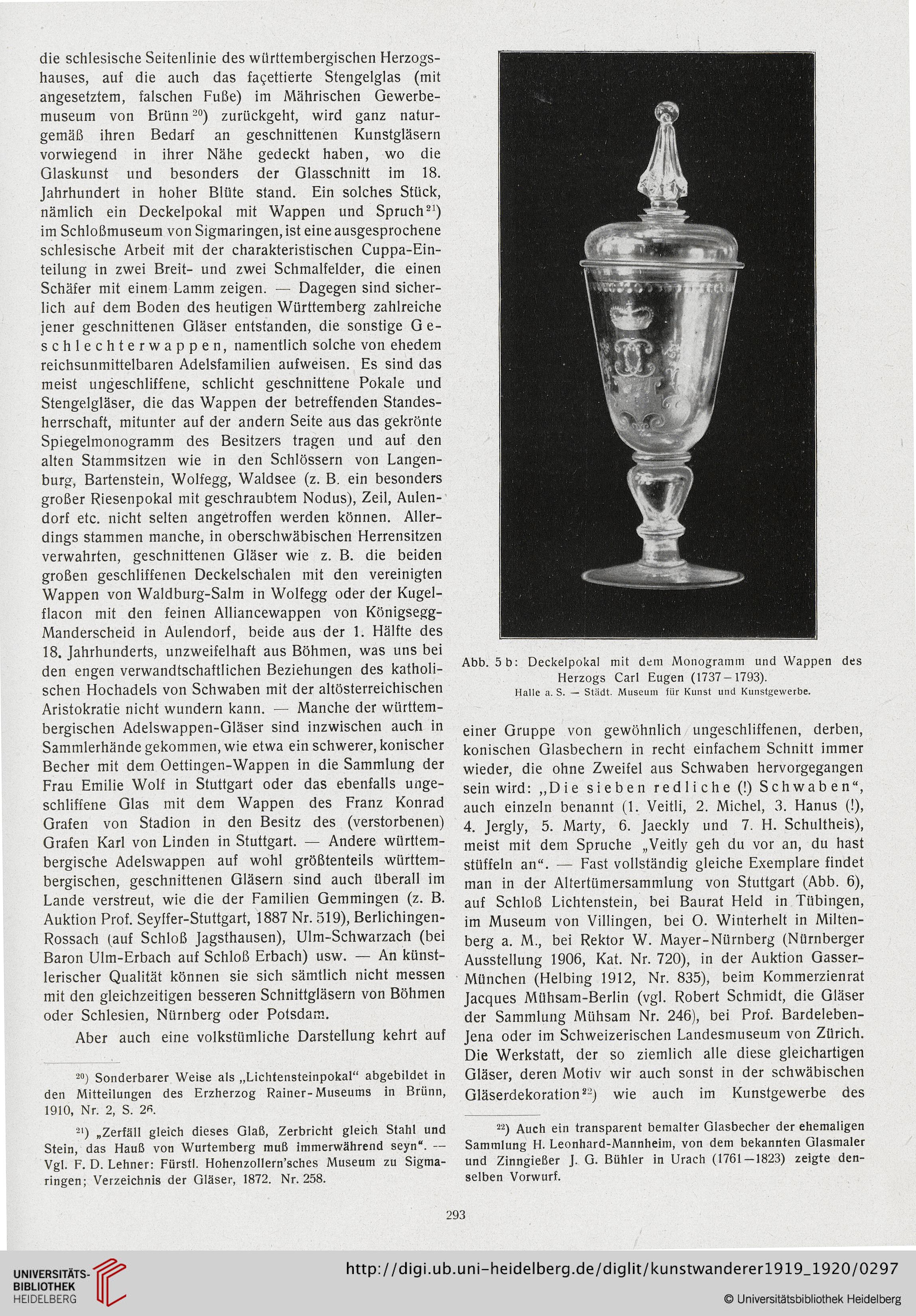die schlesische Seitenlinie des württembergischen Herzogs-
hauses, auf die auch das fagettierte Stengelglas (mit
angesetztem, falschen Fuße) im Mährischen Gewerbe-
museum von Brünn20) zurückgeht, wird ganz natur-
gemäß ihren Bedarf an geschnittenen Kunstgläsern
vorwiegend in ihrer Nähe gedeckt haben, wo die
Glaskunst und besonders der Glasschnitt im 18.
Jahrhundert in hoher Blüte stand. Ein solches Stück,
nämlich ein Deckelpokal mit Wappen und Spruch21)
im Schloßmuseum von Sigmaringen, ist eine ausgesprochene
schlesische Arbeit mit der charakteristischen Cuppa-Ein-
teilung in zwei Breit- und zwei Schmalfelder, die einen
Schäfer mit einem Lamm zeigen. — Dagegen sind sicher-
lich auf dem Boden des heutigen Württemberg zahlreiche
jener geschnittenen Gläser entstanden, die sonstige G e-
schlechterwappen, namentlich solche von ehedem
reichsunmittelbaren Adelsfamilien aufweisen. Es sind das
meist ungeschliffene, schlicht geschnittene Pokale und
Stengelgläser, die das Wappen der betreffenden Standes-
herrschaft, mitunter auf der andern Seite aus das gekrönte
Spiegelmonogramm des Besitzers tragen und auf den
alten Stammsitzen wie in den Schlössern von Langen-
burg, Bartenstein, Wolfegg, Waldsee (z. B. ein besonders
großer Riesenpokal mit geschraubtem Nodus), Zeil, Aulen-
dorf etc. nicht selten angetroffen werden können. Aller-
dings stammen manche, in oberschwäbischen Herrensitzen
verwahrten, geschnittenen Gläser wie z. B. die beiden
großen geschliffenen Deckelschalen mit den vereinigten
Wappen von Waldburg-Salm in Wolfegg oder der Kugel-
flacon mit den feinen Alliancewappen von Königsegg-
Manderscheid in Aulendorf, beide aus der 1. Hälfte des
18. Jahrhunderts, unzweifelhaft aus Böhmen, was uns bei
den engen verwandtschaftlichen Beziehungen des katholi-
schen Hochadels von Schwaben mit der altösterreichischen
Aristokratie nicht wundern kann. Manche der württem-
bergischen Adelswappen-Gläser sind inzwischen auch in
Sammlerhände gekommen, wie etwa ein schwerer, konischer
Becher mit dem Oettingen-Wappen in die Sammlung der
Frau Emilie Wolf in Stuttgart oder das ebenfalls unge-
schliffene Glas mit dem Wappen des Franz Konrad
Grafen von Stadion in den Besitz des (verstorbenen)
Grafen Karl von Linden in Stuttgart. — Andere württem-
bergische Adelswappen auf wohl größtenteils württem-
bergischen, geschnittenen Gläsern sind auch überall im
Lande verstreut, wie die der Familien Gemmingen (z. B.
Auktion Prof. Seyffer-Stuttgart, 1887 Nr. 519), Berlichingen-
Rossach (auf Schloß Jagsthausen), Ulm-Schwarzach (bei
Baron Ulm-Erbach auf Schloß Erbach) usw. — An künst-
lerischer Qualität können sie sich sämtlich nicht messen
mit den gleichzeitigen besseren Schnittgläsern von Böhmen
oder Schlesien, Nürnberg oder Potsdam.
Aber auch eine volkstümliche Darstellung kehrt auf
20) Sonderbarer Weise als „Lichtensteinpokal“ abgebildet in
den Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museums in Brünn,
1910, Nr. 2, S. 2«.
21) „Zerfall gleich dieses Glaß, Zerbricht gleich Stahl und
Stein, das Hauß von Wurtemberg muß immerwährend seyn“. —
Vgl. F. D. Lehner: Fürst!. Hohenzollern’sches Museum zu Sigma-
ringen; Verzeichnis der Gläser, 1872. Nr. 258.
Abb. 5b: Deckelpokal mit dem Monogramm und Wappen des
Herzogs Carl Eugen (1737-1793).
Halle a. S. — Stadt. Museum für Kunst und Kunstgewerbe.
einer Gruppe von gewöhnlich ungeschliffenen, derben,
konischen Glasbechern in recht einfachem Schnitt immer
wieder, die ohne Zweifel aus Schwaben hervorgegangen
sein wird: „Die sieben redliche (!) Schwaben“,
auch einzeln benannt (1. Veitli, 2. Michel, 3. Hanus (!),
4. Jergly, 5. Marty, 6. Jaeckly und 7. H. Schultheis),
meist mit dem Spruche „Veitly geh du vor an, du hast
stüffeln an“. — Fast vollständig gleiche Exemplare findet
man in der Altertümersammlung von Stuttgart (Abb. 6),
auf Schloß Lichtenstein, bei Baurat Held in Tübingen,
im Museum von Villingen, bei 0. Winterhelt in Milten-
berg a. M., bei Rektor W. Mayer-Nürnberg (Nürnberger
Ausstellung 1906, Kat. Nr. 720), in der Auktion Gasser-
München (Helbing 1912, Nr. 835), beim Kommerzienrat
Jacques Mühsam-Berlin (vgl. Robert Schmidt, die Gläser
der Sammlung Mühsam Nr. 246), bei Prof. Bardeleben-
Jena oder im Schweizerischen Landesmuseum von Zürich.
Die Werkstatt, der so ziemlich alle diese gleichartigen
Gläser, deren Motiv wir auch sonst in der schwäbischen
Gläserdekoration22) wie auch im Kunstgewerbe des
22) Auch ein transparent bemalter Glasbecher der ehemaligen
Sammlung H. Leonhard-Mannheim, von dem bekannten Glasmaler
und Zinngießer J. G. Bühler in Urach (1761—1823) zeigte den-
selben Vorwurf.
293
hauses, auf die auch das fagettierte Stengelglas (mit
angesetztem, falschen Fuße) im Mährischen Gewerbe-
museum von Brünn20) zurückgeht, wird ganz natur-
gemäß ihren Bedarf an geschnittenen Kunstgläsern
vorwiegend in ihrer Nähe gedeckt haben, wo die
Glaskunst und besonders der Glasschnitt im 18.
Jahrhundert in hoher Blüte stand. Ein solches Stück,
nämlich ein Deckelpokal mit Wappen und Spruch21)
im Schloßmuseum von Sigmaringen, ist eine ausgesprochene
schlesische Arbeit mit der charakteristischen Cuppa-Ein-
teilung in zwei Breit- und zwei Schmalfelder, die einen
Schäfer mit einem Lamm zeigen. — Dagegen sind sicher-
lich auf dem Boden des heutigen Württemberg zahlreiche
jener geschnittenen Gläser entstanden, die sonstige G e-
schlechterwappen, namentlich solche von ehedem
reichsunmittelbaren Adelsfamilien aufweisen. Es sind das
meist ungeschliffene, schlicht geschnittene Pokale und
Stengelgläser, die das Wappen der betreffenden Standes-
herrschaft, mitunter auf der andern Seite aus das gekrönte
Spiegelmonogramm des Besitzers tragen und auf den
alten Stammsitzen wie in den Schlössern von Langen-
burg, Bartenstein, Wolfegg, Waldsee (z. B. ein besonders
großer Riesenpokal mit geschraubtem Nodus), Zeil, Aulen-
dorf etc. nicht selten angetroffen werden können. Aller-
dings stammen manche, in oberschwäbischen Herrensitzen
verwahrten, geschnittenen Gläser wie z. B. die beiden
großen geschliffenen Deckelschalen mit den vereinigten
Wappen von Waldburg-Salm in Wolfegg oder der Kugel-
flacon mit den feinen Alliancewappen von Königsegg-
Manderscheid in Aulendorf, beide aus der 1. Hälfte des
18. Jahrhunderts, unzweifelhaft aus Böhmen, was uns bei
den engen verwandtschaftlichen Beziehungen des katholi-
schen Hochadels von Schwaben mit der altösterreichischen
Aristokratie nicht wundern kann. Manche der württem-
bergischen Adelswappen-Gläser sind inzwischen auch in
Sammlerhände gekommen, wie etwa ein schwerer, konischer
Becher mit dem Oettingen-Wappen in die Sammlung der
Frau Emilie Wolf in Stuttgart oder das ebenfalls unge-
schliffene Glas mit dem Wappen des Franz Konrad
Grafen von Stadion in den Besitz des (verstorbenen)
Grafen Karl von Linden in Stuttgart. — Andere württem-
bergische Adelswappen auf wohl größtenteils württem-
bergischen, geschnittenen Gläsern sind auch überall im
Lande verstreut, wie die der Familien Gemmingen (z. B.
Auktion Prof. Seyffer-Stuttgart, 1887 Nr. 519), Berlichingen-
Rossach (auf Schloß Jagsthausen), Ulm-Schwarzach (bei
Baron Ulm-Erbach auf Schloß Erbach) usw. — An künst-
lerischer Qualität können sie sich sämtlich nicht messen
mit den gleichzeitigen besseren Schnittgläsern von Böhmen
oder Schlesien, Nürnberg oder Potsdam.
Aber auch eine volkstümliche Darstellung kehrt auf
20) Sonderbarer Weise als „Lichtensteinpokal“ abgebildet in
den Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museums in Brünn,
1910, Nr. 2, S. 2«.
21) „Zerfall gleich dieses Glaß, Zerbricht gleich Stahl und
Stein, das Hauß von Wurtemberg muß immerwährend seyn“. —
Vgl. F. D. Lehner: Fürst!. Hohenzollern’sches Museum zu Sigma-
ringen; Verzeichnis der Gläser, 1872. Nr. 258.
Abb. 5b: Deckelpokal mit dem Monogramm und Wappen des
Herzogs Carl Eugen (1737-1793).
Halle a. S. — Stadt. Museum für Kunst und Kunstgewerbe.
einer Gruppe von gewöhnlich ungeschliffenen, derben,
konischen Glasbechern in recht einfachem Schnitt immer
wieder, die ohne Zweifel aus Schwaben hervorgegangen
sein wird: „Die sieben redliche (!) Schwaben“,
auch einzeln benannt (1. Veitli, 2. Michel, 3. Hanus (!),
4. Jergly, 5. Marty, 6. Jaeckly und 7. H. Schultheis),
meist mit dem Spruche „Veitly geh du vor an, du hast
stüffeln an“. — Fast vollständig gleiche Exemplare findet
man in der Altertümersammlung von Stuttgart (Abb. 6),
auf Schloß Lichtenstein, bei Baurat Held in Tübingen,
im Museum von Villingen, bei 0. Winterhelt in Milten-
berg a. M., bei Rektor W. Mayer-Nürnberg (Nürnberger
Ausstellung 1906, Kat. Nr. 720), in der Auktion Gasser-
München (Helbing 1912, Nr. 835), beim Kommerzienrat
Jacques Mühsam-Berlin (vgl. Robert Schmidt, die Gläser
der Sammlung Mühsam Nr. 246), bei Prof. Bardeleben-
Jena oder im Schweizerischen Landesmuseum von Zürich.
Die Werkstatt, der so ziemlich alle diese gleichartigen
Gläser, deren Motiv wir auch sonst in der schwäbischen
Gläserdekoration22) wie auch im Kunstgewerbe des
22) Auch ein transparent bemalter Glasbecher der ehemaligen
Sammlung H. Leonhard-Mannheim, von dem bekannten Glasmaler
und Zinngießer J. G. Bühler in Urach (1761—1823) zeigte den-
selben Vorwurf.
293