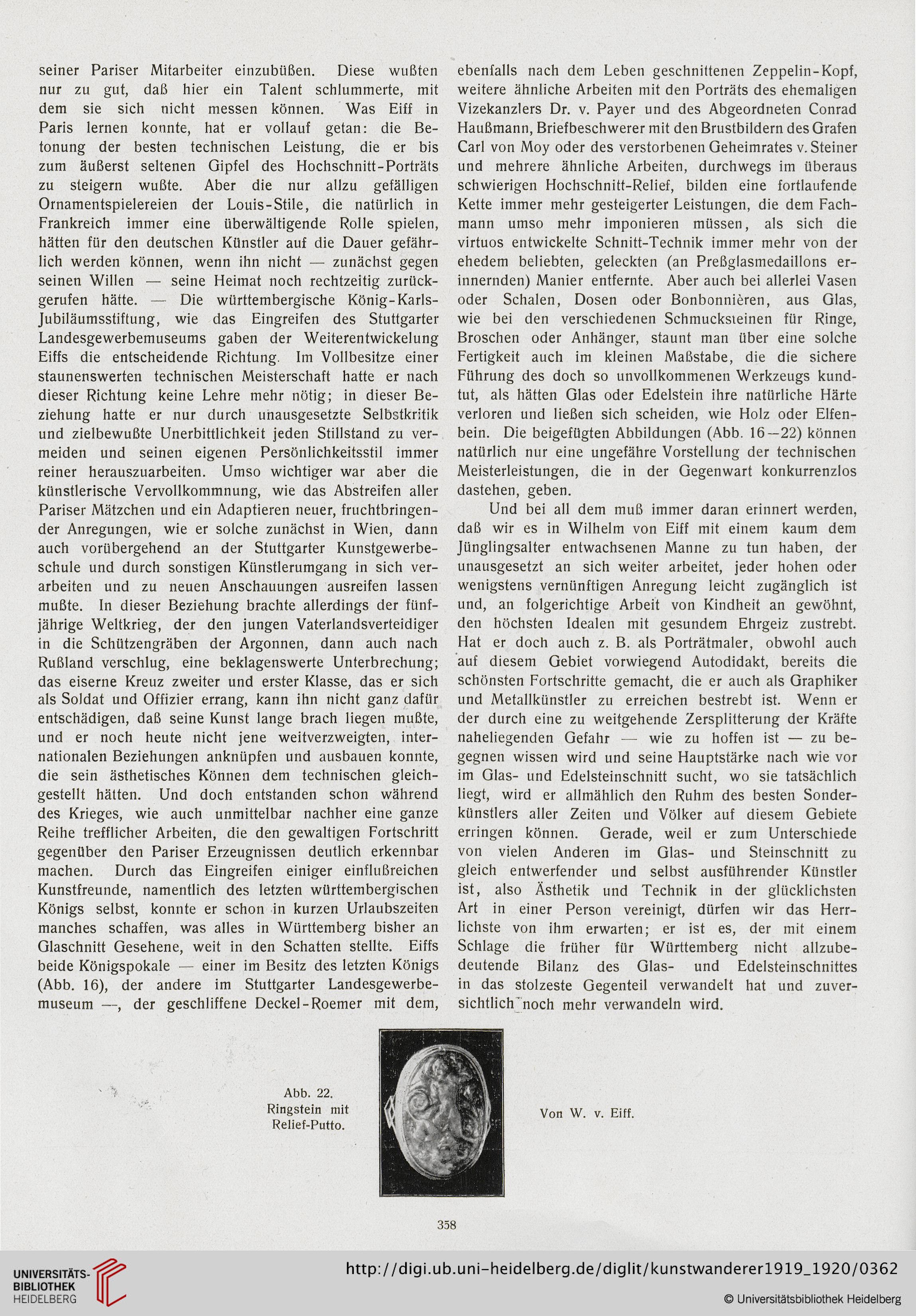seiner Pariser Mitarbeiter einzubüßen. Diese wußten
nur zu gut, daß hier ein Talent schlummerte, mit
dem sie sich nicht messen können. Was Eiff in
Paris lernen konnte, hat er vollauf getan: die Be-
tonung der besten technischen Leistung, die er bis
zum äußerst seltenen Gipfel des Hochschnitt-Porträts
zu steigern wußte. Aber die nur allzu gefälligen
Ornamentspielereien der Louis-Stile, die natürlich in
Frankreich immer eine überwältigende Rolle spielen,
hätten für den deutschen Künstler auf die Dauer gefähr-
lich werden können, wenn ihn nicht — zunächst gegen
seinen Willen — seine Heimat noch rechtzeitig zurück-
gerufen hätte. — Die württembergische König-Karls-
Jubiläumsstiftung, wie das Eingreifen des Stuttgarter
Landesgewerbemuseums gaben der Weiterentwickelung
Eiffs die entscheidende Richtung. Im Vollbesitze einer
staunenswerten technischen Meisterschaft hatte er nach
dieser Richtung keine Lehre mehr nötig; in dieser Be-
ziehung hatte er nur durch unausgesetzte Selbstkritik
und zielbewußte Unerbittlichkeit jeden Stillstand zu ver-
meiden und seinen eigenen Persönlichkeitsstil immer
reiner herauszuarbeiten. Umso wichtiger war aber die
künstlerische Vervollkommnung, wie das Abstreifen aller
Pariser Mätzchen und ein Adaptieren neuer, fruchtbringen-
der Anregungen, wie er solche zunächst in Wien, dann
auch vorübergehend an der Stuttgarter Kunstgewerbe-
schule und durch sonstigen Künstlerumgang in sich ver-
arbeiten und zu neuen Anschauungen ausreifen lassen
mußte. In dieser Beziehung brachte allerdings der fünf-
jährige Weltkrieg, der den jungen Vaterlandsverteidiger
in die Schützengräben der Argonnen, dann auch nach
Rußland verschlug, eine beklagenswerte Unterbrechung;
das eiserne Kreuz zweiter und erster Klasse, das er sich
als Soldat und Offizier errang, kann ihn nicht ganz dafür
entschädigen, daß seine Kunst lange brach liegen mußte,
und er noch heute nicht jene weitverzweigten, inter-
nationalen Beziehungen anknüpfen und ausbauen konnte,
die sein ästhetisches Können dem technischen gleich-
gestellt hätten. Und doch entstanden schon während
des Krieges, wie auch unmittelbar nachher eine ganze
Reihe trefflicher Arbeiten, die den gewaltigen Fortschritt
gegenüber den Pariser Erzeugnissen deutlich erkennbar
machen. Durch das Eingreifen einiger einflußreichen
Kunstfreunde, namentlich des letzten württembergischen
Königs selbst, konnte er schon in kurzen Urlaubszeiten
manches schaffen, was alles in Württemberg bisher an
Qlaschnitt Gesehene, weit in den Schatten stellte. Eiffs
beide Königspokale — einer im Besitz des letzten Königs
(Abb. 16), der andere im Stuttgarter Landesgewerbe-
museum —, der geschliffene Deckel-Roemer mit dem,
ebenfalls nach dem Leben geschnittenen Zeppelin-Kopf,
weitere ähnliche Arbeiten mit den Porträts des ehemaligen
Vizekanzlers Dr. v. Payer und des Abgeordneten Conrad
Haußmann, Briefbeschwerer mit den Brustbildern des Grafen
Carl von Moy oder des verstorbenen Geheimrates v. Steiner
und mehrere ähnliche Arbeiten, durchwegs im überaus
schwierigen Hochschnitt-Relief, bilden eine fortlaufende
Kette immer mehr gesteigerter Leistungen, die dem Fach-
mann umso mehr imponieren müssen, als sich die
virtuos entwickelte Schnitt-Technik immer mehr von der
ehedem beliebten, geleckten (an Preßglasmedaillons er-
innernden) Manier entfernte. Aber auch bei allerlei Vasen
oder Schalen, Dosen oder Bonbonnieren, aus Glas,
wie bei den verschiedenen Schmucksteinen für Ringe,
Broschen oder Anhänger, staunt man über eine solche
Fertigkeit auch im kleinen Maßstabe, die die sichere
Führung des doch so unvollkommenen Werkzeugs kund-
tut, als hätten Glas oder Edelstein ihre natürliche Härte
verloren und ließen sich scheiden, wie Holz oder Elfen-
bein. Die beigefügten Abbildungen (Abb. 16—22) können
natürlich nur eine ungefähre Vorstellung der technischen
Meisterleistungen, die in der Gegenwart konkurrenzlos
dastehen, geben.
Und bei all dem muß immer daran erinnert werden,
daß wir es in Wilhelm von Eiff mit einem kaum dem
Jünglingsalter entwachsenen Manne zu tun haben, der
unausgesetzt an sich weiter arbeitet, jeder hohen oder
wenigstens vernünftigen Anregung leicht zugänglich ist
und, an folgerichtige Arbeit von Kindheit an gewöhnt,
den höchsten Idealen mit gesundem Ehrgeiz zustrebt.
Hat er doch auch z. B. als Porträtmaler, obwohl auch
auf diesem Gebiet vorwiegend Autodidakt, bereits die
schönsten Fortschritte gemacht, die er auch als Graphiker
und Metallkünstler zu erreichen bestrebt ist. Wenn er
der durch eine zu weitgehende Zersplitterung der Kräfte
naheliegenden Gefahr — wie zu hoffen ist — zu be-
gegnen wissen wird und seine Hauptstärke nach wie vor
im Glas- und Edelsteinschnitt sucht, wo sie tatsächlich
liegt, wird er allmählich den Ruhm des besten Sonder-
künstlers aller Zeiten und Völker auf diesem Gebiete
erringen können. Gerade, weil er zum Unterschiede
von vielen Anderen im Glas- und Steinschnitt zu
gleich entwerfender und selbst ausführender Künstler
ist, also Ästhetik und Technik in der glücklichsten
Art in einer Person vereinigt, dürfen wir das Herr-
lichste von ihm erwarten; er ist es, der mit einem
Schlage die früher für Württemberg nicht allzube-
deutende Bilanz des Glas- und Edelsteinschnittes
in das stolzeste Gegenteil verwandelt hat und zuver-
sichtlich noch mehr verwandeln wird.
Abb. 22.
Ringstein mit
Relief-Putto.
Von W. v. Eiff.
358
nur zu gut, daß hier ein Talent schlummerte, mit
dem sie sich nicht messen können. Was Eiff in
Paris lernen konnte, hat er vollauf getan: die Be-
tonung der besten technischen Leistung, die er bis
zum äußerst seltenen Gipfel des Hochschnitt-Porträts
zu steigern wußte. Aber die nur allzu gefälligen
Ornamentspielereien der Louis-Stile, die natürlich in
Frankreich immer eine überwältigende Rolle spielen,
hätten für den deutschen Künstler auf die Dauer gefähr-
lich werden können, wenn ihn nicht — zunächst gegen
seinen Willen — seine Heimat noch rechtzeitig zurück-
gerufen hätte. — Die württembergische König-Karls-
Jubiläumsstiftung, wie das Eingreifen des Stuttgarter
Landesgewerbemuseums gaben der Weiterentwickelung
Eiffs die entscheidende Richtung. Im Vollbesitze einer
staunenswerten technischen Meisterschaft hatte er nach
dieser Richtung keine Lehre mehr nötig; in dieser Be-
ziehung hatte er nur durch unausgesetzte Selbstkritik
und zielbewußte Unerbittlichkeit jeden Stillstand zu ver-
meiden und seinen eigenen Persönlichkeitsstil immer
reiner herauszuarbeiten. Umso wichtiger war aber die
künstlerische Vervollkommnung, wie das Abstreifen aller
Pariser Mätzchen und ein Adaptieren neuer, fruchtbringen-
der Anregungen, wie er solche zunächst in Wien, dann
auch vorübergehend an der Stuttgarter Kunstgewerbe-
schule und durch sonstigen Künstlerumgang in sich ver-
arbeiten und zu neuen Anschauungen ausreifen lassen
mußte. In dieser Beziehung brachte allerdings der fünf-
jährige Weltkrieg, der den jungen Vaterlandsverteidiger
in die Schützengräben der Argonnen, dann auch nach
Rußland verschlug, eine beklagenswerte Unterbrechung;
das eiserne Kreuz zweiter und erster Klasse, das er sich
als Soldat und Offizier errang, kann ihn nicht ganz dafür
entschädigen, daß seine Kunst lange brach liegen mußte,
und er noch heute nicht jene weitverzweigten, inter-
nationalen Beziehungen anknüpfen und ausbauen konnte,
die sein ästhetisches Können dem technischen gleich-
gestellt hätten. Und doch entstanden schon während
des Krieges, wie auch unmittelbar nachher eine ganze
Reihe trefflicher Arbeiten, die den gewaltigen Fortschritt
gegenüber den Pariser Erzeugnissen deutlich erkennbar
machen. Durch das Eingreifen einiger einflußreichen
Kunstfreunde, namentlich des letzten württembergischen
Königs selbst, konnte er schon in kurzen Urlaubszeiten
manches schaffen, was alles in Württemberg bisher an
Qlaschnitt Gesehene, weit in den Schatten stellte. Eiffs
beide Königspokale — einer im Besitz des letzten Königs
(Abb. 16), der andere im Stuttgarter Landesgewerbe-
museum —, der geschliffene Deckel-Roemer mit dem,
ebenfalls nach dem Leben geschnittenen Zeppelin-Kopf,
weitere ähnliche Arbeiten mit den Porträts des ehemaligen
Vizekanzlers Dr. v. Payer und des Abgeordneten Conrad
Haußmann, Briefbeschwerer mit den Brustbildern des Grafen
Carl von Moy oder des verstorbenen Geheimrates v. Steiner
und mehrere ähnliche Arbeiten, durchwegs im überaus
schwierigen Hochschnitt-Relief, bilden eine fortlaufende
Kette immer mehr gesteigerter Leistungen, die dem Fach-
mann umso mehr imponieren müssen, als sich die
virtuos entwickelte Schnitt-Technik immer mehr von der
ehedem beliebten, geleckten (an Preßglasmedaillons er-
innernden) Manier entfernte. Aber auch bei allerlei Vasen
oder Schalen, Dosen oder Bonbonnieren, aus Glas,
wie bei den verschiedenen Schmucksteinen für Ringe,
Broschen oder Anhänger, staunt man über eine solche
Fertigkeit auch im kleinen Maßstabe, die die sichere
Führung des doch so unvollkommenen Werkzeugs kund-
tut, als hätten Glas oder Edelstein ihre natürliche Härte
verloren und ließen sich scheiden, wie Holz oder Elfen-
bein. Die beigefügten Abbildungen (Abb. 16—22) können
natürlich nur eine ungefähre Vorstellung der technischen
Meisterleistungen, die in der Gegenwart konkurrenzlos
dastehen, geben.
Und bei all dem muß immer daran erinnert werden,
daß wir es in Wilhelm von Eiff mit einem kaum dem
Jünglingsalter entwachsenen Manne zu tun haben, der
unausgesetzt an sich weiter arbeitet, jeder hohen oder
wenigstens vernünftigen Anregung leicht zugänglich ist
und, an folgerichtige Arbeit von Kindheit an gewöhnt,
den höchsten Idealen mit gesundem Ehrgeiz zustrebt.
Hat er doch auch z. B. als Porträtmaler, obwohl auch
auf diesem Gebiet vorwiegend Autodidakt, bereits die
schönsten Fortschritte gemacht, die er auch als Graphiker
und Metallkünstler zu erreichen bestrebt ist. Wenn er
der durch eine zu weitgehende Zersplitterung der Kräfte
naheliegenden Gefahr — wie zu hoffen ist — zu be-
gegnen wissen wird und seine Hauptstärke nach wie vor
im Glas- und Edelsteinschnitt sucht, wo sie tatsächlich
liegt, wird er allmählich den Ruhm des besten Sonder-
künstlers aller Zeiten und Völker auf diesem Gebiete
erringen können. Gerade, weil er zum Unterschiede
von vielen Anderen im Glas- und Steinschnitt zu
gleich entwerfender und selbst ausführender Künstler
ist, also Ästhetik und Technik in der glücklichsten
Art in einer Person vereinigt, dürfen wir das Herr-
lichste von ihm erwarten; er ist es, der mit einem
Schlage die früher für Württemberg nicht allzube-
deutende Bilanz des Glas- und Edelsteinschnittes
in das stolzeste Gegenteil verwandelt hat und zuver-
sichtlich noch mehr verwandeln wird.
Abb. 22.
Ringstein mit
Relief-Putto.
Von W. v. Eiff.
358