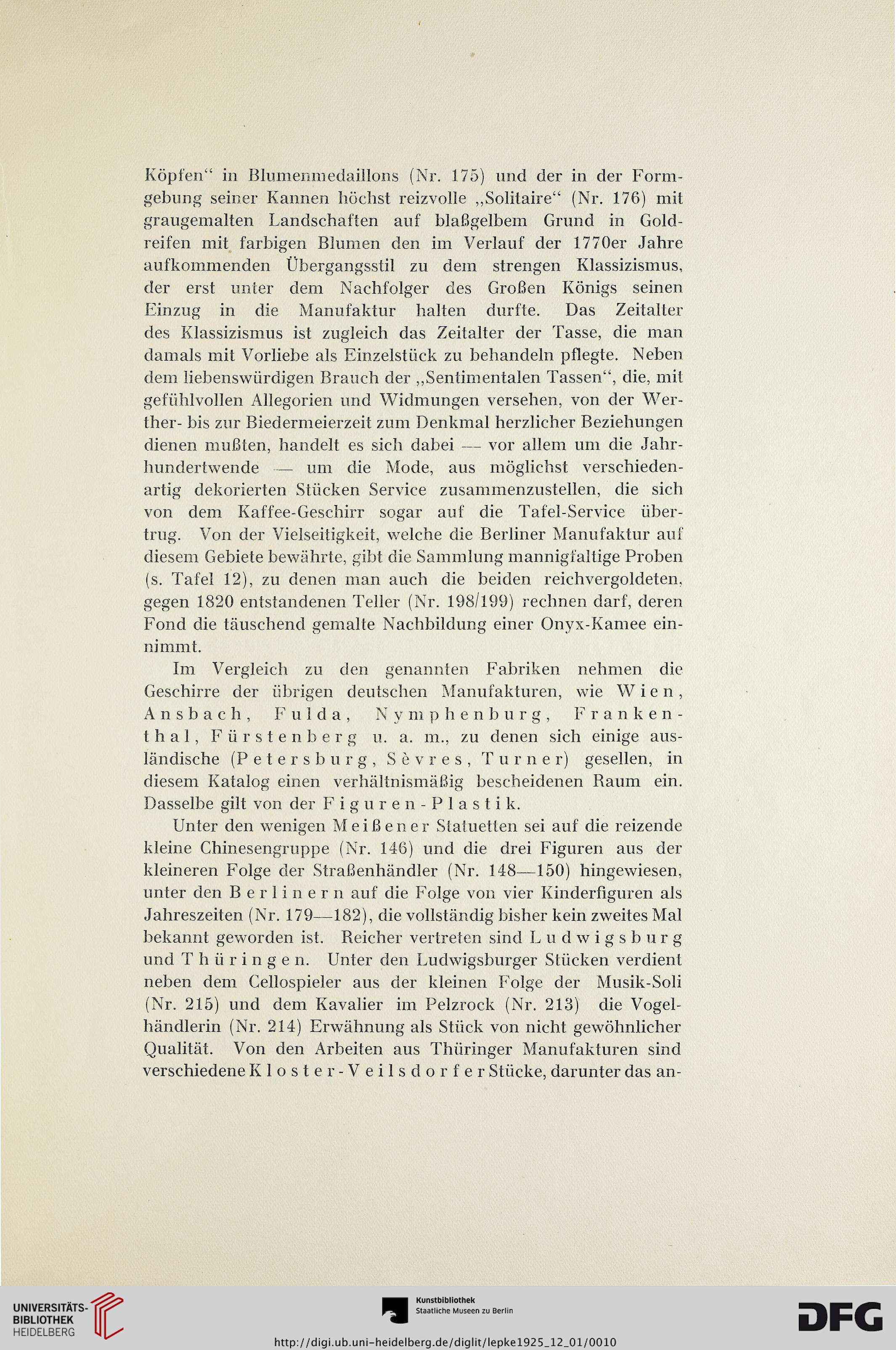t
Köpfen“ in Blimiemnedaillons (Nr. 175) und der in der Form-
gebung seiner Kannen höchst reizvolle „Solitaire“ (Nr. 176) mit
graugemalten Landschaften auf blaßgelbem Grund in Gold-
reifen mit farbigen Blumen den im Verlauf der 1770er Jahre
aufkommenden Übergangsstil zu dem strengen Klassizismus,
der erst unter dem Nachfolger des Großen Königs seinen
Einzug in die Manufaktur halten durfte. Das Zeitalter
des Klassizismus ist zugleich das Zeitalter der Tasse, die man
damals mit Vorliebe als Einzelstück zu behandeln pflegte. Neben
dem liebenswürdigen Brauch der „Sentimentalen Tassen“, die, mit
gefühlvollen Allegorien und Widmungen versehen, von der Wer-
ther- bis zur Biedermeierzeit zum Denkmal herzlicher Beziehungen
dienen mußten, handelt es sich dabei — vor allem um die Jahr-
hundertwende — um die Mode, aus möglichst verschieden-
artig dekorierten Stücken Service zusammenzustellen, die sich
von dem Kaffee-Geschirr sogar auf die Tafel-Service über-
trug. Von der Vielseitigkeit, welche die Berliner Manufaktur auf
diesem Gebiete bewährte, gibt die Sammlung mannigfaltige Proben
(s. Tafel 12), zu denen man auch die beiden reichvergoldeten,
gegen 1820 entstandenen Teller (Nr. 198/199) rechnen darf, deren
Fond die täuschend gemalte Nachbildung einer Onyx-Kamee ein-
nimmt.
Im Vergleich zu den genannten Fabriken nehmen die
Geschirre der übrigen deutschen Manufakturen, wie Wien,
Ansbach, Fulda, Nymphenburg, Franken-
thal, Fürstenberg u. a. m., zu denen sich einige aus-
ländische (Petersburg, Sevres, Turne r) gesellen, in
diesem Katalog einen verhältnismäßig bescheidenen Raum ein.
Dasselbe gilt von der Figuren-Plastik.
Unter den wenigen Meißener Statuetten sei auf die reizende
kleine Chinesengruppe (Nr. 146) und die drei Figuren aus der
kleineren Folge der Straßenhändler (Nr. 148—150) hingewiesen,
unter den Berlinern auf die Folge von vier Kinderfiguren als
Jahreszeiten (Nr. 179—182), die vollständig bisher kein zweites Mal
bekannt geworden ist. Reicher vertreten sind L u d w i g s b u r g
und T h ii r i n g e n. Unter den Ludwigsburger Stücken verdient
neben dem Cellospieler aus der kleinen Folge der Musik-Soli
(Nr. 215) und dem Kavalier im Pelzrock (Nr. 213) die Vogel-
händlerin (Nr. 214) Erwähnung als Stück von nicht gewöhnlicher
Qualität. Von den Arbeiten aus Thüringer Manufakturen sind
verschiedene Kloster-V eilsdorfer Stücke, darunter das an-
Köpfen“ in Blimiemnedaillons (Nr. 175) und der in der Form-
gebung seiner Kannen höchst reizvolle „Solitaire“ (Nr. 176) mit
graugemalten Landschaften auf blaßgelbem Grund in Gold-
reifen mit farbigen Blumen den im Verlauf der 1770er Jahre
aufkommenden Übergangsstil zu dem strengen Klassizismus,
der erst unter dem Nachfolger des Großen Königs seinen
Einzug in die Manufaktur halten durfte. Das Zeitalter
des Klassizismus ist zugleich das Zeitalter der Tasse, die man
damals mit Vorliebe als Einzelstück zu behandeln pflegte. Neben
dem liebenswürdigen Brauch der „Sentimentalen Tassen“, die, mit
gefühlvollen Allegorien und Widmungen versehen, von der Wer-
ther- bis zur Biedermeierzeit zum Denkmal herzlicher Beziehungen
dienen mußten, handelt es sich dabei — vor allem um die Jahr-
hundertwende — um die Mode, aus möglichst verschieden-
artig dekorierten Stücken Service zusammenzustellen, die sich
von dem Kaffee-Geschirr sogar auf die Tafel-Service über-
trug. Von der Vielseitigkeit, welche die Berliner Manufaktur auf
diesem Gebiete bewährte, gibt die Sammlung mannigfaltige Proben
(s. Tafel 12), zu denen man auch die beiden reichvergoldeten,
gegen 1820 entstandenen Teller (Nr. 198/199) rechnen darf, deren
Fond die täuschend gemalte Nachbildung einer Onyx-Kamee ein-
nimmt.
Im Vergleich zu den genannten Fabriken nehmen die
Geschirre der übrigen deutschen Manufakturen, wie Wien,
Ansbach, Fulda, Nymphenburg, Franken-
thal, Fürstenberg u. a. m., zu denen sich einige aus-
ländische (Petersburg, Sevres, Turne r) gesellen, in
diesem Katalog einen verhältnismäßig bescheidenen Raum ein.
Dasselbe gilt von der Figuren-Plastik.
Unter den wenigen Meißener Statuetten sei auf die reizende
kleine Chinesengruppe (Nr. 146) und die drei Figuren aus der
kleineren Folge der Straßenhändler (Nr. 148—150) hingewiesen,
unter den Berlinern auf die Folge von vier Kinderfiguren als
Jahreszeiten (Nr. 179—182), die vollständig bisher kein zweites Mal
bekannt geworden ist. Reicher vertreten sind L u d w i g s b u r g
und T h ii r i n g e n. Unter den Ludwigsburger Stücken verdient
neben dem Cellospieler aus der kleinen Folge der Musik-Soli
(Nr. 215) und dem Kavalier im Pelzrock (Nr. 213) die Vogel-
händlerin (Nr. 214) Erwähnung als Stück von nicht gewöhnlicher
Qualität. Von den Arbeiten aus Thüringer Manufakturen sind
verschiedene Kloster-V eilsdorfer Stücke, darunter das an-