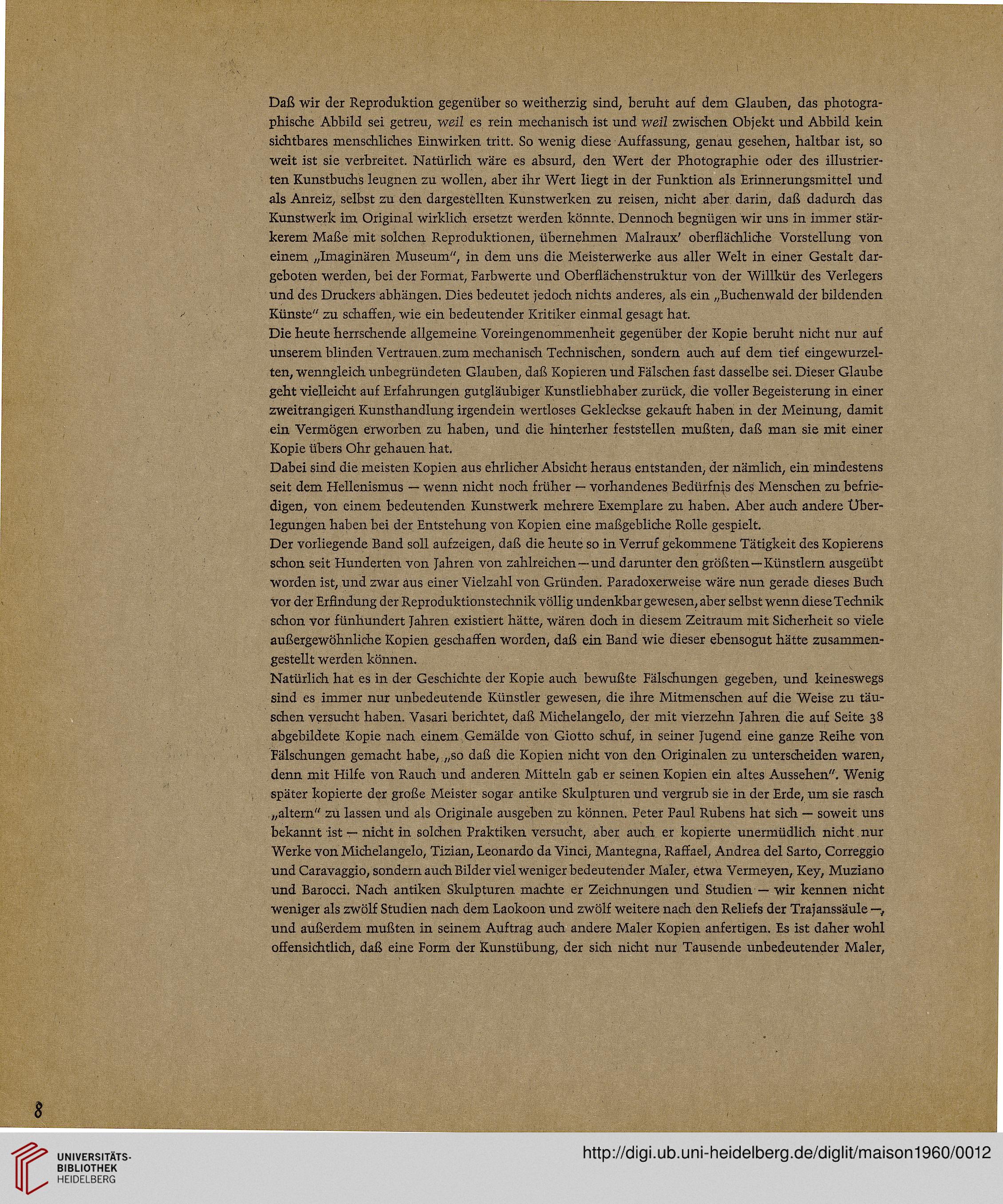Daß wir der Reproduktion gegenüber so weitherzig sind, beruht auf dem Glauben, das photogra-
phische Abbild sei getreu, weil es rein mechanisch ist und weil zwischen Objekt und Abbild kein
sichtbares menschliches Einwirken tritt. So wenig diese Auffassung, genau gesehen, haltbar ist, so
weit ist sie verbreitet. Natürlich wäre es absurd, den Wert der Photographie oder des illustrier-
ten Kunstbuchs leugnen zu wollen, aber ihr Wert liegt in der Funktion als Erinnerungsmittel und
als Anreiz, selbst zu den dargestellten Kunstwerken zu reisen, nicht aber darin, daß dadurch das
Kunstwerk im Original wirklich ersetzt werden könnte. Dennoch begnügen wir uns in immer stär-
kerem Maße mit solchen Reprodulctionen, übernehmen Malraux' oberflächliche Vorstellung von
einem „Imaginären Museum", in dem uns die Meisterwerke aus aller Welt in einer Gestalt dar-
geboten werden, bei der Format, Farbwerte und Oberflächenstruktur von der Willkür des Verlegers
und des Druclcers abhängen. Dies bedeutet jedoch nichts anderes, als ein „Buchenwald der bildenden
Künste" zu schaffen, wie ein bedeutender Kritiker einmal gesagt hat.
Die heute herrschende allgemeine Voreingenommenheit gegenüber der Kopie beruht nicht nur auf
unserem blinden Vertrauen.zum mechanisch Technischen, sondern auch auf dem tief eingewurzel-
ten, wenngleich unbegründeten Glauben, daß Kopieren und Fälschen fast dasselbe sei. Dieser Glaube
geht vielleicht auf Erfahrungen gutgläubiger Kunstliebhaber zurück, die voller Begeisterung in einer
zweitrangigen Kunsthandlung irgendein wertloses Gekleckse gekauft haben in der Meinung, damit
ein Vermögen erworben zu haben, und die hinterher feststellen mußten, daß man sie mit einer
Kopie übers Ohr gehauen hat.
Dabei sind die meisten Kopien aus ehrlicher Absicht heraus entstanden, der nämlich, ein mindestens
seit dem Hellenismus — wenn nicht noch früher — vorhandenes Bcdürfnis des Menschen zu befrie-
digen, von einem bedeutenden Kunstwerk mehrere Exemplare zu haben. Aber auch andere Uber-
legungen haben bei der Entstehung von Kopien eine maßgebliche Rolle gespielt.
Der vorliegende Band soll aufzeigen, daß die heute so in Verruf gekommene Tätiglceit des Kopierens
schon seit Hunderten von Jahren von zahlreichen — und darunter den größten — Künstlern ausgeübt
worden ist, und zwar aus einer Vielzahl von Gründen. Paradoxerweise wäre nun gerade dieses Buch
vor der Erfindung der Reproduktionstechnik völlig undenkbar gewesen, aber selbst wenn dieseTechnik
schon vor fünhundert Jahren existiert hätte, wären doch in diesem Zeitraum mit Sicherheit so viele
außergewöhnliche Kopien geschaffen worden, daß ein Band wie dieser ebensogut hätte zusammen-
gestellt werden können.
Natürlich hat es in der Geschichte der Kopie auch bewußte Fälschungen gegeben, und keineswegs
sind es immer nur unbedeutende Künstler gewesen, die ihre Mitmenschen auf die Weise zu täu-
schen versucht haben. Vasari berichtet, daß Michelangelo, der mit vierzehn Jahren die auf Seite 38
abgebildete Kopie nach einem Gemälde von Giotto schuf, in seiner Jugend eine ganze Reihe von
Fälschungen gemacht habe, „so daß die Kopien nicht von den Originalen zu unterscheiden waren,
denn mit Hilfe von Rauch und anderen Mitteln gab er seinen Kopien ein altes Aussehen". Wenig
später kopierte der große Meister sogar antike Skulpturen und vergrub sie in der Erde, um sie rasch
„altern" zu lassen und als Originale ausgeben zu können. Peter Paul Rubens hat sich — soweit uns
bekannt ist — nicht in solchen Praktiken versucht, aber auch er kopierte unermüdlich nicht. nur
Werke von Michelangelo, Tizian, Leonardo da Vinci, Mantegna, Raffael, Andrea del Sarto, Correggio
und Caravaggio, sondernauchBildervielwenigerbedeutender Maler, etwa Vermeyen, Key, Muziano
und Barocci. Nach antiken Skulpturen machte er Zeichnungen und Studien — wir kennen nicht
weniger als zwölf Studien nach dem Laokoon und zwölf weitere nach den Reliefs der Trajanssäule —>
und außerdem mußten in seinem Auftrag auch andere Maler Kopien anfertigen. Es ist daher wohl
offensichtlich, daß eine Form der Kunstübung, der sich nicht nur Tausende unbedeutender Maler,
phische Abbild sei getreu, weil es rein mechanisch ist und weil zwischen Objekt und Abbild kein
sichtbares menschliches Einwirken tritt. So wenig diese Auffassung, genau gesehen, haltbar ist, so
weit ist sie verbreitet. Natürlich wäre es absurd, den Wert der Photographie oder des illustrier-
ten Kunstbuchs leugnen zu wollen, aber ihr Wert liegt in der Funktion als Erinnerungsmittel und
als Anreiz, selbst zu den dargestellten Kunstwerken zu reisen, nicht aber darin, daß dadurch das
Kunstwerk im Original wirklich ersetzt werden könnte. Dennoch begnügen wir uns in immer stär-
kerem Maße mit solchen Reprodulctionen, übernehmen Malraux' oberflächliche Vorstellung von
einem „Imaginären Museum", in dem uns die Meisterwerke aus aller Welt in einer Gestalt dar-
geboten werden, bei der Format, Farbwerte und Oberflächenstruktur von der Willkür des Verlegers
und des Druclcers abhängen. Dies bedeutet jedoch nichts anderes, als ein „Buchenwald der bildenden
Künste" zu schaffen, wie ein bedeutender Kritiker einmal gesagt hat.
Die heute herrschende allgemeine Voreingenommenheit gegenüber der Kopie beruht nicht nur auf
unserem blinden Vertrauen.zum mechanisch Technischen, sondern auch auf dem tief eingewurzel-
ten, wenngleich unbegründeten Glauben, daß Kopieren und Fälschen fast dasselbe sei. Dieser Glaube
geht vielleicht auf Erfahrungen gutgläubiger Kunstliebhaber zurück, die voller Begeisterung in einer
zweitrangigen Kunsthandlung irgendein wertloses Gekleckse gekauft haben in der Meinung, damit
ein Vermögen erworben zu haben, und die hinterher feststellen mußten, daß man sie mit einer
Kopie übers Ohr gehauen hat.
Dabei sind die meisten Kopien aus ehrlicher Absicht heraus entstanden, der nämlich, ein mindestens
seit dem Hellenismus — wenn nicht noch früher — vorhandenes Bcdürfnis des Menschen zu befrie-
digen, von einem bedeutenden Kunstwerk mehrere Exemplare zu haben. Aber auch andere Uber-
legungen haben bei der Entstehung von Kopien eine maßgebliche Rolle gespielt.
Der vorliegende Band soll aufzeigen, daß die heute so in Verruf gekommene Tätiglceit des Kopierens
schon seit Hunderten von Jahren von zahlreichen — und darunter den größten — Künstlern ausgeübt
worden ist, und zwar aus einer Vielzahl von Gründen. Paradoxerweise wäre nun gerade dieses Buch
vor der Erfindung der Reproduktionstechnik völlig undenkbar gewesen, aber selbst wenn dieseTechnik
schon vor fünhundert Jahren existiert hätte, wären doch in diesem Zeitraum mit Sicherheit so viele
außergewöhnliche Kopien geschaffen worden, daß ein Band wie dieser ebensogut hätte zusammen-
gestellt werden können.
Natürlich hat es in der Geschichte der Kopie auch bewußte Fälschungen gegeben, und keineswegs
sind es immer nur unbedeutende Künstler gewesen, die ihre Mitmenschen auf die Weise zu täu-
schen versucht haben. Vasari berichtet, daß Michelangelo, der mit vierzehn Jahren die auf Seite 38
abgebildete Kopie nach einem Gemälde von Giotto schuf, in seiner Jugend eine ganze Reihe von
Fälschungen gemacht habe, „so daß die Kopien nicht von den Originalen zu unterscheiden waren,
denn mit Hilfe von Rauch und anderen Mitteln gab er seinen Kopien ein altes Aussehen". Wenig
später kopierte der große Meister sogar antike Skulpturen und vergrub sie in der Erde, um sie rasch
„altern" zu lassen und als Originale ausgeben zu können. Peter Paul Rubens hat sich — soweit uns
bekannt ist — nicht in solchen Praktiken versucht, aber auch er kopierte unermüdlich nicht. nur
Werke von Michelangelo, Tizian, Leonardo da Vinci, Mantegna, Raffael, Andrea del Sarto, Correggio
und Caravaggio, sondernauchBildervielwenigerbedeutender Maler, etwa Vermeyen, Key, Muziano
und Barocci. Nach antiken Skulpturen machte er Zeichnungen und Studien — wir kennen nicht
weniger als zwölf Studien nach dem Laokoon und zwölf weitere nach den Reliefs der Trajanssäule —>
und außerdem mußten in seinem Auftrag auch andere Maler Kopien anfertigen. Es ist daher wohl
offensichtlich, daß eine Form der Kunstübung, der sich nicht nur Tausende unbedeutender Maler,