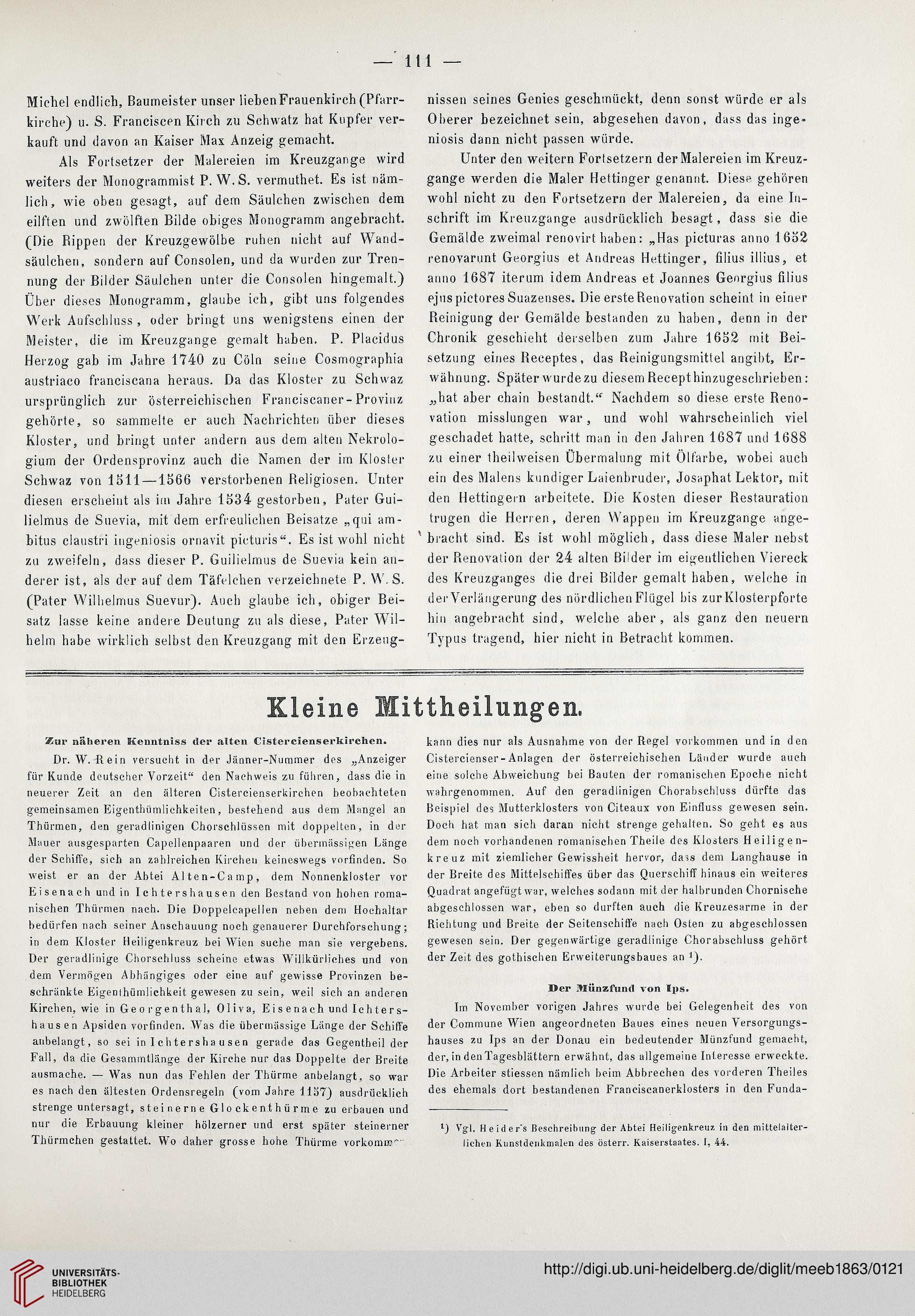111
Micltel endlich, Baumeister unser HebenFrauenkirch (Pfarr-
kirche) u. S. Franciscen Kirch zu Schwatz hat Kupfer ver-
kauft und davon an Kaiser Max Anzeig gemacht.
Ais Fortsetzer der Malereien im Kreuzgange wird
weiters der Monogrammist P. W.S. vermuthet. Es ist näm-
lich, wie oben gesagt, auf dem Säulchen zwischen dem
eilften und zwölften Bilde obiges Monogramm angebracht.
(Die Rippen der Kreuzgewölbe ruhen nicht auf Wand-
säulchen, sondern auf Consolen, und da wurden zur Tren-
nung der Bilder Säulchen unter die Consolen hingemalt.)
Über dieses Monogramm, glaube ich, gibt uns folgendes
Werk Aufschluss, oder bringt uns wenigstens einen der
Meister, die im Kreuzgange gemalt haben. P. Placidus
Herzog gab im Jahre 1740 zu Cöln seine Cosmographia
austriaco franciscana heraus. Da das Kloster zu Schwaz
ursprünglich zur österreichischen Franciscaner-Provinz
gehörte, so sammelte er auch Nachrichten über dieses
Kloster, und bringt unter andern aus dem alten Nekrolo-
gium der Ordensprovinz auch die Namen der im Kloster
Schwaz von 1511 —1566 verstorbenen Religiösen. Unter
diesen erscheint als im Jahre 1534 gestorben, Pater Gui-
lielmus de Suevia, mit dem erfreulichen Beisatze „qui am-
bitus claustri iugeniosis ornavit picturis". Es ist wohl nicht
zu zweifeln, dass dieser P. Guilielmus de Suevia kein an-
derer ist, als der auf dem Täfelchen verzeichnete P. W.S.
(Pater Wilbelmus Suevur). Auch glaube ich, obiger Bei-
satz lasse keine andere Deutung zu als diese, Pater Wil-
helm habe wirklich selbst den Kreuzgang mit den Erzeug-
nissen seines Genies geschmückt, denn sonst würde er als
Oberer bezeichnet sein, abgesehen davon, dass das inge-
niosis dann nicht passen würde.
Unter den weitern Fortsetzern der Malereien im Kreuz-
gange werden die Maler Hettinger genannt. Diese gehören
wohl nicht zu den Fortsetzern der Malereien, da eine In-
schrift im Kreuzgange ausdrücklich besagt, dass sie die
Gemälde zweimal renovirt haben: „Has picturas anno 1652
renovarunt Georgius et Andreas Hettinger, tilius illius, et
anno 1687 iterum idem Andreas et Joannes Georgius tilius
ejuspictoresSuazenses. Die erste Renovation scheint in einer
Reinigung der Gemälde bestanden zu haben, denn in der
Chronik geschieht derselben zum Jahre 1652 mit Bei-
setzung eines Receptes, das Reinigungsmittel angibt, Er-
wähnung. Später wurde zu diesem Recept hinzugeschrieben:
„hat aber ehain bestandt." Nachdem so diese erste Reno-
vation misslungen war, und wohl wahrscheinlich viel
geschadet hatte, schritt man in den Jahren 1687 und 1688
zu einer Ihedweisen Übermalung mit Ölfarbe, wobei auch
ein des Malens kundiger Laienbruder, Josaphat Lektor, mit
den Hettingem arbeitete. Die Kosten dieser Restauration
trugen die Herren, deren Wappen im Kreuzgange ange-
bracht sind. Es ist wohl möglich, dass diese Maler nebst
der Renovation der 24 alten Bilder im eigentlichen Viereck
des Kreuzganges die drei Bilder gemalt haben, welche in
der Verlängerung des nördlichen Flügel bis zur Klosterpforte
hin angebracht sind, welche aber, als ganz den neuern
Typus tragend, hier nicht in Betracht kommen.
Kleine Mittheilungen.
Zur näheren Kenntntss der alten Cistereienserkirchen.
Dr. W. Rein versucht in der Jänner-Nummer des „Anzeiger
für Kunde deutscher Vorzeit" den Nachweis zu führen, dass die in
neuerer Zeit an den äiteren Cistercienserkirchen beobachteten
gemeinsamen Eigenthümiichkeiten, bestehend aus dem Mangel an
Thürmen, den geradlinigen Chorschlüssen mit doppelten, in der
Mauer ausgesparten Capellenpaaren und der übermässigen Länge
der Schiffe, sich an zahlreichen Kirchen keineswegs vorfinden. So
weist er an der Abtei Alten-Camp, dem Nonnenkloster vor
Eisenach und in Ichtershausen den Bestand von hohen roma-
nischen Thürmen nach. Die Doppelcapelien neben dem Hochaltar
bedürfen nach seiner Anschauung noch genauerer Durchforschung;
in dem Kloster Heiligenkreuz bei Wien suche man sie vergebens.
Der geradlinige Chorschluss scheine etwas Willkürliches und von
dem Vermögen Abhängiges oder eine auf gewisse Provinzen be-
schränkte Eigentümlichkeit gewesen zu sein, weil sieb an anderen
Kirchen, wie in Georgenthal, Oliva, Eisenach und Ichters-
hausen Apsiden vorhnden. Was die übermässige Länge der Schiffe
anbelangt, so sei in Ichtershausen gerade das Gegenteil der
Fall, da die Gesammtlänge der Kirche nur das Doppelte der Breite
ausmache. — Was nun das Fehlen der Thürme anbelangt, so war
es nach den ältesten Ordensregeln (vom Jahre 1157) ausdrücklich
strenge untersagt, steinerne Glockenthürme zu erbauen und
nur die Erbauung kleiner hölzerner und erst später steinerner
Thürmchen gestattet. Wo daher grosse hohe Thürme vorkomm"
kann dies nur als Ausnahme von der Regel Vorkommen und in den
Cistercienser-Anlagen der österreichischen Länder wurde auch
eine solche Abweichung bei Bauten der romanischen Epoche nicht
wahrgenommen. Auf den geradlinigen Chorabschluss dürfte das
Beispiel des Mutterklosters von Citeaux von Einfluss gewesen sein.
Doch hat man sich daran nicht strenge gehalten. So geht es aus
dem noch vorhandenen romanischen Theile des Klosters Heiligen-
kreuz mit ziemlicher Gewissheit hervor, dass dem Langhause in
der Breite des Mittelschiffes über das Querschiff hinaus ein weiteres
Quadrat angefügt war, welches sodann mit der halbrunden Chornische
abgeschlossen war, eben so durften auch die Kreuzesarme in der
Richtung und Breite der Seitenschiffe nach Osten zu abgeschlossen
gewesen sein. Der gegenwärtige geradlinige Chorabschluss gehört
der Zeit des gothischen Erweiterungsbaues an *).
Der IMünzfund von tps.
Im November vorigen Jahres wurde bei Gelegenheit des von
der Commune Wien angeordneten Baues eines neuen Versorgungs-
hauses zu Ips an der Donau ein bedeutender Münzfund gemacht,
der, indenTagesblättern erwähnt, das allgemeine Interesse erweckte.
Die Arbeiter stiessen nämlich beim Abbrechen des vorderen Theiles
des ehemals dort bestandenen Franciscanerklosters in den Funda-
*) Vgi. Heider's Beschreibung der Abtei Heiligenkreuz in den mitteiaiter-
lichen Kunstdenkmaten des österr. Kaiserstaates, t, 44.
Micltel endlich, Baumeister unser HebenFrauenkirch (Pfarr-
kirche) u. S. Franciscen Kirch zu Schwatz hat Kupfer ver-
kauft und davon an Kaiser Max Anzeig gemacht.
Ais Fortsetzer der Malereien im Kreuzgange wird
weiters der Monogrammist P. W.S. vermuthet. Es ist näm-
lich, wie oben gesagt, auf dem Säulchen zwischen dem
eilften und zwölften Bilde obiges Monogramm angebracht.
(Die Rippen der Kreuzgewölbe ruhen nicht auf Wand-
säulchen, sondern auf Consolen, und da wurden zur Tren-
nung der Bilder Säulchen unter die Consolen hingemalt.)
Über dieses Monogramm, glaube ich, gibt uns folgendes
Werk Aufschluss, oder bringt uns wenigstens einen der
Meister, die im Kreuzgange gemalt haben. P. Placidus
Herzog gab im Jahre 1740 zu Cöln seine Cosmographia
austriaco franciscana heraus. Da das Kloster zu Schwaz
ursprünglich zur österreichischen Franciscaner-Provinz
gehörte, so sammelte er auch Nachrichten über dieses
Kloster, und bringt unter andern aus dem alten Nekrolo-
gium der Ordensprovinz auch die Namen der im Kloster
Schwaz von 1511 —1566 verstorbenen Religiösen. Unter
diesen erscheint als im Jahre 1534 gestorben, Pater Gui-
lielmus de Suevia, mit dem erfreulichen Beisatze „qui am-
bitus claustri iugeniosis ornavit picturis". Es ist wohl nicht
zu zweifeln, dass dieser P. Guilielmus de Suevia kein an-
derer ist, als der auf dem Täfelchen verzeichnete P. W.S.
(Pater Wilbelmus Suevur). Auch glaube ich, obiger Bei-
satz lasse keine andere Deutung zu als diese, Pater Wil-
helm habe wirklich selbst den Kreuzgang mit den Erzeug-
nissen seines Genies geschmückt, denn sonst würde er als
Oberer bezeichnet sein, abgesehen davon, dass das inge-
niosis dann nicht passen würde.
Unter den weitern Fortsetzern der Malereien im Kreuz-
gange werden die Maler Hettinger genannt. Diese gehören
wohl nicht zu den Fortsetzern der Malereien, da eine In-
schrift im Kreuzgange ausdrücklich besagt, dass sie die
Gemälde zweimal renovirt haben: „Has picturas anno 1652
renovarunt Georgius et Andreas Hettinger, tilius illius, et
anno 1687 iterum idem Andreas et Joannes Georgius tilius
ejuspictoresSuazenses. Die erste Renovation scheint in einer
Reinigung der Gemälde bestanden zu haben, denn in der
Chronik geschieht derselben zum Jahre 1652 mit Bei-
setzung eines Receptes, das Reinigungsmittel angibt, Er-
wähnung. Später wurde zu diesem Recept hinzugeschrieben:
„hat aber ehain bestandt." Nachdem so diese erste Reno-
vation misslungen war, und wohl wahrscheinlich viel
geschadet hatte, schritt man in den Jahren 1687 und 1688
zu einer Ihedweisen Übermalung mit Ölfarbe, wobei auch
ein des Malens kundiger Laienbruder, Josaphat Lektor, mit
den Hettingem arbeitete. Die Kosten dieser Restauration
trugen die Herren, deren Wappen im Kreuzgange ange-
bracht sind. Es ist wohl möglich, dass diese Maler nebst
der Renovation der 24 alten Bilder im eigentlichen Viereck
des Kreuzganges die drei Bilder gemalt haben, welche in
der Verlängerung des nördlichen Flügel bis zur Klosterpforte
hin angebracht sind, welche aber, als ganz den neuern
Typus tragend, hier nicht in Betracht kommen.
Kleine Mittheilungen.
Zur näheren Kenntntss der alten Cistereienserkirchen.
Dr. W. Rein versucht in der Jänner-Nummer des „Anzeiger
für Kunde deutscher Vorzeit" den Nachweis zu führen, dass die in
neuerer Zeit an den äiteren Cistercienserkirchen beobachteten
gemeinsamen Eigenthümiichkeiten, bestehend aus dem Mangel an
Thürmen, den geradlinigen Chorschlüssen mit doppelten, in der
Mauer ausgesparten Capellenpaaren und der übermässigen Länge
der Schiffe, sich an zahlreichen Kirchen keineswegs vorfinden. So
weist er an der Abtei Alten-Camp, dem Nonnenkloster vor
Eisenach und in Ichtershausen den Bestand von hohen roma-
nischen Thürmen nach. Die Doppelcapelien neben dem Hochaltar
bedürfen nach seiner Anschauung noch genauerer Durchforschung;
in dem Kloster Heiligenkreuz bei Wien suche man sie vergebens.
Der geradlinige Chorschluss scheine etwas Willkürliches und von
dem Vermögen Abhängiges oder eine auf gewisse Provinzen be-
schränkte Eigentümlichkeit gewesen zu sein, weil sieb an anderen
Kirchen, wie in Georgenthal, Oliva, Eisenach und Ichters-
hausen Apsiden vorhnden. Was die übermässige Länge der Schiffe
anbelangt, so sei in Ichtershausen gerade das Gegenteil der
Fall, da die Gesammtlänge der Kirche nur das Doppelte der Breite
ausmache. — Was nun das Fehlen der Thürme anbelangt, so war
es nach den ältesten Ordensregeln (vom Jahre 1157) ausdrücklich
strenge untersagt, steinerne Glockenthürme zu erbauen und
nur die Erbauung kleiner hölzerner und erst später steinerner
Thürmchen gestattet. Wo daher grosse hohe Thürme vorkomm"
kann dies nur als Ausnahme von der Regel Vorkommen und in den
Cistercienser-Anlagen der österreichischen Länder wurde auch
eine solche Abweichung bei Bauten der romanischen Epoche nicht
wahrgenommen. Auf den geradlinigen Chorabschluss dürfte das
Beispiel des Mutterklosters von Citeaux von Einfluss gewesen sein.
Doch hat man sich daran nicht strenge gehalten. So geht es aus
dem noch vorhandenen romanischen Theile des Klosters Heiligen-
kreuz mit ziemlicher Gewissheit hervor, dass dem Langhause in
der Breite des Mittelschiffes über das Querschiff hinaus ein weiteres
Quadrat angefügt war, welches sodann mit der halbrunden Chornische
abgeschlossen war, eben so durften auch die Kreuzesarme in der
Richtung und Breite der Seitenschiffe nach Osten zu abgeschlossen
gewesen sein. Der gegenwärtige geradlinige Chorabschluss gehört
der Zeit des gothischen Erweiterungsbaues an *).
Der IMünzfund von tps.
Im November vorigen Jahres wurde bei Gelegenheit des von
der Commune Wien angeordneten Baues eines neuen Versorgungs-
hauses zu Ips an der Donau ein bedeutender Münzfund gemacht,
der, indenTagesblättern erwähnt, das allgemeine Interesse erweckte.
Die Arbeiter stiessen nämlich beim Abbrechen des vorderen Theiles
des ehemals dort bestandenen Franciscanerklosters in den Funda-
*) Vgi. Heider's Beschreibung der Abtei Heiligenkreuz in den mitteiaiter-
lichen Kunstdenkmaten des österr. Kaiserstaates, t, 44.