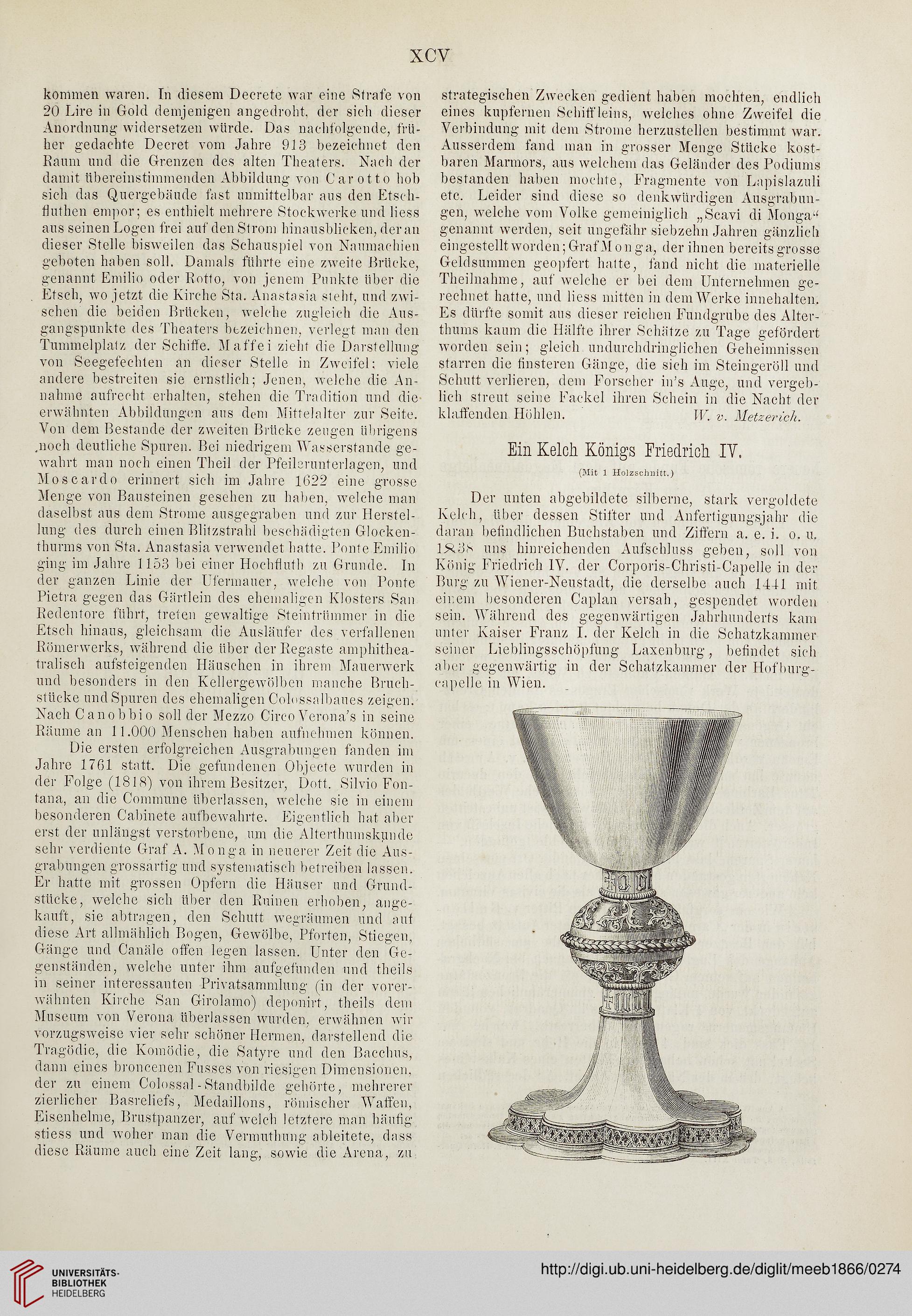xcv
kommen waren. In diesem Decrete war eine Strafe von
20 Lire in Gold demjenigen angedroht, der sich dieser
Anordnung widersetzen würde. Das nachfolgende, frü-
her gedachte Decret vom Jahre 913 bezeichnet den
Raum und die Grenzen des alten Theaters. Nach der
damit übereinstimmenden Abbildung von Carotto hob
sich das Quergebäude fast unmittelbar ans den Etsch-
fluthen empor; es enthielt mehrere Stockwerke und Hess
aus seinen Logen frei auf den Strom hinausblicken, der an
dieser Stelle bisweilen das Schauspiel von Naumachien
geboten haben soll. Damals führte eine zweite Brücke,
genannt Emilio oder Rotto, von jenem Punkte über die
Etsch, wo jetzt die Kirche Sta. Anastasia sieht, und zwi-
schen die beiden Brücken, welche zugleich die Aus-
gangspunkte des Theaters bezeichnen, verlegt man den
Tummelplatz der Schiffe. Maffei zieht die Darstellung
von Seegefechten an dieser Stelle in Zweifel; viele
andere bestreiten sie ernstlich; Jenen, welche die An-
nahme aufrecht erhalten, stehen die Tradition und die-
erwähnten Abbildungen aus dem Mittelalter zur Seite.
Von dem Bestände der zweiten Brücke zeugen übrigens
.noch deutliche Spuren. Bei niedrigem Wasserstande ge-
wahrt man noch einen Theil der Pfeilerunterlagen, und
Mos ca rdo erinnert sich im Jahre 1622 eine grosse
Menge von Bausteinen gesehen zu haben, welche man
daselbst aus dem Strome ausgegraben und zur Herstel-
lung des durch einen Blitzstrahl beschädigten Glocken-
thurms von Sta. Anastasia verwendet hatte. Ponte Emilio
ging im Jahre 1153 bei einer Hochfluth zu Grunde. In
der ganzen Linie der Ufermauer, welche von Ponte
Pietra gegen das Gärtlein des ehemaligen Klosters San
Redentore führt, treten gewaltige Steintrümmer in die
Etsch hinaus, gleichsam die Ausläufer des verfallenen
Römerwerks, während die über der Regaste amphithea-
tralisch aufsteigenden Häuschen in ihrem Mauerwerk
und besonders in den Kellergewölben manche Bruch-
stücke und Spuren des ehemaligen Colossalbaues zeigen.
Nach Canobbio soll der Mezzo Circo Verona’s in seine
Räume an 11.000 Menschen haben aufnehmen können.
Die ersten erfolgreichen Ausgrabungen fanden im
Jahre 1761 statt. Die gefundenen Objecte wurden in
der Folge (18 LS) von ihrem Besitzer, Dott. Silvio Fon-
tana, an die Commune überlassen, welche sie in einem
besonderen Cabinete aufbewahrte. Eigentlich hat aber
erst der unlängst verstorbene, um die Alterthumskunde
sehr verdiente Graf A. Monga in neuerer Zeit die Aus-
grabungen grossartig und systematisch betreiben lassen.
Er hatte mit grossen Opfern die Häuser und Grund-
stücke, welche sich über den Ruinen erhoben, ange-
kauft, sie abtragen, den Schutt wegräumen und aut
diese Art allmählich Bogen, Gewölbe, Pforten, Stiegen,
Gänge und Canäle offen legen lassen. Unter den Ge-
genständen, welche unter ihm aufgefunden und theils
in seiner interessanten Privatsammlung (in der vorer-
wähnten Kirche San Girolamo) deponirt, theils dem
Museum von Verona überlassen wurden, erwähnen wir
vorzugsweise vier sehr schöner Hermen, darstellend die
Tragödie, die Komödie, die Satyre und den Bacchus,
dann eines broncenen Fusses von riesigen Dimensionen,
der zu einem Colossal - Standbilde gehörte, mehrerer
zierlicher Basreliefs, Medaillons, römischer Waffen,
Eisenhelme, Brustpanzer, auf welch letztere man häufig
stiess und woher man die Vermuthung ableitete, dass
diese Räume auch eine Zeit lang, sowie die Arena, zu
strategischen Zwecken gedient haben mochten, endlich
eines kupfernen Schiffleins, welches ohne Zweifel die
Verbindung mit dem Strome herzustellen bestimmt war.
Ausserdem fand man in grosser Menge Stücke kost-
baren Marmors, aus welchem das Geländer des Podiums
bestanden haben mochte, Fragmente von Lapislazuli
etc. Leider sind diese so denkwürdigen Ausgrabun-
gen, welche vom Volke gemeiniglich „Scavi di Mongau
genannt werden, seit ungefähr siebzehn Jahren gänzlich
eingestellt worden; Graf .Mo n ga, der ihnen bereits grosse
Geldsummen geopfert hatte, fand nicht die materielle
Theilnahme, auf welche er bei dem Unternehmen ge-
rechnet hatte, und Hess mitten in dem Werke innehalten.
Es dürfte somit aus dieser reichen Fundgrube des Alter-
thums kaum die Hälfte ihrer Schätze zu Tage gefördert
worden sein; gleich undurchdringlichen Geheimnissen
starren die finsteren Gänge, die sich im Steingeröll und
Schutt verlieren, dem Forscher in’s Auge, und vergeb-
lich streut seine Fackel ihren Schein in die Nacht der
klaffenden Höhlen. W. v. Metzer ich.
Ein Kelch Königs Friedrich IY.
(Mit 1 Holzschnitt.)
Der unten abgebildete silberne, stark vergoldete
Kelch, über dessen Stifter und Anfertigungsjahr die
daran befindlichen Buchstaben und Ziffern a. e. i. o. u.
15<3^ uns hinreichenden Aufschluss geben, soll von
König Friedrich IV. der Corporis-Christi-Capelle in der
Burg zu Wiener-Neustadt, die derselbe auch 1441 mit
einem besonderen Caplan versah, gespendet worden
sein. Während des gegenwärtigen Jahrhunderts kam
unter Kaiser Franz I. der Kelch in die Schatzkammer
seiner Lieblingsschöpfung Laxenburg, befindet sich
aber gegenwärtig in der Schatzkammer der Hofburg-
capelle in Wien.
kommen waren. In diesem Decrete war eine Strafe von
20 Lire in Gold demjenigen angedroht, der sich dieser
Anordnung widersetzen würde. Das nachfolgende, frü-
her gedachte Decret vom Jahre 913 bezeichnet den
Raum und die Grenzen des alten Theaters. Nach der
damit übereinstimmenden Abbildung von Carotto hob
sich das Quergebäude fast unmittelbar ans den Etsch-
fluthen empor; es enthielt mehrere Stockwerke und Hess
aus seinen Logen frei auf den Strom hinausblicken, der an
dieser Stelle bisweilen das Schauspiel von Naumachien
geboten haben soll. Damals führte eine zweite Brücke,
genannt Emilio oder Rotto, von jenem Punkte über die
Etsch, wo jetzt die Kirche Sta. Anastasia sieht, und zwi-
schen die beiden Brücken, welche zugleich die Aus-
gangspunkte des Theaters bezeichnen, verlegt man den
Tummelplatz der Schiffe. Maffei zieht die Darstellung
von Seegefechten an dieser Stelle in Zweifel; viele
andere bestreiten sie ernstlich; Jenen, welche die An-
nahme aufrecht erhalten, stehen die Tradition und die-
erwähnten Abbildungen aus dem Mittelalter zur Seite.
Von dem Bestände der zweiten Brücke zeugen übrigens
.noch deutliche Spuren. Bei niedrigem Wasserstande ge-
wahrt man noch einen Theil der Pfeilerunterlagen, und
Mos ca rdo erinnert sich im Jahre 1622 eine grosse
Menge von Bausteinen gesehen zu haben, welche man
daselbst aus dem Strome ausgegraben und zur Herstel-
lung des durch einen Blitzstrahl beschädigten Glocken-
thurms von Sta. Anastasia verwendet hatte. Ponte Emilio
ging im Jahre 1153 bei einer Hochfluth zu Grunde. In
der ganzen Linie der Ufermauer, welche von Ponte
Pietra gegen das Gärtlein des ehemaligen Klosters San
Redentore führt, treten gewaltige Steintrümmer in die
Etsch hinaus, gleichsam die Ausläufer des verfallenen
Römerwerks, während die über der Regaste amphithea-
tralisch aufsteigenden Häuschen in ihrem Mauerwerk
und besonders in den Kellergewölben manche Bruch-
stücke und Spuren des ehemaligen Colossalbaues zeigen.
Nach Canobbio soll der Mezzo Circo Verona’s in seine
Räume an 11.000 Menschen haben aufnehmen können.
Die ersten erfolgreichen Ausgrabungen fanden im
Jahre 1761 statt. Die gefundenen Objecte wurden in
der Folge (18 LS) von ihrem Besitzer, Dott. Silvio Fon-
tana, an die Commune überlassen, welche sie in einem
besonderen Cabinete aufbewahrte. Eigentlich hat aber
erst der unlängst verstorbene, um die Alterthumskunde
sehr verdiente Graf A. Monga in neuerer Zeit die Aus-
grabungen grossartig und systematisch betreiben lassen.
Er hatte mit grossen Opfern die Häuser und Grund-
stücke, welche sich über den Ruinen erhoben, ange-
kauft, sie abtragen, den Schutt wegräumen und aut
diese Art allmählich Bogen, Gewölbe, Pforten, Stiegen,
Gänge und Canäle offen legen lassen. Unter den Ge-
genständen, welche unter ihm aufgefunden und theils
in seiner interessanten Privatsammlung (in der vorer-
wähnten Kirche San Girolamo) deponirt, theils dem
Museum von Verona überlassen wurden, erwähnen wir
vorzugsweise vier sehr schöner Hermen, darstellend die
Tragödie, die Komödie, die Satyre und den Bacchus,
dann eines broncenen Fusses von riesigen Dimensionen,
der zu einem Colossal - Standbilde gehörte, mehrerer
zierlicher Basreliefs, Medaillons, römischer Waffen,
Eisenhelme, Brustpanzer, auf welch letztere man häufig
stiess und woher man die Vermuthung ableitete, dass
diese Räume auch eine Zeit lang, sowie die Arena, zu
strategischen Zwecken gedient haben mochten, endlich
eines kupfernen Schiffleins, welches ohne Zweifel die
Verbindung mit dem Strome herzustellen bestimmt war.
Ausserdem fand man in grosser Menge Stücke kost-
baren Marmors, aus welchem das Geländer des Podiums
bestanden haben mochte, Fragmente von Lapislazuli
etc. Leider sind diese so denkwürdigen Ausgrabun-
gen, welche vom Volke gemeiniglich „Scavi di Mongau
genannt werden, seit ungefähr siebzehn Jahren gänzlich
eingestellt worden; Graf .Mo n ga, der ihnen bereits grosse
Geldsummen geopfert hatte, fand nicht die materielle
Theilnahme, auf welche er bei dem Unternehmen ge-
rechnet hatte, und Hess mitten in dem Werke innehalten.
Es dürfte somit aus dieser reichen Fundgrube des Alter-
thums kaum die Hälfte ihrer Schätze zu Tage gefördert
worden sein; gleich undurchdringlichen Geheimnissen
starren die finsteren Gänge, die sich im Steingeröll und
Schutt verlieren, dem Forscher in’s Auge, und vergeb-
lich streut seine Fackel ihren Schein in die Nacht der
klaffenden Höhlen. W. v. Metzer ich.
Ein Kelch Königs Friedrich IY.
(Mit 1 Holzschnitt.)
Der unten abgebildete silberne, stark vergoldete
Kelch, über dessen Stifter und Anfertigungsjahr die
daran befindlichen Buchstaben und Ziffern a. e. i. o. u.
15<3^ uns hinreichenden Aufschluss geben, soll von
König Friedrich IV. der Corporis-Christi-Capelle in der
Burg zu Wiener-Neustadt, die derselbe auch 1441 mit
einem besonderen Caplan versah, gespendet worden
sein. Während des gegenwärtigen Jahrhunderts kam
unter Kaiser Franz I. der Kelch in die Schatzkammer
seiner Lieblingsschöpfung Laxenburg, befindet sich
aber gegenwärtig in der Schatzkammer der Hofburg-
capelle in Wien.