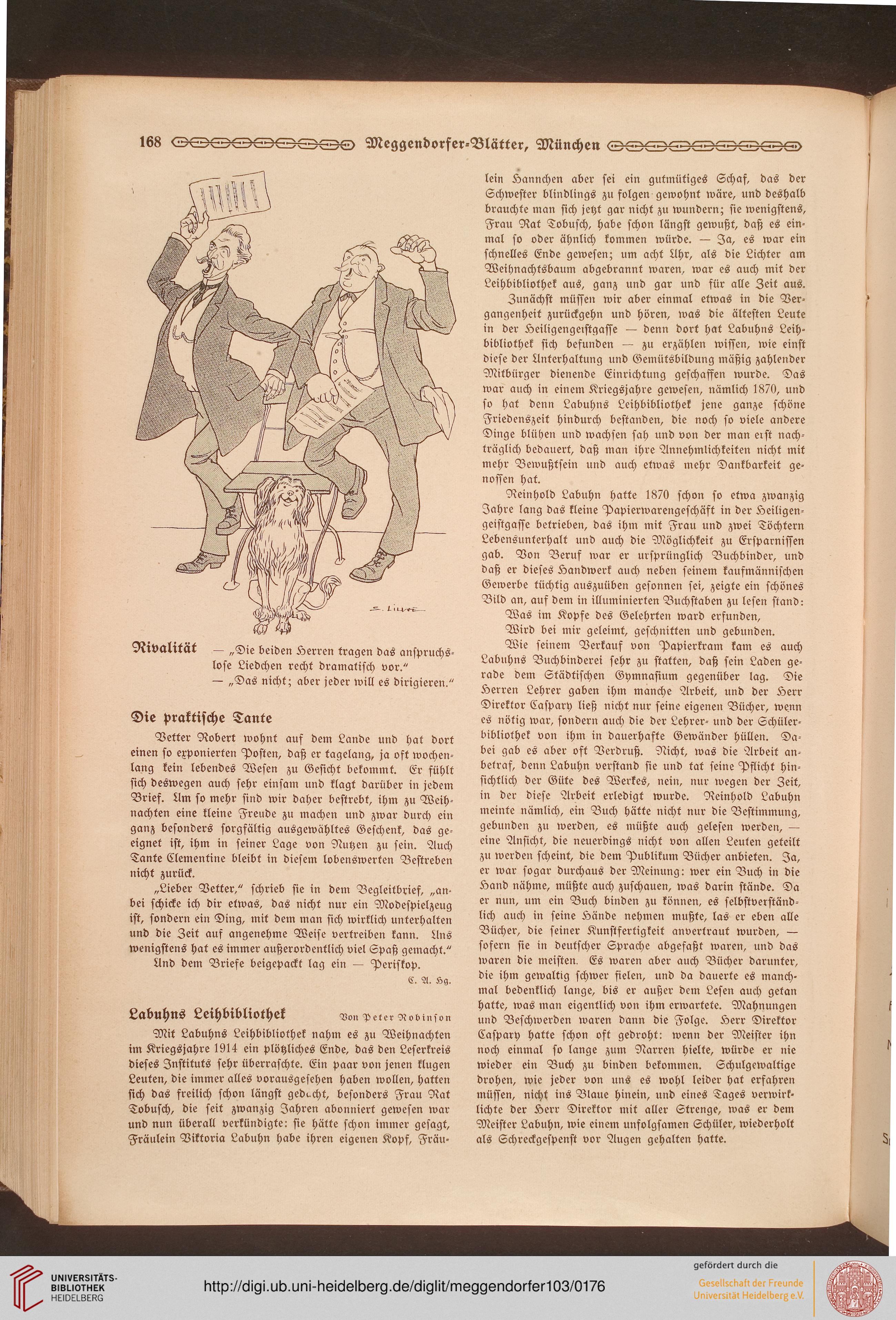Rivalität — „Die beiden Lerren tragen das anspruchs-
lose Liedchen recht dramatisch vor."
— „Das nicht; aber jeder will es dirigieren."
Die praktische Tante
Vetter Robert wohnt auf dem Lande und hat dort
einen so exponierten Posten, daß er tagelang, ja oft wochen-
lang kein lebendes Wesen zu Gesicht bekommt. Er fühlt
sich deswegen auch sehr einsam und klagt darüber in jedem
Brief. !lm so mehr sind wir daher bestrebt, ihm zu Weih-
nachten eine kleine Freude zu machen und zwar durch ein
ganz besonders sorgfältig ausgewähltes Geschenk, das ge-
eignet ist, ihm in seiner Lage von Nuhen zu sein. Auch
Tante Clementine bleibt in diesem lobenswerten Bestreben
nicht zurück.
„Lieber Vetter," schrieb sie in dem Begleitbrief, „an-
bei schicke ich dir etwas, das nicht nur ein Modespielzeug
ist, sondern ein Ding, mit dem man sich wirklich unterhalten
und die Zeit auf angenehme Weise vertreiben kann. Uns
wenigstens hat es immer außerordentlich viel Spaß gemacht."
Und dem Briefe beigepackt lag ein — Periskop.
(5. A. Lg.
öbkpököktvlpbk Von Peter Robinson
Mit Labuhns Leihbibliothek nahm es zu Weihnachten
im Kriegsjahre 1914 ein plötzliches Ende, das den Leserkreis
dieses Instituts sehr überraschte. Ein paar von jenen klugen
Leuten, die immer alles vorausgesehen haben wollen, hatten
sich das freilich schon längst getwcht, besonders Frau Nat
Tobusch, die seit zwanzig Iahren abonniert gewesen war
und nun überall verkündigte: sie hätte schon immer gesagt,
Fräulein Viktoria Labuhn habe ihren eigenen Kopf, Fräu-
lein Lannchen aber sei ein gutmütiges Schaf, das der
Schwester blindlings zu folgen gewohnt wäre, und deshalb
brauchte man sich jetzt gar nicht zu wundern; sie wenigstens,
Frau Rat Tobusch, habe schon längst gewußt, daß es ein-
mal so oder ähnlich kommen würde. — Ia, es war ein
schnelles Ende gewesen; um acht Ahr, als die Lichter am
Weihnachtsbaum abgebrannt waren, war es auch mit der
Leihbibliothek aus, ganz und gar und für alle Zeit aus.
Zunächst müssen wir aber einmal etwas in die Ver-
gangenheit zurückgehn und hören, was die ältesten Leute
in der Leiligengeistgasse — denn dort hat Labuhns Leih°
bibliothek sich befunden — zu erzählen wissen, wie einst
diese der Unterhaltung und Gemütsbildung mäßig zahlender
Mitbürger dienende Einrichtung geschaffen wurde. Das
war auch in einem Kriegsjahre gewesen, nämlich 1870, und
so hat denn Labuhns Leihbibliothek jene ganze schöne
Friedenszeit hindurch bestanden, die noch so viele andere
Dinge blühen und wachsen sah und von der man erst nach-
träglich bedauert, daß man ihre Annehmlichkeiten nicht mit
mehr Bewußtsein und auch etwas mehr Dankbarkeit ge-
nossen hat.
Reinhold Labuhn hatte 1870 schon so etwa zwanzig
Iahre lang das kleine Papierwarengeschäft in der Leiligen-
geistgasse betrieben, das ihm mit Frau und zwei Töchtern
Lebensunterhalt und auch die Möglichkeit zu Ersparnissen
gab. Von Beruf war er ursprünglich Buchbinder, und
daß er dieses Landwerk auch neben seinem kaufmännischen
Gewerbe tüchtig auszuüben gesonnen sei, zeigte ein schönes
Bild an, auf dem in illuminierten Buchstaben zu lesen stand:
Was im Kopfe des Gelehrten ward erfunden,
Wird bei mir geleimt, geschnitten und gebunden.
Wie seinem Verkauf von Papierkram kam es auch
Labuhns Buchbinderei sehr zu statten, daß sein Laden ge-
rade dem Städtischen Gymnasium gegenüber lag. Die
Lerren Lehrer gaben ihm manche Arbeit, und der Lerr
Direktor Caspary ließ nicht nur seine eigenen Bücher, wenn
es nötig war, sondern auch die der Lehrer- und der Schüler-
bibliothek von ihm in dauerhafte Gewänder hüllen. Da-
bei gab es aber oft Verdruß. Richt, was die Arbeit an-
betraf, denn Labuhn verstand sie und tat seine Pflicht hin-
sichtlich der Güte des Werkes, nein, nur wegen der Zeit,
in der diese Arbeit erledigt wurde. Reinhold Labuhn
meinte nämlich, ein Buch hätte nicht nur die Bestimmung,
gebunden zu werden, es müßte auch gelesen werden, —
eine Ansicht, die neuerdings nicht von allen Leuten geteilt
zu werden scheint, die dem Publikum Bücher anbieten. Ia,
er war sogar durchaus der Meinung: wer ein Buch in die
Land nähme, müßte auch zuschauen, was darin stände. Da
er nun, um ein Buch binden zu können, es selbstverständ-
lich auch in seine Lände nehmen mußte, las er eben alle
Bücher, die seiner Kunstfertigkeit anvertraut wurden, —
sofern sie in deutscher Sprache abgefaßt waren, und das
waren die meisten. Es waren aber auch Bücher darunter,
die ihm gewaltig schwer fielen, und da dauerte es manch-
mal bedenklich lange, bis er außer dem Lesen auch getan
hatte, was man eigentlich von ihm erwartete. Mahnungen
und Beschwerden waren dann die Folge. Lerr Direktor
Caspary hatte schon oft gedroht: wenn der Meister ihn
noch einmal so lange zum Narren hielte, würde er nie
wieder ein Buch zu binden bekommen. Schulgewaltige
drohen, wie jeder von uns es wohl leider hat erfahren
müssen, nicht ins Blaue hinein, und eines Tages verwirk-
lichte der Lerr Direktor mit aller Strenge, was er dem
Meister Labuhn, wie einem unfolgsamen Schüler, wiederholt
als Schreckgespenst vor Augen gehalten hatte.