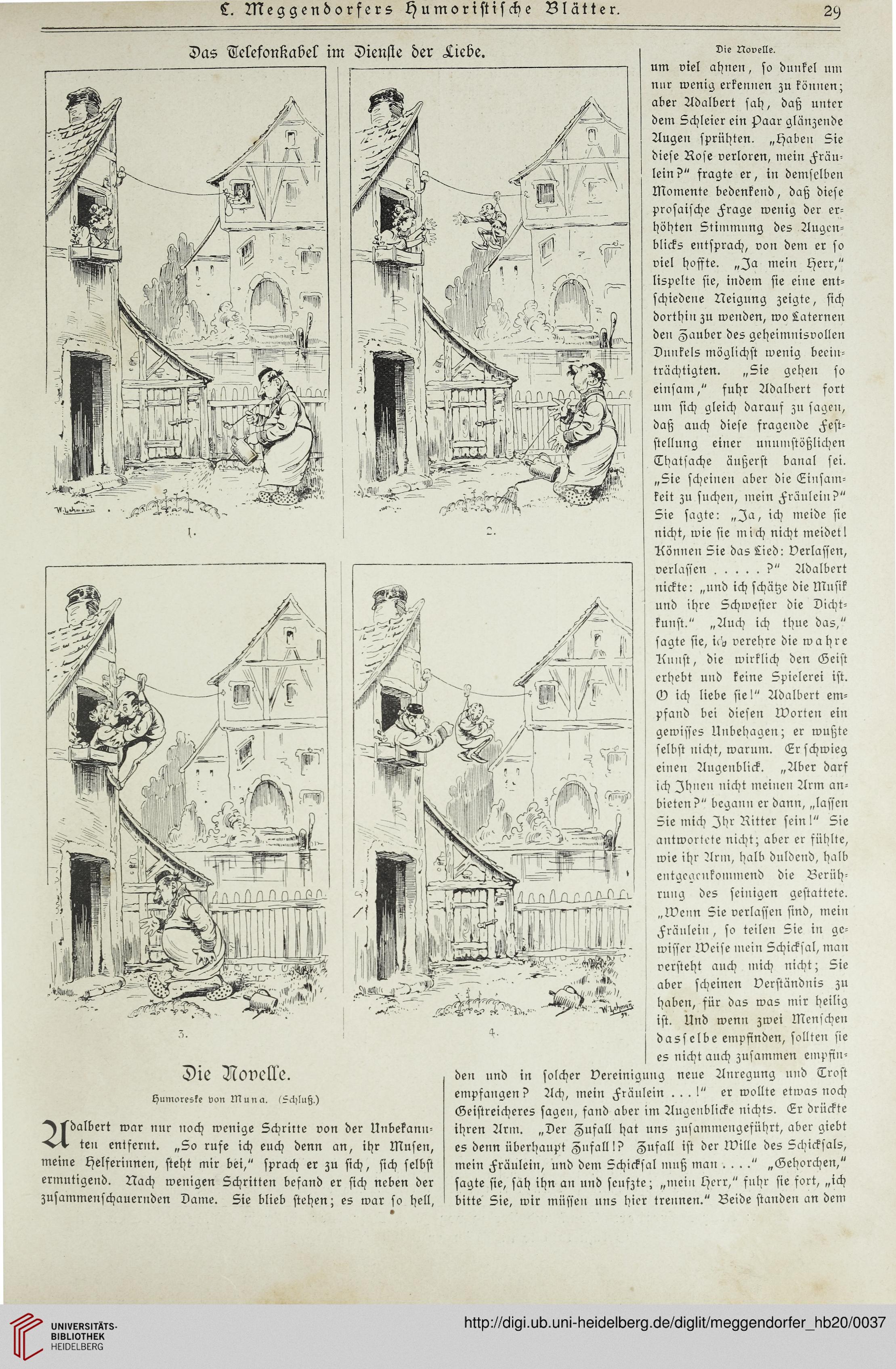Das Telefonkabel im Dienste der Liebe.
Die Uovelle.
dalbert war nur nach wenige 5chrilte von der Unbekann-
ten entfernt. „So rufe ich euch denn an, ihr Musen,
meine kfelferinnen, steht mir bei," sprach er zu sich, sich selbst
ermntigend. Nach wenigen Schritten befand er sich neben der
zusammenschauernden Dame. 5ie blieb stehen; es war so hell,
um viel ahnen, so dunkel um
nur wenig erkennen zu können;
aber Adalbert fah, daß untcr
dem Schleier ein s)aar glänzende
Augen sxrühten. „bsabeu Sie
diese Rose verloren, mein Fräu-
lein?" fragte er, in demselben
Momente bedenkend, daß diese
xrosaische Frage wenig der er-
höhten Stimmung des Augen-
blicks entsprach, von dem er so
viel hoffte. „Ia mein Lserr,"
lispelte sie, indem sie eine ent-
schiedene Neigung zeigte, sich
dorthin zu wenden, wo Laternen
den Zauber des geheimnisvollen
Dunkels möglichst wenig beein-
trächtigten. „Sie gehen so
einfam," fuhr Adalbert sort
um sich gleich darauf zu sagen,
daß auch diese fragende Fest-
stellung einer unumstößlichen
Thatsache äußerst banal sei.
„Sie scheinen aber die Einsam-
keit zu suchen, mein Fräulein?"
Sie sagte: „Ia, ich meide sie
nicht, wie sie mich nicht meidetl
Aönnen Sie das Lied: verlassen,
verlassen.?" Adalbert
nickte: „und ich schätze die Musik
und ihre Schwester die Dicht-
kunst." „Auch ich thue das,"
sagte sie, ich verehre die wahre
Aunft, die wirklich den Geist
erhebt und keine Spielerei ist.
M ich liebe siel" Adalbert em-
pfand bei diesen Nlorten ein
gewisses Unbehagen; er wußte
selbst nicht, warum. Lr schwieg
einen Augenblick. „Aber darf
ich Ihnen nicht meinen Arm an-
bieten?" begann er dann, „lassen
Sie mich Ihr Ritter sein I" Sie
antwortete nicht; aber er fühlte,
wie ihr Arm, halb duldend, halb
eutgcgenkommend die Berüh-
ruug des seinigen geftattete.
„Wenn Sie verlassen sind, mein
Fräulein, so teilen Sie in ge-
wisser Weise mein Schicksal, man
versteht auch mich nicht; Sie
aber scheinen verftändnis zu
haben, für das was inir heilig
ist. Und wenn zwei Menschen
l dasselbe empfinden, sollten sie
j es nicht auch zusammen einpfin-
den und in solcher Vereinigung neue Anregung und Trost
empfangen? Ach, mein Fräulein ... I" er wollte etwas noch
Geistreicheres sageu, fand aber im Augenblicke nichts. Tr drückte
ihren Arm. „Der Zufall hat uns zusammengeführt, aber giebt
es denn überhaupt Zufall l? Zufall ist der Mille des Schickjals,
mein Fräulein, und dem Schicksal muß man . . . ." „Gehorchen,"
sagte sie, sah ihn an und scufzte; „mein lserr," fuhr sie fort, „ich
bitte Sie, wir müssen uns hicr trennen." Beide standen an dem
Die Uovelle.
dalbert war nur nach wenige 5chrilte von der Unbekann-
ten entfernt. „So rufe ich euch denn an, ihr Musen,
meine kfelferinnen, steht mir bei," sprach er zu sich, sich selbst
ermntigend. Nach wenigen Schritten befand er sich neben der
zusammenschauernden Dame. 5ie blieb stehen; es war so hell,
um viel ahnen, so dunkel um
nur wenig erkennen zu können;
aber Adalbert fah, daß untcr
dem Schleier ein s)aar glänzende
Augen sxrühten. „bsabeu Sie
diese Rose verloren, mein Fräu-
lein?" fragte er, in demselben
Momente bedenkend, daß diese
xrosaische Frage wenig der er-
höhten Stimmung des Augen-
blicks entsprach, von dem er so
viel hoffte. „Ia mein Lserr,"
lispelte sie, indem sie eine ent-
schiedene Neigung zeigte, sich
dorthin zu wenden, wo Laternen
den Zauber des geheimnisvollen
Dunkels möglichst wenig beein-
trächtigten. „Sie gehen so
einfam," fuhr Adalbert sort
um sich gleich darauf zu sagen,
daß auch diese fragende Fest-
stellung einer unumstößlichen
Thatsache äußerst banal sei.
„Sie scheinen aber die Einsam-
keit zu suchen, mein Fräulein?"
Sie sagte: „Ia, ich meide sie
nicht, wie sie mich nicht meidetl
Aönnen Sie das Lied: verlassen,
verlassen.?" Adalbert
nickte: „und ich schätze die Musik
und ihre Schwester die Dicht-
kunst." „Auch ich thue das,"
sagte sie, ich verehre die wahre
Aunft, die wirklich den Geist
erhebt und keine Spielerei ist.
M ich liebe siel" Adalbert em-
pfand bei diesen Nlorten ein
gewisses Unbehagen; er wußte
selbst nicht, warum. Lr schwieg
einen Augenblick. „Aber darf
ich Ihnen nicht meinen Arm an-
bieten?" begann er dann, „lassen
Sie mich Ihr Ritter sein I" Sie
antwortete nicht; aber er fühlte,
wie ihr Arm, halb duldend, halb
eutgcgenkommend die Berüh-
ruug des seinigen geftattete.
„Wenn Sie verlassen sind, mein
Fräulein, so teilen Sie in ge-
wisser Weise mein Schicksal, man
versteht auch mich nicht; Sie
aber scheinen verftändnis zu
haben, für das was inir heilig
ist. Und wenn zwei Menschen
l dasselbe empfinden, sollten sie
j es nicht auch zusammen einpfin-
den und in solcher Vereinigung neue Anregung und Trost
empfangen? Ach, mein Fräulein ... I" er wollte etwas noch
Geistreicheres sageu, fand aber im Augenblicke nichts. Tr drückte
ihren Arm. „Der Zufall hat uns zusammengeführt, aber giebt
es denn überhaupt Zufall l? Zufall ist der Mille des Schickjals,
mein Fräulein, und dem Schicksal muß man . . . ." „Gehorchen,"
sagte sie, sah ihn an und scufzte; „mein lserr," fuhr sie fort, „ich
bitte Sie, wir müssen uns hicr trennen." Beide standen an dem