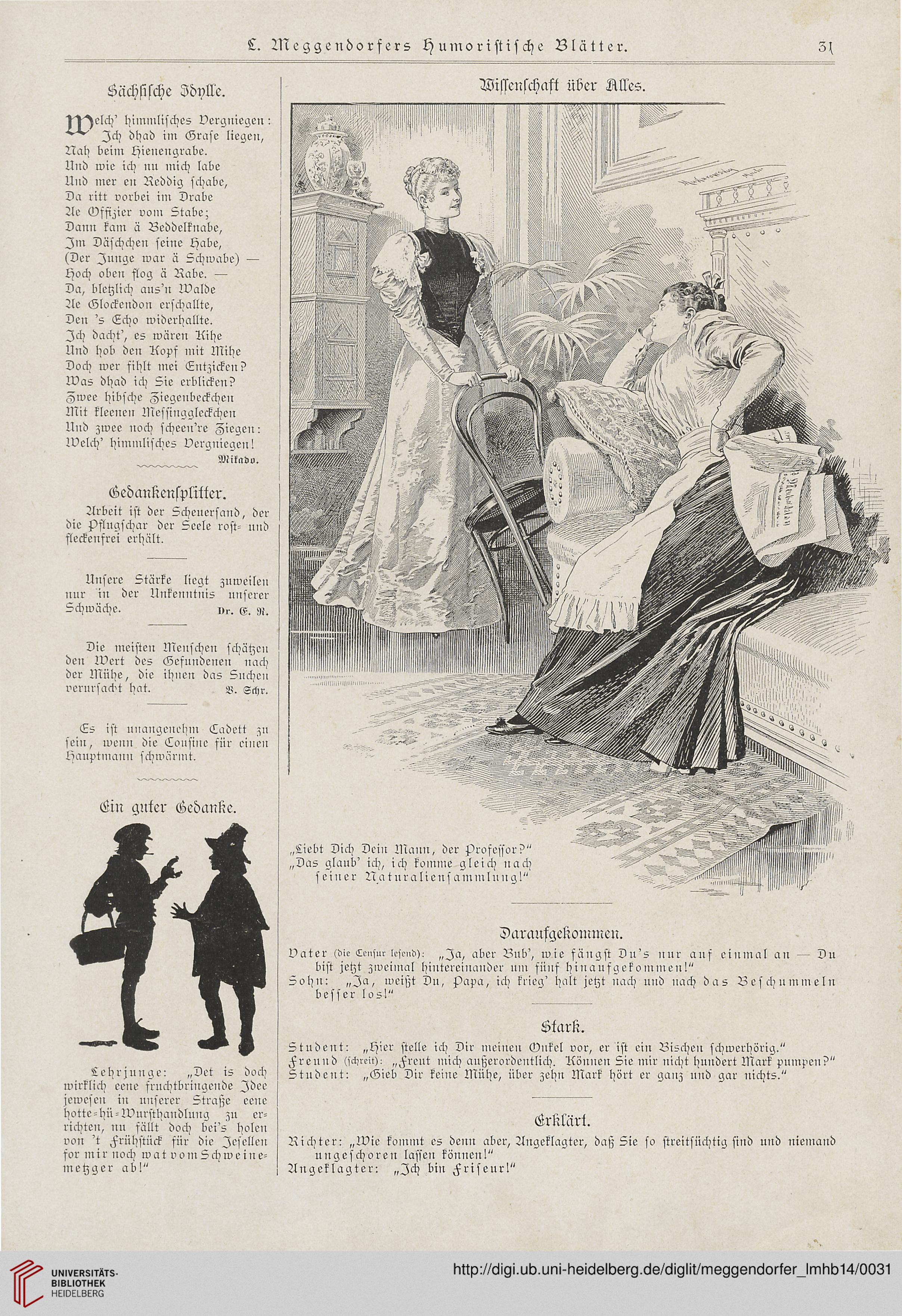L. 217 e g g e nd o rfe rs L) umoristische Blätter.
31
säcMche Idyllc.
1^>elch' hi»>!iilisches verg»icge» :
Ich dhad i»r Grase liege»,
Nah beim lhie»e»grabe.
U»d wie ich »» !»ich labe
U»d »rcr e» Reddig schabo,
Da ritt varbci iin Drabe
Ae Bsfizier vom Stabe;
Dan» kain ä Beddelknabe,
Im Däschchen seine bsabe,
(Der Innge war ä Schwabe) —
bsoch obcn flog ä Rabe. —
Da, blctzlich ans'n Waldo
cle Glockendon erschallte,
Dcn 's Echo widcrhallto.
Ich dacht', es wärcn Aihe
Und hob den Ropf init Ulihe
Doch wer sihlt inci Entfickcn?
U)as dhad ich 5ie crblickon?
Zwec lfibsche Ziegcnbcckcho»
Uut klecnc» Ulessiiigglcckchcn
Und zwce noch scheen're Zicgoni
lUelch' hiininlischcs Oergnicgen!
_ M!kado.
cöedaukenspl'ittcr.
Arbeit ist der Schencrsand, dcr
die Pflugschar dcr 5cele rost- »nd
fleckenfrei eichält.
Unscre Stärkc liegt ziiweilen
nnr in der Unkenntnis nnsercr
Schwächc. E. R.
Die nieiston Ukeiischc» schätzcn
dcn U)crt des Gcfnndenon »ach
dcr Uiiihe, die ihiion das Siiche»
vernrsacbt bat. B. Zchr.
Gs ist niiangoilichiii Ladctt z»
sei», weii» die Gonsiiic fiir eiiie»
Uauptiiia»» schwärmt.
Äiu gnter (Kedaulle.
Lebrjunge: „Det is doch
wirklich cene frlichtbringendo Ideo
jewcse» in nnserer Straße cene
hotte-lfil-wiirstbandlnng zn er-
richten, »n sällt doch bei's hole»
von 't Friibstiick fiir die Iesellen
for ini r »och watv o »i S ch wein e-
metzger ab!"
Daraufgekoimucu.
Uatcr <dic Lcnsur lcscnd), „Za, aber Bnb', lvie fängst Dn's »nr ailf cinmal a» — Dn
bist jetzt zweimal biiitereinandcr nm siinf binaiifgckommen!"
Sob»: weißt D», Papa, ich krieg' Ipilt jetzt nach und nach das Beschnmmeln
besser losl"
stark.
Student: „bjicr stelle ich Dir meincn Gnkel vor, er ist ein Bischo» schwcrbörig."
Freund (schrcit)i „Frent mich anßerordentlich. Uönneii Sie mir »icht bnndert Ulark pilmpcn?"
Stiident: „Gieb Dir koine Uliibe, iiber zcbn Ulark hört er ganz nnd gar nichts."
Ärklärt.
Richter: „U)ie kommt cs dcnn abcr, Angcklagter, daß Sio so streitsnchtig sind »nd niemand
ungeschoron lassen könnenl"
Angeklagter: „Jch bi» Frisenrl"
31
säcMche Idyllc.
1^>elch' hi»>!iilisches verg»icge» :
Ich dhad i»r Grase liege»,
Nah beim lhie»e»grabe.
U»d wie ich »» !»ich labe
U»d »rcr e» Reddig schabo,
Da ritt varbci iin Drabe
Ae Bsfizier vom Stabe;
Dan» kain ä Beddelknabe,
Im Däschchen seine bsabe,
(Der Innge war ä Schwabe) —
bsoch obcn flog ä Rabe. —
Da, blctzlich ans'n Waldo
cle Glockendon erschallte,
Dcn 's Echo widcrhallto.
Ich dacht', es wärcn Aihe
Und hob den Ropf init Ulihe
Doch wer sihlt inci Entfickcn?
U)as dhad ich 5ie crblickon?
Zwec lfibsche Ziegcnbcckcho»
Uut klecnc» Ulessiiigglcckchcn
Und zwce noch scheen're Zicgoni
lUelch' hiininlischcs Oergnicgen!
_ M!kado.
cöedaukenspl'ittcr.
Arbeit ist der Schencrsand, dcr
die Pflugschar dcr 5cele rost- »nd
fleckenfrei eichält.
Unscre Stärkc liegt ziiweilen
nnr in der Unkenntnis nnsercr
Schwächc. E. R.
Die nieiston Ukeiischc» schätzcn
dcn U)crt des Gcfnndenon »ach
dcr Uiiihe, die ihiion das Siiche»
vernrsacbt bat. B. Zchr.
Gs ist niiangoilichiii Ladctt z»
sei», weii» die Gonsiiic fiir eiiie»
Uauptiiia»» schwärmt.
Äiu gnter (Kedaulle.
Lebrjunge: „Det is doch
wirklich cene frlichtbringendo Ideo
jewcse» in nnserer Straße cene
hotte-lfil-wiirstbandlnng zn er-
richten, »n sällt doch bei's hole»
von 't Friibstiick fiir die Iesellen
for ini r »och watv o »i S ch wein e-
metzger ab!"
Daraufgekoimucu.
Uatcr <dic Lcnsur lcscnd), „Za, aber Bnb', lvie fängst Dn's »nr ailf cinmal a» — Dn
bist jetzt zweimal biiitereinandcr nm siinf binaiifgckommen!"
Sob»: weißt D», Papa, ich krieg' Ipilt jetzt nach und nach das Beschnmmeln
besser losl"
stark.
Student: „bjicr stelle ich Dir meincn Gnkel vor, er ist ein Bischo» schwcrbörig."
Freund (schrcit)i „Frent mich anßerordentlich. Uönneii Sie mir »icht bnndert Ulark pilmpcn?"
Stiident: „Gieb Dir koine Uliibe, iiber zcbn Ulark hört er ganz nnd gar nichts."
Ärklärt.
Richter: „U)ie kommt cs dcnn abcr, Angcklagter, daß Sio so streitsnchtig sind »nd niemand
ungeschoron lassen könnenl"
Angeklagter: „Jch bi» Frisenrl"