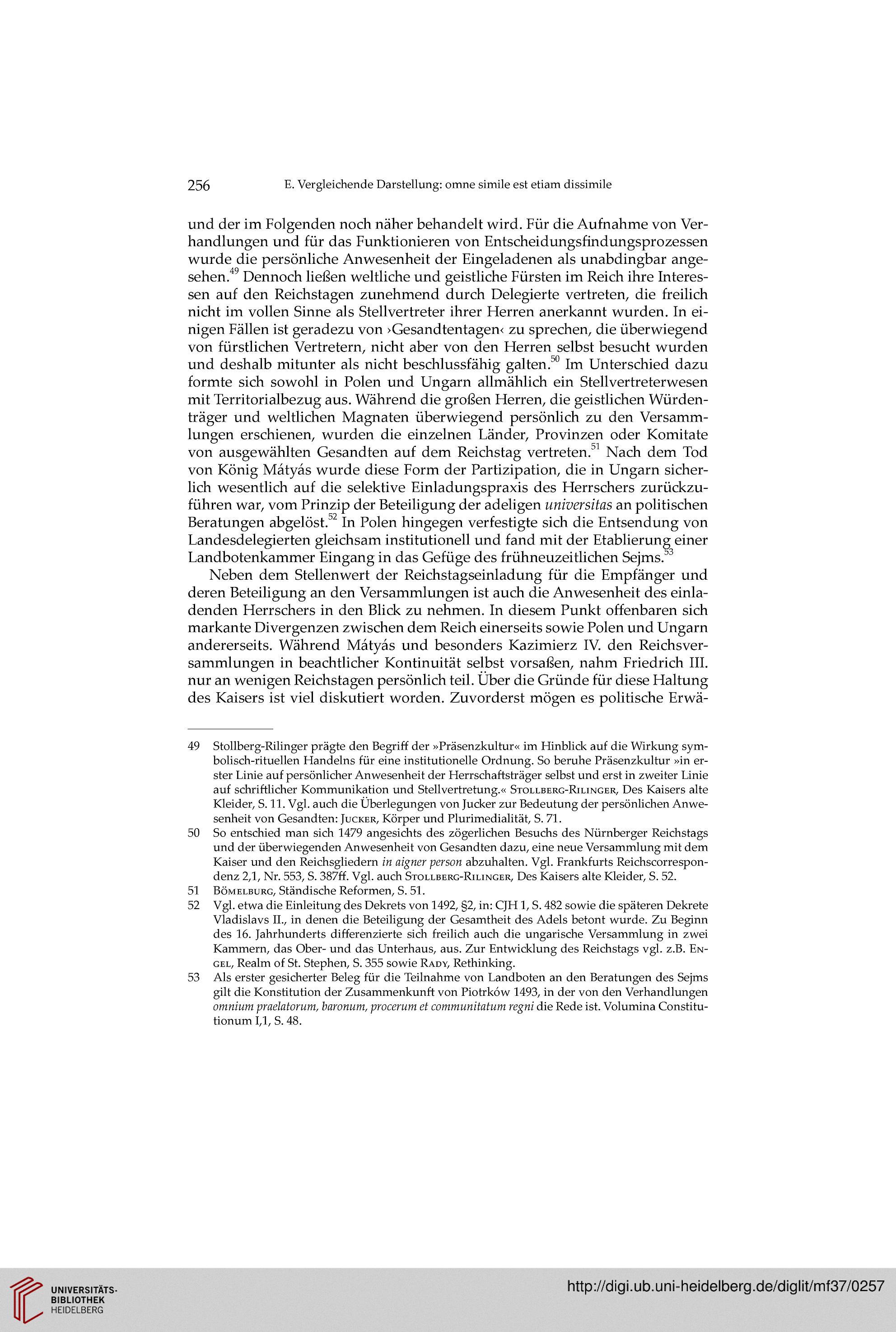256
E. Vergleichende Darstellung: omne simile est etiam dissimile
und der im Folgenden noch näher behandelt wird. Für die Aufnahme von Ver-
handlungen und für das Funktionieren von Entscheidungsfindungsprozessen
wurde die persönliche Anwesenheit der Eingeladenen als unabdingbar ange-
sehen.^ Dennoch ließen weltliche und geistliche Fürsten im Reich ihre Interes-
sen auf den Reichstagen zunehmend durch Delegierte vertreten, die freilich
nicht im vollen Sinne als Stellvertreter ihrer Herren anerkannt wurden. In ei-
nigen Fällen ist geradezu von >Gesandtentagen< zu sprechen, die überwiegend
von fürstlichen Vertretern, nicht aber von den Herren selbst besucht wurden
und deshalb mitunter als nicht beschlussfähig gatten/" Im Unterschied dazu
formte sich sowohl in Polen und Ungarn allmählich ein Stellvertreterwesen
mit Territorialbezug aus. Während die großen Herren, die geistlichen Würden-
träger und weltlichen Magnaten überwiegend persönlich zu den Versamm-
lungen erschienen, wurden die einzelnen Länder, Provinzen oder Komitate
von ausgewählten Gesandten auf dem Reichstag vertreten.^ Nach dem Tod
von König Mätyäs wurde diese Form der Partizipation, die in Ungarn sicher-
lich wesentlich auf die selektive Einladungspraxis des Herrschers zurückzu-
führen war, vom Prinzip der Beteiligung der adeligen Mtiztvrszhis an politischen
Beratungen abgeiöst. " In Polen hingegen verfestigte sich die Entsendung von
Landesdelegierten gleichsam institutionell und fand mit der Etablierung einer
Landbotenkammer Eingang in das Gefüge des frühneuzeitlichen Sejms.
Neben dem Stellenwert der Reichstagseinladung für die Empfänger und
deren Beteiligung an den Versammlungen ist auch die Anwesenheit des einla-
denden Herrschers in den Blick zu nehmen. In diesem Punkt offenbaren sich
markante Divergenzen zwischen dem Reich einerseits sowie Polen und Ungarn
andererseits. Während Mätyäs und besonders Kazimierz IV. den Reichsver-
sammlungen in beachtlicher Kontinuität selbst vorsaßen, nahm Friedrich III.
nur an wenigen Reichstagen persönlich teil. Uber die Gründe für diese Haltung
des Kaisers ist viel diskutiert worden. Zuvorderst mögen es politische Erwä-
49 Stollberg-Rilinger prägte den Begriff der »Präsenzkultur« im Hinblick auf die Wirkung sym-
bolisch-rituellen Handelns für eine institutioneile Ordnung. So beruhe Präsenzkultur »in er-
ster Linie auf persönlicher Anwesenheit der Herrschaftsträger selbst und erst in zweiter Linie
auf schriftlicher Kommunikation und Stellvertretung.« STOLLBERG-RiLiNGER, Des Kaisers alte
Kleider, S. 11. Vgl. auch die Überlegungen von Jucker zur Bedeutung der persönlichen Anwe-
senheit von Gesandten: JucKER, Körper und Plurimedialität, S. 71.
50 So entschied man sich 1479 angesichts des zögerlichen Besuchs des Nürnberger Reichstags
und der überwiegenden Anwesenheit von Gesandten dazu, eine neue Versammlung mit dem
Kaiser und den Reichsgliedern ü; Ny wer persoM abzuhalten. Vgl. Lrankfurts Reichscorrespon-
denz 2,1, Nr. 553, S. 387ff. Vgl. auch STOLLBERG-RiLiNGER, Des Kaisers alte Kleider, S. 52.
51 BÖMELBURG, Ständische Reformen, S. 51.
52 Vgl. etwa die Einleitung des Dekrets von 1492, §2, in: CJH1, S. 482 sowie die späteren Dekrete
Vladislavs II., in denen die Beteiligung der Gesamtheit des Adels betont wurde. Zu Beginn
des 16. Jahrhunderts differenzierte sich freilich auch die ungarische Versammlung in zwei
Kammern, das Ober- und das Unterhaus, aus. Zur Entwicklung des Reichstags vgl. z.B. EN-
GEL, Realm of St. Stephen, S. 355 sowie RADY, Rethinking.
53 Als erster gesicherter Beleg für die Teilnahme von Landboten an den Beratungen des Sejms
gilt die Konstitution der Zusammenkunft von Piotrköw 1493, in der von den Verhandlungen
owiNt;m praetatorMW, ZwroMMW, procerMW et cowwMMÜatMW reym die Rede ist. Volumina Constitu-
tionum 1,1, S. 48.
E. Vergleichende Darstellung: omne simile est etiam dissimile
und der im Folgenden noch näher behandelt wird. Für die Aufnahme von Ver-
handlungen und für das Funktionieren von Entscheidungsfindungsprozessen
wurde die persönliche Anwesenheit der Eingeladenen als unabdingbar ange-
sehen.^ Dennoch ließen weltliche und geistliche Fürsten im Reich ihre Interes-
sen auf den Reichstagen zunehmend durch Delegierte vertreten, die freilich
nicht im vollen Sinne als Stellvertreter ihrer Herren anerkannt wurden. In ei-
nigen Fällen ist geradezu von >Gesandtentagen< zu sprechen, die überwiegend
von fürstlichen Vertretern, nicht aber von den Herren selbst besucht wurden
und deshalb mitunter als nicht beschlussfähig gatten/" Im Unterschied dazu
formte sich sowohl in Polen und Ungarn allmählich ein Stellvertreterwesen
mit Territorialbezug aus. Während die großen Herren, die geistlichen Würden-
träger und weltlichen Magnaten überwiegend persönlich zu den Versamm-
lungen erschienen, wurden die einzelnen Länder, Provinzen oder Komitate
von ausgewählten Gesandten auf dem Reichstag vertreten.^ Nach dem Tod
von König Mätyäs wurde diese Form der Partizipation, die in Ungarn sicher-
lich wesentlich auf die selektive Einladungspraxis des Herrschers zurückzu-
führen war, vom Prinzip der Beteiligung der adeligen Mtiztvrszhis an politischen
Beratungen abgeiöst. " In Polen hingegen verfestigte sich die Entsendung von
Landesdelegierten gleichsam institutionell und fand mit der Etablierung einer
Landbotenkammer Eingang in das Gefüge des frühneuzeitlichen Sejms.
Neben dem Stellenwert der Reichstagseinladung für die Empfänger und
deren Beteiligung an den Versammlungen ist auch die Anwesenheit des einla-
denden Herrschers in den Blick zu nehmen. In diesem Punkt offenbaren sich
markante Divergenzen zwischen dem Reich einerseits sowie Polen und Ungarn
andererseits. Während Mätyäs und besonders Kazimierz IV. den Reichsver-
sammlungen in beachtlicher Kontinuität selbst vorsaßen, nahm Friedrich III.
nur an wenigen Reichstagen persönlich teil. Uber die Gründe für diese Haltung
des Kaisers ist viel diskutiert worden. Zuvorderst mögen es politische Erwä-
49 Stollberg-Rilinger prägte den Begriff der »Präsenzkultur« im Hinblick auf die Wirkung sym-
bolisch-rituellen Handelns für eine institutioneile Ordnung. So beruhe Präsenzkultur »in er-
ster Linie auf persönlicher Anwesenheit der Herrschaftsträger selbst und erst in zweiter Linie
auf schriftlicher Kommunikation und Stellvertretung.« STOLLBERG-RiLiNGER, Des Kaisers alte
Kleider, S. 11. Vgl. auch die Überlegungen von Jucker zur Bedeutung der persönlichen Anwe-
senheit von Gesandten: JucKER, Körper und Plurimedialität, S. 71.
50 So entschied man sich 1479 angesichts des zögerlichen Besuchs des Nürnberger Reichstags
und der überwiegenden Anwesenheit von Gesandten dazu, eine neue Versammlung mit dem
Kaiser und den Reichsgliedern ü; Ny wer persoM abzuhalten. Vgl. Lrankfurts Reichscorrespon-
denz 2,1, Nr. 553, S. 387ff. Vgl. auch STOLLBERG-RiLiNGER, Des Kaisers alte Kleider, S. 52.
51 BÖMELBURG, Ständische Reformen, S. 51.
52 Vgl. etwa die Einleitung des Dekrets von 1492, §2, in: CJH1, S. 482 sowie die späteren Dekrete
Vladislavs II., in denen die Beteiligung der Gesamtheit des Adels betont wurde. Zu Beginn
des 16. Jahrhunderts differenzierte sich freilich auch die ungarische Versammlung in zwei
Kammern, das Ober- und das Unterhaus, aus. Zur Entwicklung des Reichstags vgl. z.B. EN-
GEL, Realm of St. Stephen, S. 355 sowie RADY, Rethinking.
53 Als erster gesicherter Beleg für die Teilnahme von Landboten an den Beratungen des Sejms
gilt die Konstitution der Zusammenkunft von Piotrköw 1493, in der von den Verhandlungen
owiNt;m praetatorMW, ZwroMMW, procerMW et cowwMMÜatMW reym die Rede ist. Volumina Constitu-
tionum 1,1, S. 48.