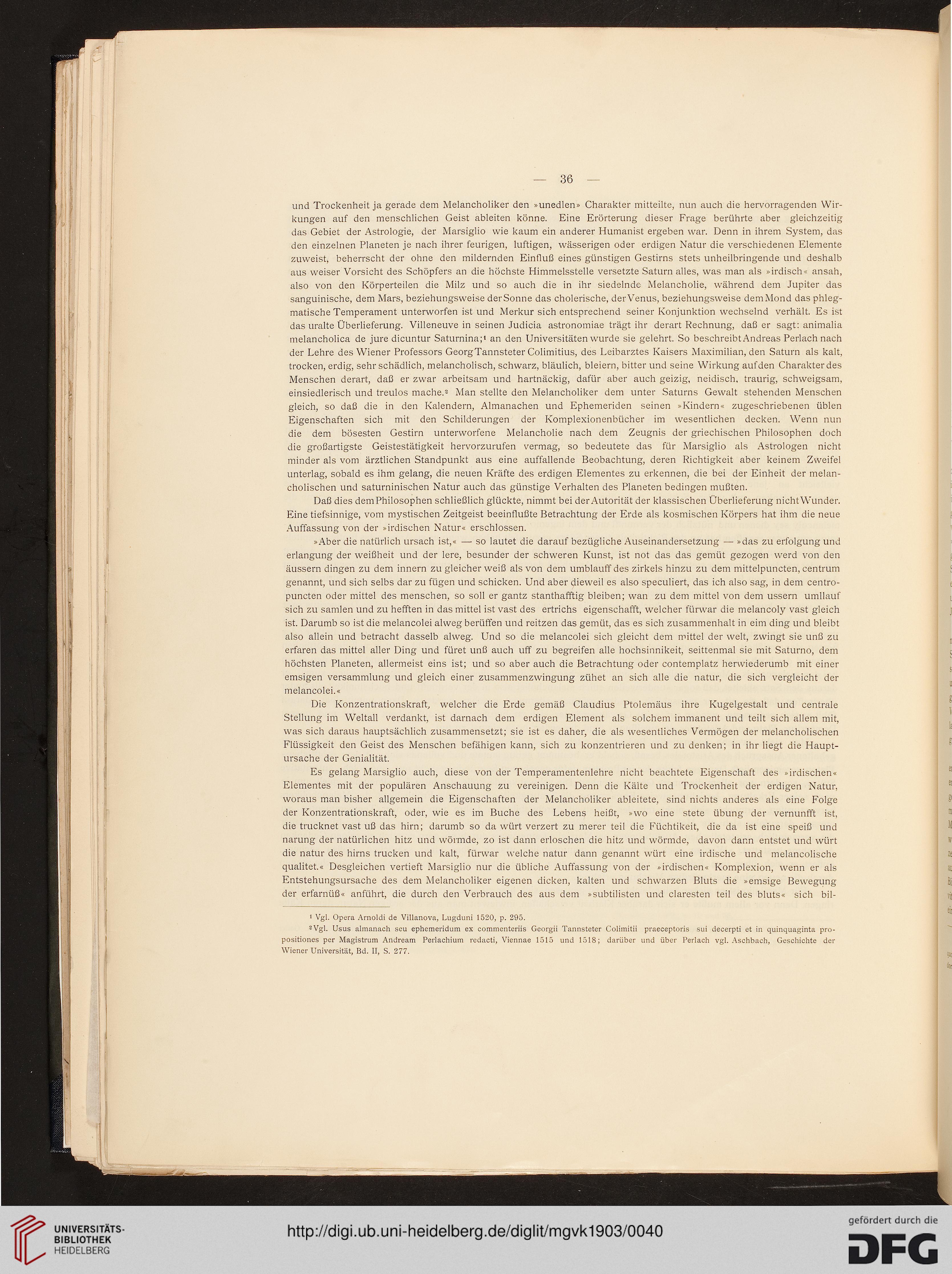36
und Trockenheit ja gerade dem Melancholiker den »unedlen» Charakter mitteilte, nun auch die hervorragenden Wir-
kungen auf den menschlichen Geist ableiten könne. Eine Erörterung dieser Frage berührte aber gleichzeitig
das Gebiet der Astrologie, der Marsiglio wie kaum ein anderer Humanist ergeben war. Denn in ihrem System, das
den einzelnen Planeten je nach ihrer feurigen, luftigen, wässerigen oder erdigen Natur die verschiedenen Elemente
zuweist, beherrscht der ohne den mildernden Einfluß eines günstigen Gestirns stets unheilbringende und deshalb
aus weiser Vorsicht des Schöpfers an die höchste Himmelsstelle versetzte Saturn alles, was man als »irdisch« ansah,
also von den Körperteilen die Milz und so auch die in ihr siedelnde Melancholie, während dem Jupiter das
sanguinische, dem Mars, beziehungsweise der Sonne das cholerische, der Venus, beziehungsweise demMond das phleg-
matische Temperament unterworfen ist und Merkur sich entsprechend seiner Konjunktion wechselnd verhält. Es ist
das uralte Überlieferung. Villeneuve in seinen Judicia astronomiae trägt ihr derart Rechnung, daß er sagt: animalia
melancholica de jure dicuntur Saturnina;1 an den Universitäten wurde sie gelehrt. So beschreibt Andreas Perlach nach
der Lehre des Wiener Professors Georg Tannsteter Colimitius, des Leibarztes Kaisers Maximilian, den Saturn als kalt,
trocken, erdig, sehr schädlich, melancholisch, schwarz, bläulich, bleiern, bitter und seine Wirkung auf den Charakter des
Menschen derart, daß er zwar arbeitsam und hartnäckig, dafür aber auch geizig, neidisch, traurig, schweigsam,
einsiedlerisch und treulos mache.2 Man stellte den Melancholiker dem unter Saturns Gewalt stehenden Menschen
gleich, so daß die in den Kalendern, Almanachen und Ephemeriden seinen »Kindern« zugeschriebenen üblen
Eigenschaften sich mit den Schilderungen der Komplexionenbücher im wesentlichen decken. Wenn nun
die dem bösesten Gestirn unterworfene Melancholie nach dem Zeugnis der griechischen Philosophen doch
die großartigste Geistestätigkeit hervorzurufen vermag, so bedeutete das für Marsiglio als Astrologen nicht
minder als vom ärztlichen Standpunkt aus eine auffallende Beobachtung, deren Richtigkeit aber keinem Zweifel
unterlag, sobald es ihm gelang, die neuen Kräfte des erdigen Elementes zu erkennen, die bei der Einheit der melan-
cholischen und saturninischen Natur auch das günstige Verhalten des Planeten bedingen mußten.
Daß dies demPhilosophen schließlich glückte, nimmt bei der Autorität der klassischen Überlieferung nichtWunder.
Eine tiefsinnige, vom mystischen Zeitgeist beeinflußte Betrachtung der Erde als kosmischen Körpers hat ihm die neue
Ausfassung von der »irdischen Natur« erschlossen.
»Aber die natürlich ursach ist,« — so lautet die darauf bezügliche Auseinandersetzung — »das zu erfolgung und
erlangung der weißheit und der lere, besunder der schweren Kunst, ist not das das gemüt gezogen werd von den
äussern dingen zu dem innern zu gleicher weiß als von dem umblauff des Zirkels hinzu zu dem mittelpuncten, centrum
genannt, und sich selbs dar zu fügen und schicken. Und aber dieweil es also speculiert, das ich also sag, in dem centro-
puncten oder mittel des menschen, so soll er gantz stanthafftig bleiben; wan zu dem mittel von dem ussern umllauf
sich zu samlen und zu hefften in das mittel ist vast des ertrichs eigenschafst, welcher fürwar die melancoly vast gleich
ist. Darumb so ist die melancolei alweg berüffen und reitzen das gemüt, das es sich zusammenhält in eim ding und bleibt
also allein und betracht dasselb alweg. Und so die melancolei sich gleicht dem mittel der weit, zwingt sie unß zu
erfaren das mittel aller Ding und füret unß auch uff zu begreifen alle hochsinnikeit, seittenmal sie mit Saturno, dem
höchsten Planeten, allermeist eins ist; und so aber auch die Betrachtung oder contemplatz herwiederumb mit einer
emsigen Versammlung und gleich einer zusammenzwingung zühet an sich alle die natur, die sich vergleicht der
melancolei.«
Die Konzentrationskraft, welcher die Erde gemäß Claudius Ptolemäus ihre Kugelgestalt und centrale
Stellung im Weltall verdankt, ist darnach dem erdigen Element als solchem immanent und teilt sich allem mit,
was sich daraus hauptsächlich zusammensetzt; sie ist es daher, die als wesentliches Vermögen der melancholischen
Flüssigkeit den Geist des Menschen befähigen kann, sich zu konzentrieren und zu denken; in ihr liegt die Haupt-
ursache der Genialität.
Es gelang Marsiglio auch, diese von der Temperamentenlehre nicht beachtete Eigenschaft des »irdischen«
Elementes mit der populären Anschauung zu vereinigen. Denn die Kälte und Trockenheit der erdigen Natur,
woraus man bisher allgemein die Eigenschaften der Melancholiker ableitete, sind nichts anderes als eine Folge
der Konzentrationskraft, oder, wie es im Buche des Lebens heißt, »wo eine stete Übung der vernunfft ist,
die trucknet vast uß das hirn; darumb so da würt verzert zu merer teil die Füchtikeit, die da ist eine speiß und
narung der natürlichen hitz und wörmde, zo ist dann erloschen die hitz und wörmde, davon dann entstet und würt
die natur des hirns trucken und kalt, fürwar welche natur dann genannt würt eine irdische und melancolische
qualitet.« Desgleichen vertieft Marsiglio nur die übliche Auffassung von der »irdischen« Komplexion, wenn er als
Entstehungsursache des dem Melancholiker eigenen dicken, kalten und schwarzen Bluts die »emsige Bewegung
der erfarnüß« anführt, die durch den Verbrauch des aus dem »subtilisten und claresten teil des bluts« sich bil-
1 Vgl. Opera Arnoldi de Villanova, Lugduni 1520, p. 295.
2Vgl. Usus almanach seu ephemeridum ex commenteriis Georgii Tannsteter Colimitii praeceptoris sui decerpti et in quinquaginta pro-
positiones per Magistrum Andream Perlachium redacti, Viennae 1515 und 1518; darüber und über Perlach vgl. Aschbach, Geschichte der
Wiener Universität, Bd. II, S. 277.
und Trockenheit ja gerade dem Melancholiker den »unedlen» Charakter mitteilte, nun auch die hervorragenden Wir-
kungen auf den menschlichen Geist ableiten könne. Eine Erörterung dieser Frage berührte aber gleichzeitig
das Gebiet der Astrologie, der Marsiglio wie kaum ein anderer Humanist ergeben war. Denn in ihrem System, das
den einzelnen Planeten je nach ihrer feurigen, luftigen, wässerigen oder erdigen Natur die verschiedenen Elemente
zuweist, beherrscht der ohne den mildernden Einfluß eines günstigen Gestirns stets unheilbringende und deshalb
aus weiser Vorsicht des Schöpfers an die höchste Himmelsstelle versetzte Saturn alles, was man als »irdisch« ansah,
also von den Körperteilen die Milz und so auch die in ihr siedelnde Melancholie, während dem Jupiter das
sanguinische, dem Mars, beziehungsweise der Sonne das cholerische, der Venus, beziehungsweise demMond das phleg-
matische Temperament unterworfen ist und Merkur sich entsprechend seiner Konjunktion wechselnd verhält. Es ist
das uralte Überlieferung. Villeneuve in seinen Judicia astronomiae trägt ihr derart Rechnung, daß er sagt: animalia
melancholica de jure dicuntur Saturnina;1 an den Universitäten wurde sie gelehrt. So beschreibt Andreas Perlach nach
der Lehre des Wiener Professors Georg Tannsteter Colimitius, des Leibarztes Kaisers Maximilian, den Saturn als kalt,
trocken, erdig, sehr schädlich, melancholisch, schwarz, bläulich, bleiern, bitter und seine Wirkung auf den Charakter des
Menschen derart, daß er zwar arbeitsam und hartnäckig, dafür aber auch geizig, neidisch, traurig, schweigsam,
einsiedlerisch und treulos mache.2 Man stellte den Melancholiker dem unter Saturns Gewalt stehenden Menschen
gleich, so daß die in den Kalendern, Almanachen und Ephemeriden seinen »Kindern« zugeschriebenen üblen
Eigenschaften sich mit den Schilderungen der Komplexionenbücher im wesentlichen decken. Wenn nun
die dem bösesten Gestirn unterworfene Melancholie nach dem Zeugnis der griechischen Philosophen doch
die großartigste Geistestätigkeit hervorzurufen vermag, so bedeutete das für Marsiglio als Astrologen nicht
minder als vom ärztlichen Standpunkt aus eine auffallende Beobachtung, deren Richtigkeit aber keinem Zweifel
unterlag, sobald es ihm gelang, die neuen Kräfte des erdigen Elementes zu erkennen, die bei der Einheit der melan-
cholischen und saturninischen Natur auch das günstige Verhalten des Planeten bedingen mußten.
Daß dies demPhilosophen schließlich glückte, nimmt bei der Autorität der klassischen Überlieferung nichtWunder.
Eine tiefsinnige, vom mystischen Zeitgeist beeinflußte Betrachtung der Erde als kosmischen Körpers hat ihm die neue
Ausfassung von der »irdischen Natur« erschlossen.
»Aber die natürlich ursach ist,« — so lautet die darauf bezügliche Auseinandersetzung — »das zu erfolgung und
erlangung der weißheit und der lere, besunder der schweren Kunst, ist not das das gemüt gezogen werd von den
äussern dingen zu dem innern zu gleicher weiß als von dem umblauff des Zirkels hinzu zu dem mittelpuncten, centrum
genannt, und sich selbs dar zu fügen und schicken. Und aber dieweil es also speculiert, das ich also sag, in dem centro-
puncten oder mittel des menschen, so soll er gantz stanthafftig bleiben; wan zu dem mittel von dem ussern umllauf
sich zu samlen und zu hefften in das mittel ist vast des ertrichs eigenschafst, welcher fürwar die melancoly vast gleich
ist. Darumb so ist die melancolei alweg berüffen und reitzen das gemüt, das es sich zusammenhält in eim ding und bleibt
also allein und betracht dasselb alweg. Und so die melancolei sich gleicht dem mittel der weit, zwingt sie unß zu
erfaren das mittel aller Ding und füret unß auch uff zu begreifen alle hochsinnikeit, seittenmal sie mit Saturno, dem
höchsten Planeten, allermeist eins ist; und so aber auch die Betrachtung oder contemplatz herwiederumb mit einer
emsigen Versammlung und gleich einer zusammenzwingung zühet an sich alle die natur, die sich vergleicht der
melancolei.«
Die Konzentrationskraft, welcher die Erde gemäß Claudius Ptolemäus ihre Kugelgestalt und centrale
Stellung im Weltall verdankt, ist darnach dem erdigen Element als solchem immanent und teilt sich allem mit,
was sich daraus hauptsächlich zusammensetzt; sie ist es daher, die als wesentliches Vermögen der melancholischen
Flüssigkeit den Geist des Menschen befähigen kann, sich zu konzentrieren und zu denken; in ihr liegt die Haupt-
ursache der Genialität.
Es gelang Marsiglio auch, diese von der Temperamentenlehre nicht beachtete Eigenschaft des »irdischen«
Elementes mit der populären Anschauung zu vereinigen. Denn die Kälte und Trockenheit der erdigen Natur,
woraus man bisher allgemein die Eigenschaften der Melancholiker ableitete, sind nichts anderes als eine Folge
der Konzentrationskraft, oder, wie es im Buche des Lebens heißt, »wo eine stete Übung der vernunfft ist,
die trucknet vast uß das hirn; darumb so da würt verzert zu merer teil die Füchtikeit, die da ist eine speiß und
narung der natürlichen hitz und wörmde, zo ist dann erloschen die hitz und wörmde, davon dann entstet und würt
die natur des hirns trucken und kalt, fürwar welche natur dann genannt würt eine irdische und melancolische
qualitet.« Desgleichen vertieft Marsiglio nur die übliche Auffassung von der »irdischen« Komplexion, wenn er als
Entstehungsursache des dem Melancholiker eigenen dicken, kalten und schwarzen Bluts die »emsige Bewegung
der erfarnüß« anführt, die durch den Verbrauch des aus dem »subtilisten und claresten teil des bluts« sich bil-
1 Vgl. Opera Arnoldi de Villanova, Lugduni 1520, p. 295.
2Vgl. Usus almanach seu ephemeridum ex commenteriis Georgii Tannsteter Colimitii praeceptoris sui decerpti et in quinquaginta pro-
positiones per Magistrum Andream Perlachium redacti, Viennae 1515 und 1518; darüber und über Perlach vgl. Aschbach, Geschichte der
Wiener Universität, Bd. II, S. 277.