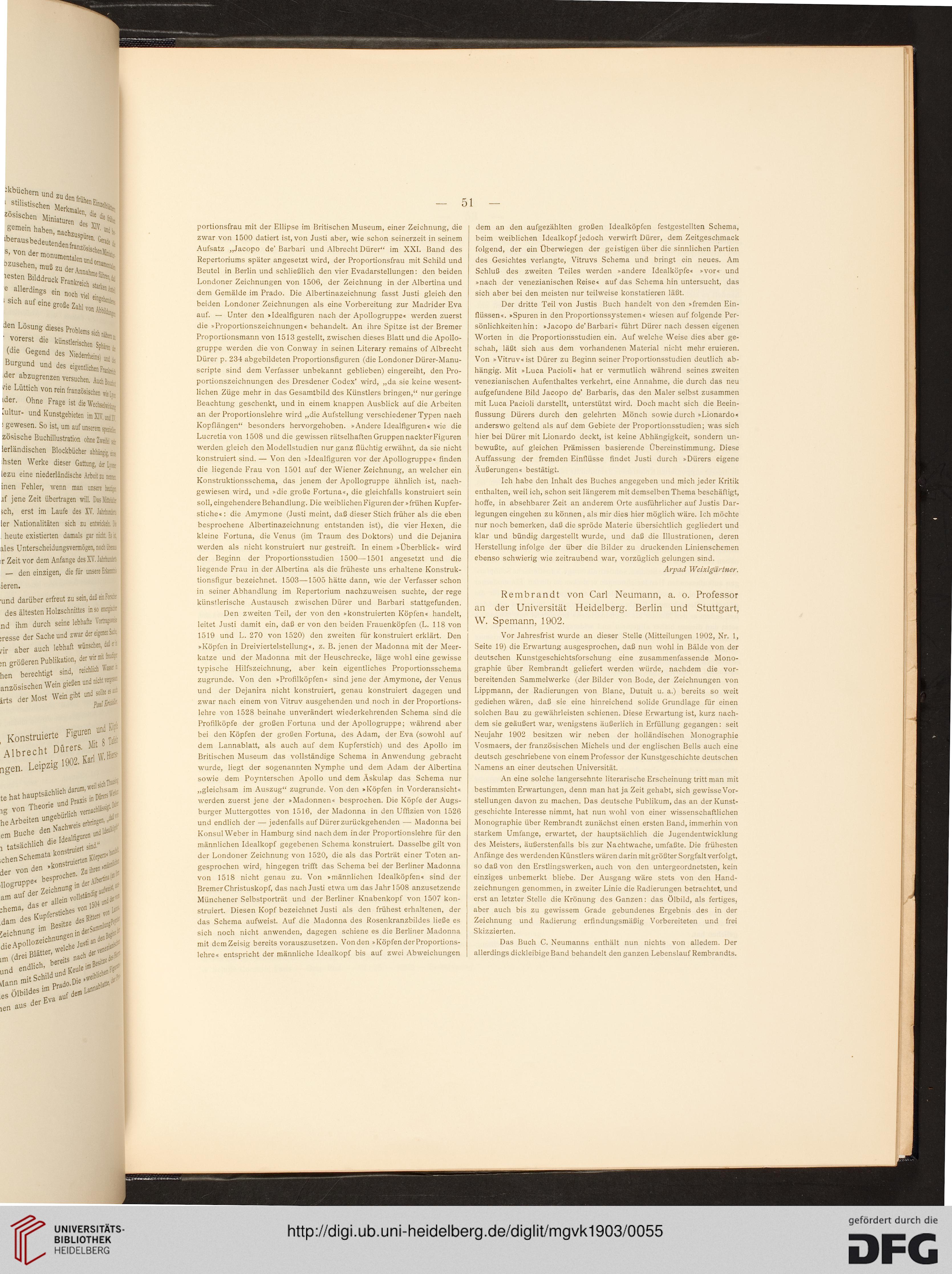portionssrau mit der Ellipse im Britischen Museum, einer Zeichnung, die
zwar von 1500 datiert ist, von Justi aber, wie schon seinerzeit in seinem
Aufsatz „Jacopo de' Barbari und Albrecht Dürer" im XXI. Band des
Repertoriums später angesetzt wird, der Proportionssrau mit Schild und
Beutel in Berlin und schließlich den vier Evadarstellungen: den beiden
Londoner Zeichnungen von 1506, der Zeichnung in der Albertina und
dem Gemälde im Prado. Die Albertinazeichnung fasst Justi gleich den
beiden Londoner Zeichnungen als eine Vorbereitung zur Madrider Eva
auf. — Unter den > Idealfiguren nach der Apollogruppe« werden zuerst
die »Proportionszeichnungen« behandelt. An ihre Spitze ist der Bremer
Proportionsmann von 1513 gestellt, zwischen dieses Blatt und die Apollo-
gruppe werden die von Conway in seinen Literary remains os Albrecht
Dürer p. 234 abgebildeten Proportionsfiguren (die Londoner Dürer-Manu-
scripte sind dem Versasser unbekannt geblieben) eingereiht, den Pro-
portionszeichnungen des Dresdener Codex' wird, „da sie keine wesent-
lichen Züge mehr in das Gesamtbild des Künstlers bringen," nur geringe
Beachtung geschenkt, und in einem knappen Ausblick auf die Arbeiten
an der Proportionslehre wird „die Ausstellung verschiedener Typen nach
Kopslängen" besonders hervorgehoben. »Andere Idealfiguren« wie die
Lucretia von 1508 und die gewissen rätselhasten GruppennackterFiguren
werden gleich den Modellstudien nur ganz slüchtig erwähnt, da sie nicht
konstruiert sind. — Von den »Idealfiguren vor der Apollogruppe« finden
die liegende Frau von 1501 auf der Wiener Zeichnung, an welcher ein
Konstruktionsschema, das jenem der Apollogruppe ähnlich ist, nach-
gewiesen wird, und »die große Fortuna«, die gleichfalls konstruiert sein
soll, eingehendere Behandlung. Die weiblichen Figuren der »frühen Kupfer-
stiche«: die Amymone (Justi meint, daß dieser Stich srüher als die eben
besprochene Albertinazeichnung entstanden ist), die vier Hexen, die
kleine Fortuna, die Venus (im Traum des Doktors) und die Dejanira
werden als nicht konstruiert nur gestreift. In einem »Überblick« wird
der Beginn der Proportionsstudien 1500—1501 angesetzt und die
liegende Frau in der Albertina als die srüheste uns erhaltene Konstruk-
tionsfigur bezeichnet. 1503—1505 hätte dann, wie der Verfasser schon
in seiner Abhandlung im Repertorium nachzuweisen suchte, der rege
künstlerische Austausch zwischen Dürer und Barbari stattgesunden.
Den zweiten Teil, der von den »konstruierten Köpsen« handelt,
leitet Justi damit ein, daß er von den beiden Frauenköpfen (L. 118 von
1519 und L. 270 von 1520) den zweiten sür konstruiert erklärt. Den
»Köpsen in Dreiviertelstellung«, z. B. jenen der Madonna mit der Meer-
katze und der Madonna mit der Heuschrecke, läge wohl eine gewisse
typische Hilsszeichnung, aber kein eigentliches Proportionsschema
zugrunde. Von den »Profilköpsen« sind jene der Amymone, der Venus
und der Dejanira nicht konstruiert, genau konstruiert dagegen und
zwar nach einem von Vitruv ausgehenden und noch in der Proportions-
lehre von 1528 beinahe unverändert wiederkehrenden Schema sind die
Profilköpse der großen Fortuna und der Apollogruppe; während aber
bei den Köpsen der großen Fortuna, des Adam, der Eva (sowohl auf
dem Lannablatt, als auch aus dem Kupserstich) und des Apollo im
Britischen Museum das vollständige Schema in Anwendung gebracht
wurde, liegt der sogenannten Nymphe und dem Adam der Albertina
sowie dem Poynterschen Apollo und dem Äskulap das Schema nur
„gleichsam im Auszug" zugrunde. Von den »Köpsen in Vorderansicht«
werden zuerst jene der »Madonnen« besprochen. Die Köpse der Augs-
burger Muttergottes von 1516, der Madonna in den Usfizien von 1526
und endlich der — jedensalls aus Dürer zurückgehenden — Madonna bei
Konsul Weber in Hamburg sind nachdem in der Proportionslehre für den
männlichen Idealkops gegebenen Schema konstruiert. Dasselbe gilt von
der Londoner Zeichnung von 1520, die als das Porträt einer Toten an-
gesprochen wird, hingegen trisst das Schema bei der Berliner Madonna
von 1518 nicht genau zu. Von »männlichen Idealköpsen« sind der
BremerChristuskopf, das nach Justi etwa um das Jahr 1508 anzusetzende
Münchener Selbstporträt und der Berliner Knabenkops von 1507 kon-
struiert. Diesen Kops bezeichnet Justi als den frühest erhaltenen, der
das Schema ausweist. Auf die Madonna des Rosenkranzbildes ließe es
sich noch nicht anwenden, dagegen schiene es die Berliner Madonna
mit dcmZeisig bereits vorauszusetzen. Vonden »KöpsenderProportions-
lehre« entspricht der männliche Idealkopf bis aus zwei Abweichungen
dem an den ausgezählten großen Idealköpsen sestgestellten Schema,
beim weiblichen Idealkopf jedoch verwirst Dürer, dem Zeitgeschmack
solgend, der ein Überwiegen der geistigen über die sinnlichen Partien
des Gesichtes verlangte, Vitruvs Schema und bringt ein neues. Am
Schluß des zweiten Teiles werden »andere Idealküpse« »vor« und
»nach der venezianischen Reise« aus das Schema hin untersucht, das
sich aber bei den meisten nur teilweise konstatieren läßt.
Der dritte Teil von Justis Buch handelt von den »sremden Ein-
flüssen«. »Spuren in den Proportionssystemen« wiesen auf solgende Per-
sönlichkeiten hin: »Jacopo de'Barbari« sührt Dürer nach dessen eigenen
Worten in die Proportionsstudien ein. Aus welche Weise dies aber ge-
schah, läßt sich aus dem vorhandenen Material nicht mehr eruieren.
Von »Vitruv« ist Dürer zu Beginn seiner Proportionsstudien deutlich ab-
hängig. Mit »Luca Pacioli« hat er vermutlich während seines zweiten
venezianischen Aufenthaltes verkehrt, eine Annahme, die durch das neu
ausgesundene Bild Jacopo de' Barbaris, das den Maler selbst zusammen
mit Luca Pacioli darstellt, unterstützt wird. Doch macht sich die Beein-
flussung Dürers durch den gelehrten Mönch sowie durch »Lionardo«
anderswo geltend als aus dem Gebiete der Proportionsstudien; was sich
hier bei Dürer mit Lionardo deckt, ist keine Abhängigkeit, sondern un-
bewußte, auf gleichen Prämissen basierende Übereinstimmung. Diese
Auffassung der sremden Einslüsse findet Justi durch »Dürers eigene
Äußerungen« bestätigt.
Ich habe den Inhalt des Buches angegeben und mich jeder Kritik
enthalten, weil ich, schon seit längerem mit demselben Thema beschästigt,
hosfe, in absehbarer Zeit an anderem Orte aussührlicher auf Justis Dar-
legungen eingehen zu können, als mir dies hier möglich wäre. Ich möchte
nur noch bemerken, daß die spröde Materie übersichtlich gegliedert und
klar und bündig dargestellt wurde, und daß die Illustrationen, deren
Herstellung infolge der über die Bilder zu druckenden Linienschemen
ebenso schwierig wie zeitraubend war, vorzüglich gelungen sind.
Arpiid Wcixlgärtner.
Rembrandt von Carl Neumann, a. o. Professor
an der Universität Heidelberg. Berlin und Stuttgart,
W. Spemann, 1902.
Vor Jahresfrist wurde an dieser Stelle (Mitteilungen 1902, Nr. 1,
Seite 19) die Erwartung ausgesprochen, daß nun wohl in Bälde von der
deutschen Kunstgeschichtssorschung eine zusammensassende Mono-
graphie über Rembrandt geliefert werden würde, nachdem die vor-
bereitenden Sammelwerke (der Bilder von Bode, der Zeichnungen von
Lippmann, der Radierungen von Blanc, Dutuit u. a.) bereits so weit
gediehen wären, daß sie eine hinreichend solide Grundlage sür einen
solchen Bau zu gewährleisten schienen. Diese Erwartung ist, kurz nach-
dem sie geäußert war, wenigstens äußerlich in Ersüllung gegangen: seil
Neujahr 1902 besitzen wir neben der holländischen Monographie
Vosmaers, der sranzösischen Michels und der englischen Beils auch eine
deutsch geschriebene von einem Prosessor der Kunstgeschichte deutschen
Namens an einer deutschen Universität.
An eine solche langersehnte literarische Erscheinung tritt man mit
bestimmten Erwartungen, denn man hat ja Zeit gehabt, sich gewisse Vor-
stellungen davon zu machen. Das deutsche Publikum, das an der Kunst-
geschichte Interesse nimmt, hat nun wohl von einer wissenschastlichen
Monographie über Rembrandt zunächst einen ersten Band, immerhin von
starkem Umsange, erwartet, der hauptsächlich die Jugendentwicklung
des Meisters, äußerstenfalls bis zur Nachtwache, umsaßte. Die srühesten
Ansänge des werdenden Künstlers wären darin mit größter Sorgfalt versolgt,
so daß von den Erstlingswerken, auch von den untergeordnetsten, kein
einziges unbemerkt bliebe. Der Ausgang wäre stets von den Hand-
zeichnungen genommen, in zweiter Linie die Radierungen betrachtet, und
erst an letzter Stelle die Krönung des Ganzen: das Ölbild, als fertiges,
aber auch bis zu gewissem Grade gebundenes Ergebnis des in der
Zeichnung und Radierung erfindungsmäßig Vorbereiteten und frei
Skizzierten.
Das Buch C. Neumanns enthält nun nichts von alledem. Der
allerdings dickleibige Band behandelt den ganzen Lebenslauf Rembrandts.
zwar von 1500 datiert ist, von Justi aber, wie schon seinerzeit in seinem
Aufsatz „Jacopo de' Barbari und Albrecht Dürer" im XXI. Band des
Repertoriums später angesetzt wird, der Proportionssrau mit Schild und
Beutel in Berlin und schließlich den vier Evadarstellungen: den beiden
Londoner Zeichnungen von 1506, der Zeichnung in der Albertina und
dem Gemälde im Prado. Die Albertinazeichnung fasst Justi gleich den
beiden Londoner Zeichnungen als eine Vorbereitung zur Madrider Eva
auf. — Unter den > Idealfiguren nach der Apollogruppe« werden zuerst
die »Proportionszeichnungen« behandelt. An ihre Spitze ist der Bremer
Proportionsmann von 1513 gestellt, zwischen dieses Blatt und die Apollo-
gruppe werden die von Conway in seinen Literary remains os Albrecht
Dürer p. 234 abgebildeten Proportionsfiguren (die Londoner Dürer-Manu-
scripte sind dem Versasser unbekannt geblieben) eingereiht, den Pro-
portionszeichnungen des Dresdener Codex' wird, „da sie keine wesent-
lichen Züge mehr in das Gesamtbild des Künstlers bringen," nur geringe
Beachtung geschenkt, und in einem knappen Ausblick auf die Arbeiten
an der Proportionslehre wird „die Ausstellung verschiedener Typen nach
Kopslängen" besonders hervorgehoben. »Andere Idealfiguren« wie die
Lucretia von 1508 und die gewissen rätselhasten GruppennackterFiguren
werden gleich den Modellstudien nur ganz slüchtig erwähnt, da sie nicht
konstruiert sind. — Von den »Idealfiguren vor der Apollogruppe« finden
die liegende Frau von 1501 auf der Wiener Zeichnung, an welcher ein
Konstruktionsschema, das jenem der Apollogruppe ähnlich ist, nach-
gewiesen wird, und »die große Fortuna«, die gleichfalls konstruiert sein
soll, eingehendere Behandlung. Die weiblichen Figuren der »frühen Kupfer-
stiche«: die Amymone (Justi meint, daß dieser Stich srüher als die eben
besprochene Albertinazeichnung entstanden ist), die vier Hexen, die
kleine Fortuna, die Venus (im Traum des Doktors) und die Dejanira
werden als nicht konstruiert nur gestreift. In einem »Überblick« wird
der Beginn der Proportionsstudien 1500—1501 angesetzt und die
liegende Frau in der Albertina als die srüheste uns erhaltene Konstruk-
tionsfigur bezeichnet. 1503—1505 hätte dann, wie der Verfasser schon
in seiner Abhandlung im Repertorium nachzuweisen suchte, der rege
künstlerische Austausch zwischen Dürer und Barbari stattgesunden.
Den zweiten Teil, der von den »konstruierten Köpsen« handelt,
leitet Justi damit ein, daß er von den beiden Frauenköpfen (L. 118 von
1519 und L. 270 von 1520) den zweiten sür konstruiert erklärt. Den
»Köpsen in Dreiviertelstellung«, z. B. jenen der Madonna mit der Meer-
katze und der Madonna mit der Heuschrecke, läge wohl eine gewisse
typische Hilsszeichnung, aber kein eigentliches Proportionsschema
zugrunde. Von den »Profilköpsen« sind jene der Amymone, der Venus
und der Dejanira nicht konstruiert, genau konstruiert dagegen und
zwar nach einem von Vitruv ausgehenden und noch in der Proportions-
lehre von 1528 beinahe unverändert wiederkehrenden Schema sind die
Profilköpse der großen Fortuna und der Apollogruppe; während aber
bei den Köpsen der großen Fortuna, des Adam, der Eva (sowohl auf
dem Lannablatt, als auch aus dem Kupserstich) und des Apollo im
Britischen Museum das vollständige Schema in Anwendung gebracht
wurde, liegt der sogenannten Nymphe und dem Adam der Albertina
sowie dem Poynterschen Apollo und dem Äskulap das Schema nur
„gleichsam im Auszug" zugrunde. Von den »Köpsen in Vorderansicht«
werden zuerst jene der »Madonnen« besprochen. Die Köpse der Augs-
burger Muttergottes von 1516, der Madonna in den Usfizien von 1526
und endlich der — jedensalls aus Dürer zurückgehenden — Madonna bei
Konsul Weber in Hamburg sind nachdem in der Proportionslehre für den
männlichen Idealkops gegebenen Schema konstruiert. Dasselbe gilt von
der Londoner Zeichnung von 1520, die als das Porträt einer Toten an-
gesprochen wird, hingegen trisst das Schema bei der Berliner Madonna
von 1518 nicht genau zu. Von »männlichen Idealköpsen« sind der
BremerChristuskopf, das nach Justi etwa um das Jahr 1508 anzusetzende
Münchener Selbstporträt und der Berliner Knabenkops von 1507 kon-
struiert. Diesen Kops bezeichnet Justi als den frühest erhaltenen, der
das Schema ausweist. Auf die Madonna des Rosenkranzbildes ließe es
sich noch nicht anwenden, dagegen schiene es die Berliner Madonna
mit dcmZeisig bereits vorauszusetzen. Vonden »KöpsenderProportions-
lehre« entspricht der männliche Idealkopf bis aus zwei Abweichungen
dem an den ausgezählten großen Idealköpsen sestgestellten Schema,
beim weiblichen Idealkopf jedoch verwirst Dürer, dem Zeitgeschmack
solgend, der ein Überwiegen der geistigen über die sinnlichen Partien
des Gesichtes verlangte, Vitruvs Schema und bringt ein neues. Am
Schluß des zweiten Teiles werden »andere Idealküpse« »vor« und
»nach der venezianischen Reise« aus das Schema hin untersucht, das
sich aber bei den meisten nur teilweise konstatieren läßt.
Der dritte Teil von Justis Buch handelt von den »sremden Ein-
flüssen«. »Spuren in den Proportionssystemen« wiesen auf solgende Per-
sönlichkeiten hin: »Jacopo de'Barbari« sührt Dürer nach dessen eigenen
Worten in die Proportionsstudien ein. Aus welche Weise dies aber ge-
schah, läßt sich aus dem vorhandenen Material nicht mehr eruieren.
Von »Vitruv« ist Dürer zu Beginn seiner Proportionsstudien deutlich ab-
hängig. Mit »Luca Pacioli« hat er vermutlich während seines zweiten
venezianischen Aufenthaltes verkehrt, eine Annahme, die durch das neu
ausgesundene Bild Jacopo de' Barbaris, das den Maler selbst zusammen
mit Luca Pacioli darstellt, unterstützt wird. Doch macht sich die Beein-
flussung Dürers durch den gelehrten Mönch sowie durch »Lionardo«
anderswo geltend als aus dem Gebiete der Proportionsstudien; was sich
hier bei Dürer mit Lionardo deckt, ist keine Abhängigkeit, sondern un-
bewußte, auf gleichen Prämissen basierende Übereinstimmung. Diese
Auffassung der sremden Einslüsse findet Justi durch »Dürers eigene
Äußerungen« bestätigt.
Ich habe den Inhalt des Buches angegeben und mich jeder Kritik
enthalten, weil ich, schon seit längerem mit demselben Thema beschästigt,
hosfe, in absehbarer Zeit an anderem Orte aussührlicher auf Justis Dar-
legungen eingehen zu können, als mir dies hier möglich wäre. Ich möchte
nur noch bemerken, daß die spröde Materie übersichtlich gegliedert und
klar und bündig dargestellt wurde, und daß die Illustrationen, deren
Herstellung infolge der über die Bilder zu druckenden Linienschemen
ebenso schwierig wie zeitraubend war, vorzüglich gelungen sind.
Arpiid Wcixlgärtner.
Rembrandt von Carl Neumann, a. o. Professor
an der Universität Heidelberg. Berlin und Stuttgart,
W. Spemann, 1902.
Vor Jahresfrist wurde an dieser Stelle (Mitteilungen 1902, Nr. 1,
Seite 19) die Erwartung ausgesprochen, daß nun wohl in Bälde von der
deutschen Kunstgeschichtssorschung eine zusammensassende Mono-
graphie über Rembrandt geliefert werden würde, nachdem die vor-
bereitenden Sammelwerke (der Bilder von Bode, der Zeichnungen von
Lippmann, der Radierungen von Blanc, Dutuit u. a.) bereits so weit
gediehen wären, daß sie eine hinreichend solide Grundlage sür einen
solchen Bau zu gewährleisten schienen. Diese Erwartung ist, kurz nach-
dem sie geäußert war, wenigstens äußerlich in Ersüllung gegangen: seil
Neujahr 1902 besitzen wir neben der holländischen Monographie
Vosmaers, der sranzösischen Michels und der englischen Beils auch eine
deutsch geschriebene von einem Prosessor der Kunstgeschichte deutschen
Namens an einer deutschen Universität.
An eine solche langersehnte literarische Erscheinung tritt man mit
bestimmten Erwartungen, denn man hat ja Zeit gehabt, sich gewisse Vor-
stellungen davon zu machen. Das deutsche Publikum, das an der Kunst-
geschichte Interesse nimmt, hat nun wohl von einer wissenschastlichen
Monographie über Rembrandt zunächst einen ersten Band, immerhin von
starkem Umsange, erwartet, der hauptsächlich die Jugendentwicklung
des Meisters, äußerstenfalls bis zur Nachtwache, umsaßte. Die srühesten
Ansänge des werdenden Künstlers wären darin mit größter Sorgfalt versolgt,
so daß von den Erstlingswerken, auch von den untergeordnetsten, kein
einziges unbemerkt bliebe. Der Ausgang wäre stets von den Hand-
zeichnungen genommen, in zweiter Linie die Radierungen betrachtet, und
erst an letzter Stelle die Krönung des Ganzen: das Ölbild, als fertiges,
aber auch bis zu gewissem Grade gebundenes Ergebnis des in der
Zeichnung und Radierung erfindungsmäßig Vorbereiteten und frei
Skizzierten.
Das Buch C. Neumanns enthält nun nichts von alledem. Der
allerdings dickleibige Band behandelt den ganzen Lebenslauf Rembrandts.