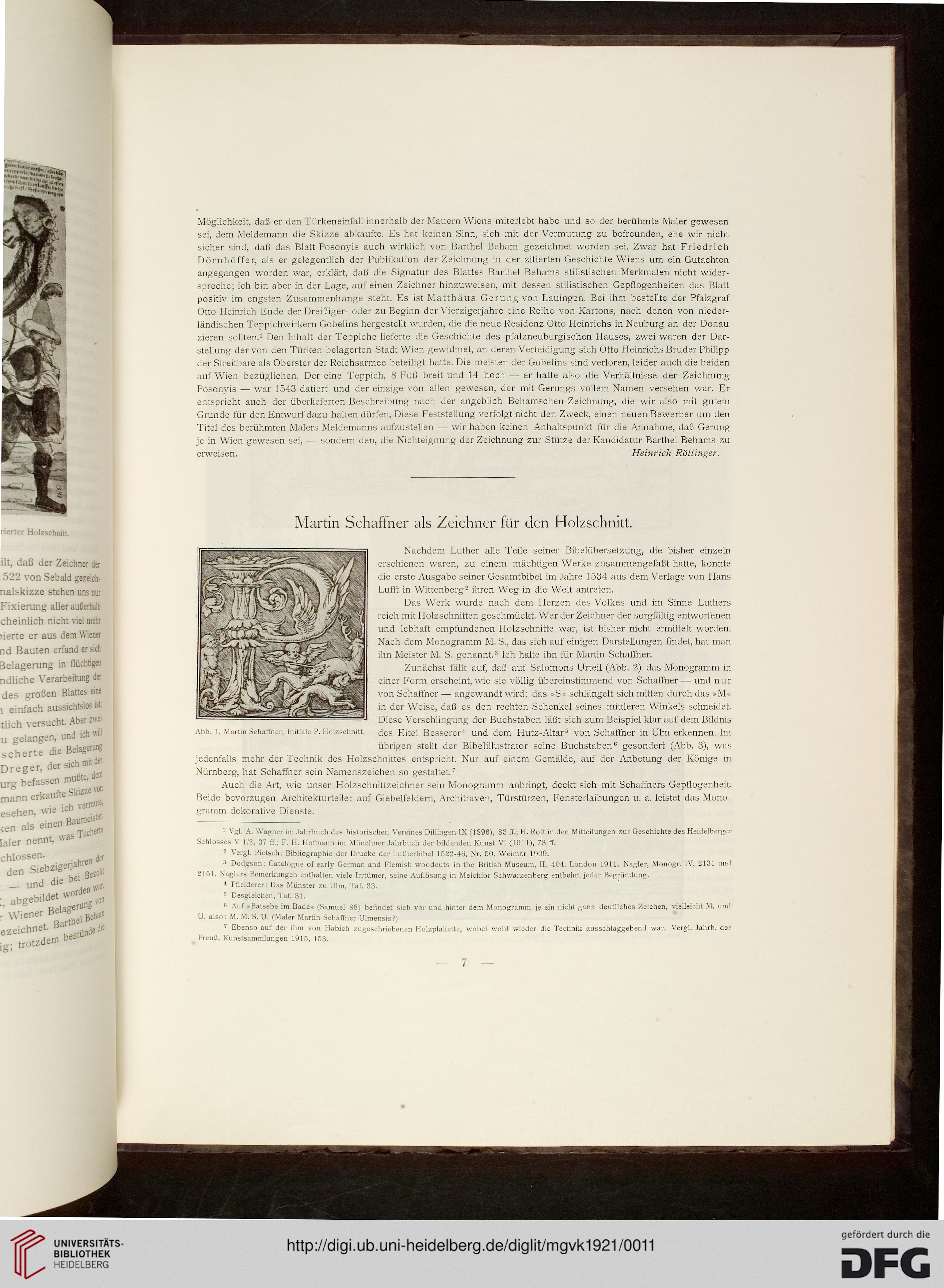■•-"<...
£*.
Möglichkeit, daß er den Türkeneinfall innerhalb der Mauern Wiens miterlebt habe und so der berühmte Maler gewesen
sei, dem Meldemann die Skizze abkaufte. Es hat keinen Sinn, sich mit der Vermutung zu befreunden, ehe wir nicht
sicher sind, daß das Blatt Posonyis auch wirklich von Barthel Beham gezeichnet worden sei. Zwar hat Friedrich
Dörnhöffer, als er gelegentlich der Publikation der Zeichnung in der zitierten Geschichte Wiens um ein Gutachten
angegangen worden war, erklärt, daß die Signatur des Blattes Barthel Behams stilistischen Merkmalen nicht wider-
spreche; ich bin aber in der Lage, auf einen Zeichner hinzuweisen, mit dessen stilistischen Gepflogenheiten das Blatt
positiv im engsten Zusammenhange steht. Es ist Matthäus Gerung von Lauingen. Bei ihm bestellte der Pfalzgraf
Otto Heinrich Ende der Dreißiger- oder zu Beginn der Vierzigerjahre eine Reihe von Kartons, nach denen von nieder-
ländischen Teppichwirkern Gobelins hergestellt wurden, die die neue Residenz Otto Heinrichs in Neuburg an der Donau
zieren sollten.1 Den Inhalt der Teppiche lieferte die Geschichte des pfalzneuburgischen Hauses, zwei waren der Dar-
stellung der von den Türken belagerten Stadt Wien gewidmet, an deren Verteidigung sich Otto Heinrichs Bruder Philipp
der Streitbare als Oberster der Reichsarmee beteiligt hatte. Die meisten der Gobelins sind verloren, leider auch die beiden
auf Wien bezüglichen. Der eine Teppich, 8 Fuß breit und 14 hoch — er hatte also die Verhältnisse der Zeichnung
Posonyis — war 1543 datiert und der einzige von allen gewesen, der mit Gerungs vollem Namen versehen war. Er
entspricht auch der überlieferten Beschreibung nach der angeblich Behamschen Zeichnung, die wir also mit gutem
Grunde für den Entwurf dazu halten dürfen. Diese Feststellung verfolgt nicht den Zweck, einen neuen Bewerber um den
Titel des berühmten Malers Meldemanns aufzustellen — wir haben keinen Anhaltspunkt für die Annahme, daß Gerung
je in Wien gewesen sei, — sondern den, die Nichteignung der Zeichnung zur Stütze der Kandidatur Barthel Behams zu
erweisen. Heinrich Röltinger.
rierter Holzschnitt.
ilt, daß der Zeichner der
522 von Sebald gezeich-
nalskizze stehen uns nur
Fixierung aller außerhalb
cheinlich nicht viel mehr
>ierte er aus dem Wiener
nd Bauten erfand er sich
Belagerung in flüchtigen
ndliche Verarbeitung der
des großen Blattes eine
i einfach aussich:-
tlich versucht. Aber zwei
u gelangen, und ich ■»
scherte die Belagerung
Dreger, der sich mit der
urg befassen mußte,»
mann erkauftes^-
•„ ;r-h verrnutc-
esehen' m Baun**»
<en ^ T vaTlV
laier nennt, was
Jossen. deI
__ und die .
,Upt worden*'
- Wiener Beiag Betiam
eZe.cnnet.Bar fldedl8
:„. trotzdem b«
Martin Schaffner als Zeichner für den Holzschnitt.
Nachdem Luther alle Teile seiner Bibelübersetzung, die bisher einzeln
erschienen waren, zu einem mächtigen Werke zusammengefaßt hatte, konnte
die erste Ausgabe seiner Gesamtbibel im Jahre 1534 aus dem Verlage von Hans
Lufft in Wittenberg2 ihren Weg in die Welt antreten.
Das Werk wurde nach dem Herzen des Volkes und im Sinne Luthers
reich mit Holzschnitten geschmückt. Wer der Zeichner der sorgfältig entworfenen
und lebhaft empfundenen Holzschnitte war, ist bisher nicht ermittelt worden.
Nach dem Monogramm M. S., das sich auf einigen Darstellungen findet, hat man
ihn Meister M. S. genannt.3 Ich halte ihn für Martin Schaffner.
Zunächst fällt auf, daß auf Salomons Urteil (Abb. 2) das Monogramm in
einer Form erscheint, wie sie völlig übereinstimmend von Schaffner — und nur
von Schaffner — angewandt wird: das »S« schlängelt sich mitten durch das »M«
in der Weise, daß es den rechten Schenkel seines mittleren Winkels schneidet.
Diese Verschlingung der Buchstaben läßt sich zum Beispiel klar auf dem Bildnis
des Eitel Besserer4 und dem Hutz-Altar5 von Schaffner in Ulm erkennen. Im
übrigen stellt der Bibelillustrator seine Buchstaben6 gesondert (Abb. 3), was
jedenfalls mehr der Technik des Holzschnittes entspricht. Nur auf einem Gemälde, auf der Anbetung der Könige in
Nürnberg, hat Schaffner sein Namenszeichen so gestaltet.7
Auch die Art, wie unser Holzschnittzeichner sein Monogramm anbringt, deckt sich mit Schaffners Gepflogenheit.
Beide bevorzugen Architekturteile: auf Giebelfeldern, Architraven, Türstürzen, Fensterlaibungen u. a. leistet das Mono-
gramm dekorative Dienste.
Abb. 1. Mai Im Sc
Initiale P. Holzschnitt.
1 Vgl. A. Wagner im Jahrbuch des historischen Vereines Dillingen IX (1S96), 83 ff.; H. Rott in den Mitteilungen zur Geschichte des Heidelberger
Schlosses V 1/2, 37 ff.; F. H. Hofmann im Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst VI (1911), 73 ff.
2 Vergl. Pietsch. Bibliographie der Drucke der Lutherbibel 1522-46, Nr. 50. Weimar 1909.
3 Dodgson; Cataloguc of early German and Flemish woodcuts in the British Museum, II, 404. London 1911. Nagler, Monogr. IV, 2131 und
2151. Naglers Bemerkungen enthalten viele Irrtümer, seine Auflösung in Melchior Schwaizenberg entbehrt jeder Begründung.
' Pfleiderer: Das Münster zu Ulm, Taf. 33.
'■> Desgleichen, Taf. 31.
G Auf »Batsebe im Bade« (Samuel 88) befindet sich vor und hinter dem Monogramm je ein nicht ganz deutliches Zeichen, vielleicht M. und
U. also: M. M. S. U. (Maler Martin Schaffner Ulmensis?)
' Ebenso auf der ihm von Habich zugeschriebenen Holzplakette, wobei wohl wieder die Technik ausschlaggebend war. Vergl. Jahrb. der
Preuß. Kunstsammlungen 1915, 153.
£*.
Möglichkeit, daß er den Türkeneinfall innerhalb der Mauern Wiens miterlebt habe und so der berühmte Maler gewesen
sei, dem Meldemann die Skizze abkaufte. Es hat keinen Sinn, sich mit der Vermutung zu befreunden, ehe wir nicht
sicher sind, daß das Blatt Posonyis auch wirklich von Barthel Beham gezeichnet worden sei. Zwar hat Friedrich
Dörnhöffer, als er gelegentlich der Publikation der Zeichnung in der zitierten Geschichte Wiens um ein Gutachten
angegangen worden war, erklärt, daß die Signatur des Blattes Barthel Behams stilistischen Merkmalen nicht wider-
spreche; ich bin aber in der Lage, auf einen Zeichner hinzuweisen, mit dessen stilistischen Gepflogenheiten das Blatt
positiv im engsten Zusammenhange steht. Es ist Matthäus Gerung von Lauingen. Bei ihm bestellte der Pfalzgraf
Otto Heinrich Ende der Dreißiger- oder zu Beginn der Vierzigerjahre eine Reihe von Kartons, nach denen von nieder-
ländischen Teppichwirkern Gobelins hergestellt wurden, die die neue Residenz Otto Heinrichs in Neuburg an der Donau
zieren sollten.1 Den Inhalt der Teppiche lieferte die Geschichte des pfalzneuburgischen Hauses, zwei waren der Dar-
stellung der von den Türken belagerten Stadt Wien gewidmet, an deren Verteidigung sich Otto Heinrichs Bruder Philipp
der Streitbare als Oberster der Reichsarmee beteiligt hatte. Die meisten der Gobelins sind verloren, leider auch die beiden
auf Wien bezüglichen. Der eine Teppich, 8 Fuß breit und 14 hoch — er hatte also die Verhältnisse der Zeichnung
Posonyis — war 1543 datiert und der einzige von allen gewesen, der mit Gerungs vollem Namen versehen war. Er
entspricht auch der überlieferten Beschreibung nach der angeblich Behamschen Zeichnung, die wir also mit gutem
Grunde für den Entwurf dazu halten dürfen. Diese Feststellung verfolgt nicht den Zweck, einen neuen Bewerber um den
Titel des berühmten Malers Meldemanns aufzustellen — wir haben keinen Anhaltspunkt für die Annahme, daß Gerung
je in Wien gewesen sei, — sondern den, die Nichteignung der Zeichnung zur Stütze der Kandidatur Barthel Behams zu
erweisen. Heinrich Röltinger.
rierter Holzschnitt.
ilt, daß der Zeichner der
522 von Sebald gezeich-
nalskizze stehen uns nur
Fixierung aller außerhalb
cheinlich nicht viel mehr
>ierte er aus dem Wiener
nd Bauten erfand er sich
Belagerung in flüchtigen
ndliche Verarbeitung der
des großen Blattes eine
i einfach aussich:-
tlich versucht. Aber zwei
u gelangen, und ich ■»
scherte die Belagerung
Dreger, der sich mit der
urg befassen mußte,»
mann erkauftes^-
•„ ;r-h verrnutc-
esehen' m Baun**»
<en ^ T vaTlV
laier nennt, was
Jossen. deI
__ und die .
,Upt worden*'
- Wiener Beiag Betiam
eZe.cnnet.Bar fldedl8
:„. trotzdem b«
Martin Schaffner als Zeichner für den Holzschnitt.
Nachdem Luther alle Teile seiner Bibelübersetzung, die bisher einzeln
erschienen waren, zu einem mächtigen Werke zusammengefaßt hatte, konnte
die erste Ausgabe seiner Gesamtbibel im Jahre 1534 aus dem Verlage von Hans
Lufft in Wittenberg2 ihren Weg in die Welt antreten.
Das Werk wurde nach dem Herzen des Volkes und im Sinne Luthers
reich mit Holzschnitten geschmückt. Wer der Zeichner der sorgfältig entworfenen
und lebhaft empfundenen Holzschnitte war, ist bisher nicht ermittelt worden.
Nach dem Monogramm M. S., das sich auf einigen Darstellungen findet, hat man
ihn Meister M. S. genannt.3 Ich halte ihn für Martin Schaffner.
Zunächst fällt auf, daß auf Salomons Urteil (Abb. 2) das Monogramm in
einer Form erscheint, wie sie völlig übereinstimmend von Schaffner — und nur
von Schaffner — angewandt wird: das »S« schlängelt sich mitten durch das »M«
in der Weise, daß es den rechten Schenkel seines mittleren Winkels schneidet.
Diese Verschlingung der Buchstaben läßt sich zum Beispiel klar auf dem Bildnis
des Eitel Besserer4 und dem Hutz-Altar5 von Schaffner in Ulm erkennen. Im
übrigen stellt der Bibelillustrator seine Buchstaben6 gesondert (Abb. 3), was
jedenfalls mehr der Technik des Holzschnittes entspricht. Nur auf einem Gemälde, auf der Anbetung der Könige in
Nürnberg, hat Schaffner sein Namenszeichen so gestaltet.7
Auch die Art, wie unser Holzschnittzeichner sein Monogramm anbringt, deckt sich mit Schaffners Gepflogenheit.
Beide bevorzugen Architekturteile: auf Giebelfeldern, Architraven, Türstürzen, Fensterlaibungen u. a. leistet das Mono-
gramm dekorative Dienste.
Abb. 1. Mai Im Sc
Initiale P. Holzschnitt.
1 Vgl. A. Wagner im Jahrbuch des historischen Vereines Dillingen IX (1S96), 83 ff.; H. Rott in den Mitteilungen zur Geschichte des Heidelberger
Schlosses V 1/2, 37 ff.; F. H. Hofmann im Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst VI (1911), 73 ff.
2 Vergl. Pietsch. Bibliographie der Drucke der Lutherbibel 1522-46, Nr. 50. Weimar 1909.
3 Dodgson; Cataloguc of early German and Flemish woodcuts in the British Museum, II, 404. London 1911. Nagler, Monogr. IV, 2131 und
2151. Naglers Bemerkungen enthalten viele Irrtümer, seine Auflösung in Melchior Schwaizenberg entbehrt jeder Begründung.
' Pfleiderer: Das Münster zu Ulm, Taf. 33.
'■> Desgleichen, Taf. 31.
G Auf »Batsebe im Bade« (Samuel 88) befindet sich vor und hinter dem Monogramm je ein nicht ganz deutliches Zeichen, vielleicht M. und
U. also: M. M. S. U. (Maler Martin Schaffner Ulmensis?)
' Ebenso auf der ihm von Habich zugeschriebenen Holzplakette, wobei wohl wieder die Technik ausschlaggebend war. Vergl. Jahrb. der
Preuß. Kunstsammlungen 1915, 153.