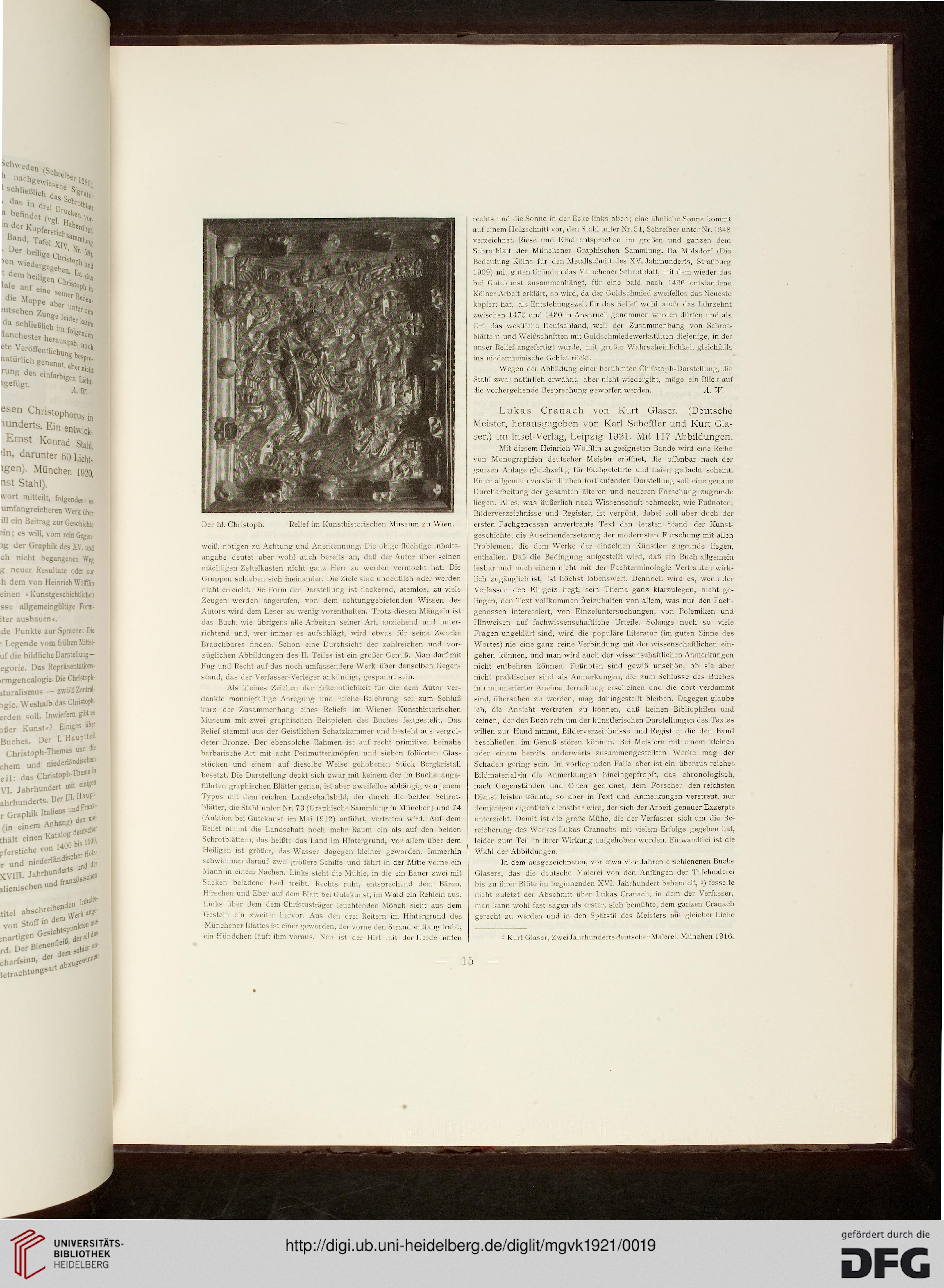T**» ^ IS
' dtS '" drei |v Chro'blalt
' dorn heilig«, ... ' Da das
TT*™»*?*
™« des einfarbig*
.gefügt ° L'*
-I ir
esenChristophorusin
,™dert& Kin entwick-
Ernst Konrad Stahl
■In. darunter 60 Licht.
igen). München 1920
nst Stahl).
»•ort mitteilt, folgendes: es
umfangreicheren Werk über
illein Beitrag zur Geschichte
5 will, vom rein Gegen-
ig der Graphik des XV. und
cht begangenen Weg
g neuer Resultate oder zur
h dem von Heinrich Wdflin
einen »Kunstgeschichtlichen
ligemeingültige Form-
itc; ausbauen«.
de Punkte zur Sprache: Die
• Legende vom frühen Mittel-
uf die bildliche Darstellung-
Uas Repräsentatioas-
irmgencalogie.Die Christoph-
■ turalismus — zwölf Zentnl-
WshalbdasChristoph-
erden soll. Inwiefern
aßer Kunst.? Einig«
Buches. Der I. Htup«««
Christoph-Themas und i*
chem und niederländische*
eil: das Christoph-Tb«-»
VI. Jahrhundert mit «*»
abändert, Der IL. H-P
r Graphik Uahensunf
thältemenK^
pferstiche von HW
XV1I, Jahrhunde*
abenischenundfra«
Inhal15'
ütel abschreibe^»
,,„ Stoff in dem
inWen
vfi
von ->— , onKl"'-
^artigen G"*™^*
Der hl. Christoph.
Relief im Kunsthistorischen Museum /,u Wien.
fleiß,*"
sei*' "
(etrtfhW»!
weiß, nötigen zu Achtung und Anerkennung. Die obige flüchtige Inhalts-
angabe deutet aber wohl auch bereits an, daß der Autor über seinen
mächtigen Zettelkasten nicht ganz Herr zu werden vermocht hat. Die
Gruppen schieben sich ineinander. Die Ziele sind undeutlich oder werden
nicht erreicht. Die Form der Darstellung ist flackernd, atemlos, zu viele
Zeugen werden angerufen, von dem achtunggebietenden Wissen des
Autors wird dem Leser zu wenig vorenthalten. Trotz diesen Mängeln ist
das Buch, wie übrigens alle Arbeiten seiner Art, anziehend und unter-
richtend und, wer immer es aufschlägt, wird etwas für seine Zwecke
Brauchbares finden. Schon eine Durchsicht der zahlreichen und vor-
züglichen Abbildungen des II. Teiles ist ein großer Genuß. Man darf mit
Fug und Recht auf das noch umfassendere Werk über denselben Gegen-
stand, das der Verfasser-Verleger ankündigt, gespannt sein.
Als kleines Zeichen der Erkenntlichkeit für die dem Autor ver-
dankte mannigfaltige Anregung und reiche Belehrung sei zum Schluß
kurz der Zusammenhang eines Reliefs im Wiener Kunsthistorischen
Museum mit zwei graphischen Beispielen des Buches festgestellt. Das
Relief stammt aus der Geistlichen Schatzkammer und besteht aus vergol-
deter Bronze. Der ebensolche Rahmen ist auf recht primitive, beinahe
barbarische Art mit acht Perlmutterknöpfen und sieben foliierten Glas-
Stücken und einem auf dieselbe Weise gehobenen Stück Bergkristall
besetzt. Die Darstellung deckt sich zwar mit keinem der im Buche ange-
führten graphischen Blätter genau, ist aber zweifellos abhängig von jenem
Typus mit dem reichen Landschaftsbild, der durch die beiden Schrot-
blätter, die Stahl unter Nr. 73 (Graphische Sammlung in München) und 74
(Auktion bei Gutekunst im Mai 1912) anführt, vertreten wird. Auf dem
Relief nimmt die Landschaft noch mehr Raum ein als auf den beiden
Schrotblättern, das heißt: das Land im Hinteigrund, vor allem über dem
Heiligen ist größer, das Wasser dagegen kleiner geworden. Immerhin
schwimmen darauf zwei größere Schiffe und fahrt in der Mitte vorne ein
Mann in einem Nachen. Links steht die Mühle, in die ein Bauer zwei mit
Säcken beladene Esel treibt. Rechts ruht, entsprechend dem Bären,
Hirschen und Eber auf dem Blatt bei Gutekunst, im Wald ein Rehlein aus.
Links über dem dem Christusträger leuchtenden Mönch sieht aus dem
Gestein ein zweiter hervor. Aus den drei Reitern im Hintergrund des
Münchener Blattes ist einer geworden, der vorne den Strand entlang trabt;
ein Hündchen läuft ihm voraus. Neu ist der Hirt mit der Herde hinten
rechts und die Sonne in der Ecke links oben; eine ähnliehe Sonne kommt
auf einem Holzschnitt vor, den Stahl unter Nr. 54, Schreiber unter Nr. 1348
verzeichnet. Riese und Kind entsprechen im großen und ganzen dem
Schrotblatt der Münchener Graphischen Sammlung. Da Molsdorf (Die
Bedeutung Kölns für den Metallschnitt des XV. Jahrhunderts, Straßburg
1909) mit guten Gründen das Münchener Schrotblatt, mit dem wieder das
bei Gutekunst zusammenhängt, für eine bald nach 1466 entstandene
Kölner Arbeit erklärt, so wird, da der Goldschmied zweifellos das Neueste
kopiert hat, als Entstchungszeit für das Relief wohl auch das Jahrzehnt
zwischen 1470 und 1480 in Anspruch genommen werden dürfen und als
Ort das westliche Deutschland, weil der Zusammenhang von Schrot-
blättern und Weißschnitten mit Goldschmiedewerkstätten diejenige, in der
unser Relief angefertigt wurde, mit großer Wahrscheinlichkeit gleichfalls
ms niederrheinische Gebiet rückt.
Wegen der Abbildung einer berühmten Christoph-Darstellung, die
Stahl zwar natürlich erwähnt, aber nicht wiedergibt, möge ein Blick auf
die vorhergehende Besprechung geworfen werden. A. W.
Lukas Cratiach von Kurt Glaser. (Deutsche
Meister, herausgegeben von Karl Scheffler und Kurt Gla-
ser.) Im Insel-Verlag, Leipzig 1921. Mit 117 Abbildungen.
Mit diesem Heinrich Wölfflin zugeeigneten Bande wird eine Reihe
von Monographien deutscher Meister eröffnet, die offenbar nach der
ganzen Anlage gleichzeitig für Fachgelehrte und Laien gedacht scheint.
Einer allgemein verständlichen fortlaufenden Darstellung soll eine genaue
Durcharbeitung der gesamten älteren und neueren Forschung zugrunde
liegen. Alles, was äußerlich nach Wissenschaft schmeckt, wie Fußnoten,
Bildcrverzeichnisse und Register, ist verpönt, dabei soll aber doch der
ersten Fachgenossen anvertraute Text den letzten Stand der Kunst-
geschichte, die Auseinandersetzung der modernsten Forschung mit allen
Problemen, die dem Werke der einzelnen Künstler zugrunde liegen,
enthalten. Daß die Bedingung aufgestellt wird, daß ein Buch allgemein
lesbar und auch einem nicht mit der Fachterminologie Vertrauten wirk-
lich zugänglich ist, ist höchst lobenswert. Dennoch wird es, wenn der
Verfasser den Ehrgeiz hegt, sein Thema ganz klarzulegen, nicht ge-
lingen, den Text vollkommen freizuhalten von allem, was nur den Fach-
genossen interessiert, von Einzeluntcrsuchungen, von Polemiken und
Hinweisen auf fachwissenschaftliche Urteile. Solange noch so viele
Fragen ungeklärt sind, wird die populäre Literatur (im guten Sinne des
Wortes) nie eine ganz reine Verbindung mit der wissenschaftlichen ein-
gehen können, und man wird auch der wissenschaftlichen Anmerkungen
nicht entbehren können. Fußnoten sind gewiß unschön, ob sie aber
nicht praktischer sind als Anmerkungen, die zum Schlüsse des Buches
in unnumerierter Aneinanderreihung erscheinen und die dort verdammt
sind, übersehen zu werden, mag dahingestellt bleiben. Dagegen glaube
ich, die Ansicht vertreten zu können, daß keinen Bibliophilen und
keinen, der das Buch rein um der künstlerischen Darstellungen des Textes
willen zur Hand nimmt, Bilderverzeichnisse und Register, die den Band
beschließen, im Genuß stören können. Bei Meistern mit einem kleinen
oder einem bereits anderwärts zusammengestellten Werke mag der
Schaden gering sein. Im vorliegenden Falle aber ist ein überaus reiches
Bildmaterial «in die Anmerkungen hineingepfropft, das chronologisch,
nach Gegenständen und Orten geordnet, dem Forscher den reichsten
Dienst leisten könnte, so aber in Text und Anmerkungen verstreut, nur
demjenigen eigentlich dienstbar wird, der sich der Arbeit genauer Exzerpte
unterzieht. Damit ist die große Mühe, die der Verfasser sich um die Be-
reicherung des Werkes Lukas Cranachs mit vielem Erfolge gegeben hat,
leider zum Teil in ihrer Wirkung aufgehoben worden. Einwandfrei ist die
Wahl der Abbildungen.
In dem ausgezeichneten, vor etwa vier Jahren erschienenen Buche
Glasers, das die deutsche Malerei von den Anfängen der Tafelmalerei
bis zu ihrer Blüte im beginnenden XVI. Jahrhundert behandelt, *) fesselte
nicht zuletzt der Abschnitt über Lukas Cranach, in dem der Verfasser,
man kann wohl fast sagen als erster, sich bemuhte, dem ganzen Cranach
gerecht zu werden und in den Spätstil des Meisters mit gleicher Liebe
Kurt Glaser, Zwei Jahrhunderte deutscher Malerei. München 1916.
15
' dtS '" drei |v Chro'blalt
' dorn heilig«, ... ' Da das
TT*™»*?*
™« des einfarbig*
.gefügt ° L'*
-I ir
esenChristophorusin
,™dert& Kin entwick-
Ernst Konrad Stahl
■In. darunter 60 Licht.
igen). München 1920
nst Stahl).
»•ort mitteilt, folgendes: es
umfangreicheren Werk über
illein Beitrag zur Geschichte
5 will, vom rein Gegen-
ig der Graphik des XV. und
cht begangenen Weg
g neuer Resultate oder zur
h dem von Heinrich Wdflin
einen »Kunstgeschichtlichen
ligemeingültige Form-
itc; ausbauen«.
de Punkte zur Sprache: Die
• Legende vom frühen Mittel-
uf die bildliche Darstellung-
Uas Repräsentatioas-
irmgencalogie.Die Christoph-
■ turalismus — zwölf Zentnl-
WshalbdasChristoph-
erden soll. Inwiefern
aßer Kunst.? Einig«
Buches. Der I. Htup«««
Christoph-Themas und i*
chem und niederländische*
eil: das Christoph-Tb«-»
VI. Jahrhundert mit «*»
abändert, Der IL. H-P
r Graphik Uahensunf
thältemenK^
pferstiche von HW
XV1I, Jahrhunde*
abenischenundfra«
Inhal15'
ütel abschreibe^»
,,„ Stoff in dem
inWen
vfi
von ->— , onKl"'-
^artigen G"*™^*
Der hl. Christoph.
Relief im Kunsthistorischen Museum /,u Wien.
fleiß,*"
sei*' "
(etrtfhW»!
weiß, nötigen zu Achtung und Anerkennung. Die obige flüchtige Inhalts-
angabe deutet aber wohl auch bereits an, daß der Autor über seinen
mächtigen Zettelkasten nicht ganz Herr zu werden vermocht hat. Die
Gruppen schieben sich ineinander. Die Ziele sind undeutlich oder werden
nicht erreicht. Die Form der Darstellung ist flackernd, atemlos, zu viele
Zeugen werden angerufen, von dem achtunggebietenden Wissen des
Autors wird dem Leser zu wenig vorenthalten. Trotz diesen Mängeln ist
das Buch, wie übrigens alle Arbeiten seiner Art, anziehend und unter-
richtend und, wer immer es aufschlägt, wird etwas für seine Zwecke
Brauchbares finden. Schon eine Durchsicht der zahlreichen und vor-
züglichen Abbildungen des II. Teiles ist ein großer Genuß. Man darf mit
Fug und Recht auf das noch umfassendere Werk über denselben Gegen-
stand, das der Verfasser-Verleger ankündigt, gespannt sein.
Als kleines Zeichen der Erkenntlichkeit für die dem Autor ver-
dankte mannigfaltige Anregung und reiche Belehrung sei zum Schluß
kurz der Zusammenhang eines Reliefs im Wiener Kunsthistorischen
Museum mit zwei graphischen Beispielen des Buches festgestellt. Das
Relief stammt aus der Geistlichen Schatzkammer und besteht aus vergol-
deter Bronze. Der ebensolche Rahmen ist auf recht primitive, beinahe
barbarische Art mit acht Perlmutterknöpfen und sieben foliierten Glas-
Stücken und einem auf dieselbe Weise gehobenen Stück Bergkristall
besetzt. Die Darstellung deckt sich zwar mit keinem der im Buche ange-
führten graphischen Blätter genau, ist aber zweifellos abhängig von jenem
Typus mit dem reichen Landschaftsbild, der durch die beiden Schrot-
blätter, die Stahl unter Nr. 73 (Graphische Sammlung in München) und 74
(Auktion bei Gutekunst im Mai 1912) anführt, vertreten wird. Auf dem
Relief nimmt die Landschaft noch mehr Raum ein als auf den beiden
Schrotblättern, das heißt: das Land im Hinteigrund, vor allem über dem
Heiligen ist größer, das Wasser dagegen kleiner geworden. Immerhin
schwimmen darauf zwei größere Schiffe und fahrt in der Mitte vorne ein
Mann in einem Nachen. Links steht die Mühle, in die ein Bauer zwei mit
Säcken beladene Esel treibt. Rechts ruht, entsprechend dem Bären,
Hirschen und Eber auf dem Blatt bei Gutekunst, im Wald ein Rehlein aus.
Links über dem dem Christusträger leuchtenden Mönch sieht aus dem
Gestein ein zweiter hervor. Aus den drei Reitern im Hintergrund des
Münchener Blattes ist einer geworden, der vorne den Strand entlang trabt;
ein Hündchen läuft ihm voraus. Neu ist der Hirt mit der Herde hinten
rechts und die Sonne in der Ecke links oben; eine ähnliehe Sonne kommt
auf einem Holzschnitt vor, den Stahl unter Nr. 54, Schreiber unter Nr. 1348
verzeichnet. Riese und Kind entsprechen im großen und ganzen dem
Schrotblatt der Münchener Graphischen Sammlung. Da Molsdorf (Die
Bedeutung Kölns für den Metallschnitt des XV. Jahrhunderts, Straßburg
1909) mit guten Gründen das Münchener Schrotblatt, mit dem wieder das
bei Gutekunst zusammenhängt, für eine bald nach 1466 entstandene
Kölner Arbeit erklärt, so wird, da der Goldschmied zweifellos das Neueste
kopiert hat, als Entstchungszeit für das Relief wohl auch das Jahrzehnt
zwischen 1470 und 1480 in Anspruch genommen werden dürfen und als
Ort das westliche Deutschland, weil der Zusammenhang von Schrot-
blättern und Weißschnitten mit Goldschmiedewerkstätten diejenige, in der
unser Relief angefertigt wurde, mit großer Wahrscheinlichkeit gleichfalls
ms niederrheinische Gebiet rückt.
Wegen der Abbildung einer berühmten Christoph-Darstellung, die
Stahl zwar natürlich erwähnt, aber nicht wiedergibt, möge ein Blick auf
die vorhergehende Besprechung geworfen werden. A. W.
Lukas Cratiach von Kurt Glaser. (Deutsche
Meister, herausgegeben von Karl Scheffler und Kurt Gla-
ser.) Im Insel-Verlag, Leipzig 1921. Mit 117 Abbildungen.
Mit diesem Heinrich Wölfflin zugeeigneten Bande wird eine Reihe
von Monographien deutscher Meister eröffnet, die offenbar nach der
ganzen Anlage gleichzeitig für Fachgelehrte und Laien gedacht scheint.
Einer allgemein verständlichen fortlaufenden Darstellung soll eine genaue
Durcharbeitung der gesamten älteren und neueren Forschung zugrunde
liegen. Alles, was äußerlich nach Wissenschaft schmeckt, wie Fußnoten,
Bildcrverzeichnisse und Register, ist verpönt, dabei soll aber doch der
ersten Fachgenossen anvertraute Text den letzten Stand der Kunst-
geschichte, die Auseinandersetzung der modernsten Forschung mit allen
Problemen, die dem Werke der einzelnen Künstler zugrunde liegen,
enthalten. Daß die Bedingung aufgestellt wird, daß ein Buch allgemein
lesbar und auch einem nicht mit der Fachterminologie Vertrauten wirk-
lich zugänglich ist, ist höchst lobenswert. Dennoch wird es, wenn der
Verfasser den Ehrgeiz hegt, sein Thema ganz klarzulegen, nicht ge-
lingen, den Text vollkommen freizuhalten von allem, was nur den Fach-
genossen interessiert, von Einzeluntcrsuchungen, von Polemiken und
Hinweisen auf fachwissenschaftliche Urteile. Solange noch so viele
Fragen ungeklärt sind, wird die populäre Literatur (im guten Sinne des
Wortes) nie eine ganz reine Verbindung mit der wissenschaftlichen ein-
gehen können, und man wird auch der wissenschaftlichen Anmerkungen
nicht entbehren können. Fußnoten sind gewiß unschön, ob sie aber
nicht praktischer sind als Anmerkungen, die zum Schlüsse des Buches
in unnumerierter Aneinanderreihung erscheinen und die dort verdammt
sind, übersehen zu werden, mag dahingestellt bleiben. Dagegen glaube
ich, die Ansicht vertreten zu können, daß keinen Bibliophilen und
keinen, der das Buch rein um der künstlerischen Darstellungen des Textes
willen zur Hand nimmt, Bilderverzeichnisse und Register, die den Band
beschließen, im Genuß stören können. Bei Meistern mit einem kleinen
oder einem bereits anderwärts zusammengestellten Werke mag der
Schaden gering sein. Im vorliegenden Falle aber ist ein überaus reiches
Bildmaterial «in die Anmerkungen hineingepfropft, das chronologisch,
nach Gegenständen und Orten geordnet, dem Forscher den reichsten
Dienst leisten könnte, so aber in Text und Anmerkungen verstreut, nur
demjenigen eigentlich dienstbar wird, der sich der Arbeit genauer Exzerpte
unterzieht. Damit ist die große Mühe, die der Verfasser sich um die Be-
reicherung des Werkes Lukas Cranachs mit vielem Erfolge gegeben hat,
leider zum Teil in ihrer Wirkung aufgehoben worden. Einwandfrei ist die
Wahl der Abbildungen.
In dem ausgezeichneten, vor etwa vier Jahren erschienenen Buche
Glasers, das die deutsche Malerei von den Anfängen der Tafelmalerei
bis zu ihrer Blüte im beginnenden XVI. Jahrhundert behandelt, *) fesselte
nicht zuletzt der Abschnitt über Lukas Cranach, in dem der Verfasser,
man kann wohl fast sagen als erster, sich bemuhte, dem ganzen Cranach
gerecht zu werden und in den Spätstil des Meisters mit gleicher Liebe
Kurt Glaser, Zwei Jahrhunderte deutscher Malerei. München 1916.
15